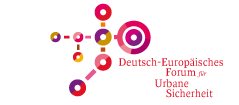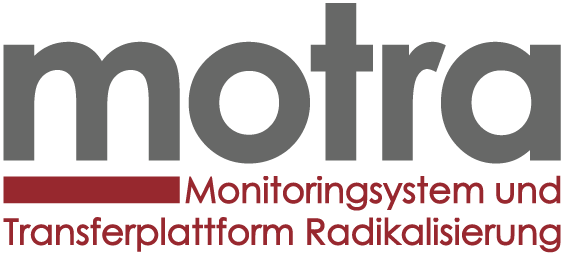Veranstaltungen
Februar 2026
Ein Workshop im Rahmen der Reihe jugenschutz.net Insights zeigt anhand aktueller Praxisbeispiele, wie KI aktuell im extremistischen Kontext genutzt wird. Grundlegende Funktionsweisen werden erklärt sowie Chancen, Schutzmechanismen und Handlungsoptionen diskutiert. Teilnehmende können sich u.a. bei Umfragen oder der gemeinsamen Untersuchung von KI-Inhalten mit ihren Fragen und Fachperspektiven einbringen.
jugendschutz.net Insights: KI & Extremismus - Wie generative Systeme Hass, Propaganda und Desinformation verändern findet in Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz am 24.02.2025 (15.00-16.30 Uhr) per Zoom statt. Die Veranstaltung richtet sich an Fachkräfte und Interessierte, die Teilnahme ist kostenlos. Die Anmeldung ist bis zum 23.02. HIER (https://us06web.zoom.us/meeting/register/oy31OZbHSaOsNnpDN3nFww) möglich.
Angriffe auf den Sozialstaat, autoritäre Zuspitzungen in Innen- und Außenpolitik sowie zunehmende Repression prägen die aktuelle politische Situation. Während Milliarden in Aufrüstung fließen, werden soziale Sicherungssysteme abgebaut und Menschen entrechtet oder abgeschoben – oft mit lebensgefährlichen Folgen.
Vor dem Hintergrund einer drohenden weiteren Rechtsentwicklung wollen wir gemeinsam analysieren, diskutieren und solidarische Gegenstrategien entwickeln. Die 29. Antifaschistische Sozialkonferenz bietet Raum für Austausch, Vernetzung und politische Orientierung.
Ende Februar 2026 laden Arbeit und Leben Niedersachsen, DGB Niedersachsen-Mitte, VVN-BDA Niedersachsen, Kulturzentrum Pavillon, Rosa-Luxemburg-Stiftung Niedersachsen, Bildungswerk ver.di, Initiative Internationaler Kulturaustausch (IIK) und die Geschichtswerkstatt e.V. nach Hannover ein.
Eintritt frei - Barrierefrei - Anmeldung ab Mitte Januar 2026
Umwelt- und Klimakrise beschäftigen viele junge Menschen, gleichzeitig sinkt ihr Engagement in Vereinen, Verbänden und Initiativen. Das Engagementforum 2026 greift diese Entwicklung auf und fragt, wie junge Menschen besser erreicht, beteiligt und gehört werden können.
Unter dem Titel „Ungehört? Ungesehen? Unengagiert?“ diskutieren wir gemeinsam, wie Engagementformate an die Lebensrealitäten junger Menschen angepasst und das Jugendengagement für Nachhaltigkeit gestärkt werden kann.
Die Teilnahme ist beschränkt kostenfrei, die Plätze sind begrenzt.
Anmeldeschluss: 7. Februar 2026.
Am 19. Februar 2026 lädt das landesweite Bündnis NIEDERSACHSEN PACKT AN zur 10. Netzwerkkonferenz unter dem Titel „Demokratie braucht …“ nach Hannover ein. Die Veranstaltung bringt Engagierte aus Zivilgesellschaft, Politik, Verwaltung, Wissenschaft und Praxis zusammen, um über die Zukunft von Demokratie, Integration, sozialem Zusammenhalt und gelebtem Engagement zu diskutieren.
Seit zehn Jahren steht NIEDERSACHSEN PACKT AN für gelebte Verantwortungspartner- schaft, die Integration, demokratisches Miteinander und Vielfalt stärkt. Die Jubiläumskonferenz nimmt in den Blick, wie das Bündnis weiter genutzt werden kann, um demokratische Werte aktiv zu verteidigen und das bürgerschaftliche Engagement zu stärken.
Im Mittelpunkt stehen Austausch und Praxisimpulse – vom „Marktplatz der Ideen“ mit über 50 Initiativen aus Niedersachsen bis zu Foren, Workshops und Podiumsdiskussionen zu Begegnung, Jugendbeteiligung und zivilgesellschaftlicher Arbeit. Der Niedersächsische Ministerpräsident Olaf Lies lädt ein zu einer gemeinsamen Vision für ein integrations- freundliches und zukunftsorientiertes Niedersachsen.
Mit einem Impuls von Tabea Böker und Fadl Speck (Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus)
Die Veranstaltung widmet sich den aktuellen Debatten um politische Teilhabe in einer postmigrantischen Gesellschaft. Trotz der jüngsten Reformen des Staatsbürgerschaftsrechts bleibt die Frage nach der Ausgestaltung politischer Beteiligungsmöglichkeiten für Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft weiterhin offen und politisch umkämpft. Besonders in Großstädten betrifft dies einen erheblichen Teil der Bevölkerung. Die Diskussion nimmt historische und gesellschaftliche Prägungen in den Blick, die deutsche Debatten im Vergleich zu anderen westeuropäischen Ländern bis heute prägen, und thematisiert die Rolle politischer Bildung in diesen Aushandlungsprozessen. Dabei steht die Frage im Mittelpunkt, wie sich politische Bildung in einem Umfeld gesellschaftlicher Transformation verorten und eigene professionelle Selbstverständnisse kritisch reflektieren kann.
Der Messerangriff in der Bielefelder Innenstadt am 18. Mai 2025 hat Ängste, Verunsicherung und gesellschaftliche Spannungen ausgelöst. Besonders präsent war die Sorge vor einer rechtsextremen Instrumentalisierung der Tat.
Im Webtalk berichten Mareike Wilke und Andreas Zick vom Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung (IKG) der Universität Bielefeld von ihren Erfahrungen mit dem Dialogabend „Reden nach dem Anschlag“. Im Mittelpunkt stehen Austausch, Einordnung sowie Fragen nach Solidarität und gegenseitiger Unterstützung nach Gewalttaten.
Der Webtalk ist Teil der RADIS-Reihe „Getroffene Orte – Lokale Strategien im Umgang mit islamistischer und rassistischer Gewalt“.
Das Ziel von diskriminierungskritischer Öffentlichkeitsarbeit ist es, Angebote zu bewerben, ohne in stereotypisierende oder kulturalisierende Muster zu verfallen. Stattdessen werden die Angebote möglichst barrierefrei beworben und erreichen die Personen, für die sie zugeschnitten sind. Dafür ist es notwendig, einen genaueren Blick darauf zu werfen, wo Diskriminierung in Sprache und Schrift überhaupt stattfindet und was die üblichen ?Fettnäpchen? sind. Zudem werden durch das Webseminar Möglichkeiten zur Veränderung der eigenen Öffentlichkeitsarbeit aufgezeigt, beispielsweise durch eine Einführung in die Gestaltung von barrierefreien Websites und Dokumenten.
In einem ersten Teil wird es einen offenen Input zum Thema Diskriminierung, Machthierarchien, Sprache und Bilder geben. In zweiten Teil des Seminars wird es einen Input zum Thema barrierefreie Websites und barrierefreie pdf-Dokumente geben. Zudem bekommen die Teilnehmenden die Möglichkeit zum Austausch und zur Reflexion der eigenen Praxis.
An wen richtet sich dieser Workshop?
Diese Fortbildung richtet sich an alle Interessierten und Einsteiger*innen im Themenfeld. Wir setzen eine aktive Teilnahme während der Veranstaltung voraus.
Das Seminar findet online über zoom statt, nach erfolgreicher Anmeldung bekommen Sie einen Link zur Teilnahme zugeschickt.
Bitte seien Sie fair und melden sich nur an, wenn Sie fest vorhaben, an dem Webseminar teilzunehmen. Sollte Ihnen doch etwas dazwischenkommen, sagen Sie bitte rechtzeitig ab, dann können ggf. Personen von der Warteliste nachrücken.
Was kostet die Teilnahme?
Die Teilnahme an dieserO Online-Fortbildung kostenlos.
Referent*innen-Team: Anisa Abdulaziz, Tinka Greve und Lisa-Marie Benda. Fachstelle vielgestaltig*2.0 | www.projekt-vielgestaltig.de
Anmeldung: www.vnb.de
Für weitere Informationen: vielgestaltig@vnb.de
-
10.02.2026
Extremistische Einstellungen bei jungen Menschen nehmen zu. Radikalisierung ist jedoch kein plötzliches Ereignis, sondern ein Prozess, der präventiv beeinflusst werden kann. Diese zweitägige Fortbildung vermittelt fundiertes Wissen und praxistaugliche Strategien, um Präventionsarbeit wirksam und planbar zu gestalten.
Grundlage ist das entwicklungsorientierte Präventionsmodell von Prof. Dr. Andreas Beelmann (Universität Jena), das vier zentrale Risikofaktoren von Radikalisierung identifiziert und evidenzbasierte Ansatzpunkte für Prävention aufzeigt. Die Teilnehmenden lernen, Bedarfe zu analysieren, wirksame Maßnahmen auszuwählen und konkrete Strategien für ihren eigenen Verantwortungsbereich zu entwickeln.
Kosten: kostenfrei (gefördert durch das Land Niedersachsen)
Abschluss: Zertifikat, als Bildungsurlaub anerkennbar
Anmeldung: Plätze begrenzt
-
06.02.2026
Fragen nach der Integration von Migranten, der inneren Sicherheit und des Grenzregimes wirken sich zunehmend auch auf gesellschaftspolitische Debatten und die politische Stimmung im Land aus. Gleichzeitig benötigt unser Land die Arbeitsmigration genauso wie den demographischen Zuwachs. Das Seminar will sich diesen Fragen stellen. Es analysiert die Herausforderungen und Möglichkeiten in Politikfeldern wie dem Arbeitsmarkt, der Integration und Demografie, aber auch der inneren Sicherheit und der Europapolitik.
Januar 2026
Das Barcamp richtet sich an Fachkräfte des präventiven und gesetzlichen Kinder- und Jugendschutzes, an Präventionsfachkräfte sowie an die Beauftragten für Jugendsachen der Polizei. Im Mittelpunkt stehen ein Impulsvortrag sowie der fachliche Austausch zu aktuellen Themen des Jugendschutzes und der Prävention.
Zielgruppe:
Fachkräfte aus Jugendschutz, Suchtprävention, Schulsozialarbeit, Jugendarbeit der Polizei sowie Schule aus der Region Hannover. Die Teilnahme ist kostenlos, die Anmeldung erforderlich.
Kontakt:
Leon Nolte
Tel.: 0511 616 25609
E-Mail: juschu@region-hannover.de
Mit Erik Alm (KORA Sachsen), Andrea Hübler (RAA Sachsen), Mario Herber und Thomas Herbst (Polizeidirektion Dresden). Moderation: Manuela Freiheit (IKG, RADIS) und Lars Schäfer (VPN, RADIS).
Die zunehmende Radikalisierung von jungen Menschen durch Social Media stellt eine große Herausforderung in unserer Zeit dar. Islamistische Gruppen nutzen gezielt Soziale Medien wie TikTok, Instagram, Telegram und YouTube, um ihre Ideologien zu verbreiten und demokratische Werte anzugreifen.
Gemeinsam mit Expertinnen und Experten sowie Fachkräften der politischen Bildung sollen im Rahmen einer Präsenzveranstaltung neue, kreative Alternativen zu den existierenden islamistischen TikTok-Narrativen im Rahmen von Workshops und Diskussionen entwickelt und untersucht werden. Die Veranstaltung soll vor allem eine Perspektive zur Frage bieten, wie politische Bildung digitale Räume (v. a. TikTok) nutzen kann, um demokratische, inklusive und sinnstiftende Narrative zu verbreiten.
Dezember 2025
Social Media prägt öffentliche Kommunikation, doch viele etablierte Plattformen stehen wegen Datenschutzproblemen, undurchsichtiger Algorithmen und begrenzter Mitbestimmung in der Kritik. Die Fortbildung stellt das Fediverse als dezentrale und nicht-gewinnorientierte Alternative vor, in der unabhängige Plattformen wie Mastodon, PeerTube oder Pixelfed miteinander vernetzt sind.
Vermittelt werden zentrale Funktionsweisen des Fediverse, seine Unterschiede zu kommerziellen Diensten und die Hintergründe der sogenannten „Reichweitenlüge“. Zudem werden Chancen für Bildungsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit und zivilgesellschaftliche Projekte aufgezeigt. Das Angebot richtet sich an alle, die neue, nutzerorientierte Formen digitaler Kommunikation erkunden möchten, insbesondere im Kontext politischer Bildung und Öffentlichkeitsarbeit.
Vier Absolvent*innen präsentieren im Rahmen einer Online-Veranstaltung ihre empirischen Abschlussarbeiten zu unterschiedlichen Handlungsfeldern der nonformalen politischen Bildung. Die Präsentationen umfassen jeweils Fragestellung, methodisches Vorgehen und zentrale Befunde. Im Anschluss besteht Gelegenheit zur Diskussion und zum fachlichen Austausch.
Die vorgestellten Arbeiten beschäftigen sich mit:
- Digitalen Formaten historisch-politischer Bildung und der Auseinandersetzung mit Antisemitismus auf TikTok
- Anforderungen und Herausforderungen in der politischen Bildungsarbeit von Stadtjugendringen
- Dem Prinzip Freiwilligkeit in der außerschulischen Jugendbildung und in Kooperationen mit Schulen
- Motivationsfaktoren von Fachkräften in der politischen Jugendbildung
Die Arbeiten behandeln aktuelle Fragestellungen aus verschiedenen Perspektiven: von digitalen Bildungsformaten über organisationale Rahmenbedingungen bis zu grundlegenden didaktischen Prinzipien und professionsbezogenen Themen.
Die Veranstaltung richtet sich an Fachkräfte aus Wissenschaft, Studierende, Praxis, Aus- und Weiterbildung, Förderung nonformaler politischer Bildung und alle Interessierten.
Die Veranstaltung stellt den Auftakt einer Dialogveranstaltung dar, welche jeweils zum Jahresende stattfinden wird.
In der ersten Ausgabe ist Adrian Stuiber zu Gast bei Camino. Er ist Mitarbeiter im Projekt dist[ex] des Interdisziplinären Zentrums für Radikalisierungsprävention und Demokratieförderung e.V. (IZRD) und Experte für Extremismusprävention im Onlinekontext. Gemeinsam mit ihm werden die Attraktivität von Onlineplattformen herausarbeitet, die diese sowohl auf Jugendliche als auch auf extremistische Akteure ausüben. Dabei werden auch die zugrunde liegende Mechanismen des Digitalraums beleuchtet. Anschließend wird gemeinsam ermittelt, welche Bedarfe sich für die Präventionspraxis daraus ableiten lassen und inwiefern es bewährte Ansätze zur Arbeit im digitalen Raum gibt. In der zweiten Hälfte der Veranstaltung wird das Format für eine Diskussion von Fragen aus dem Publikum geöffnet.
Am Donnerstag, 11. Dezember 2025, lädt die Region Hannover zum Vortrag „Mission Impossible: Die Entnazifizierung der deutschen Gesellschaft“ mit Prof.in Cornelia Rauh ins Regionshaus ein.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs bestand unter den Alliierten Einigkeit darüber, Deutschland konsequent von nationalsozialistischen Strukturen zu befreien. Die sogenannte „Entnazifizierung“ wurde eines der zentralen politischen Projekte der Nachkriegszeit.
Der Vortrag beleuchtet, wie dieses Vorhaben in den vier Besatzungszonen umgesetzt wurde, welche Akteure dabei eine Rolle spielten und warum die Bemühungen rasch an Glaubwürdigkeit verloren. Zudem wird der Frage nachgegangen, ob und inwiefern die DDR erfolgreicher darin war, personelle Kontinuitäten aus der NS-Zeit zu überwinden.
Der Vortrag von Birol Mertol (FUMA Fachstelle Gender & Diversität NRW) beleuchtet, wie rassifizierte Männlichkeiten* historisch und gesellschaftlich konstruiert werden und wie diese Konstruktionen mit weiß dominierten Machtstrukturen verknüpft sind. Auch aktuelle Diskurse – etwa um die Silvesternächte 2015/16 und 2022/23 oder Stadtbilddebatten – zeigen, wie Rassismus und Männlichkeitsbilder ineinandergreifen, um bestehende Hierarchien zu sichern.
Im Zentrum stehen die Intersektionen von Rassismus und Männlichkeiten* sowie pädagogische Zugänge zu Rassismuskritik, Empowerment und Powersharing. Die Veranstaltung richtet sich an pädagogische Fachkräfte und Interessierte, die ihre Praxis diskriminierungskritisch weiterentwickeln möchten.
Kosten: kostenfrei
Anmeldung: bis 10.12.2025 unter www.vnb.de
Online-Veranstaltung zur Veröffentlichung von Heft 10 (Jg. 5, Heft 2) der Zeitschrift für Rechtsextremismusforschung (ZRex)
Nikolas Dietze und Gudrun Hentges, zwei Autor*innen des aktuellen Heftes, stellen zentrale Ergebnisse ihrer Studien vor. Die Beiträge untersuchen, wie politische bzw. verschwörungsideologische Akteur*innen gesellschaftliche Ungleichheiten, Verunsicherungen usw. nutzen, um gesellschaftliche Spaltungen zu vertiefen. Anschließend folgt ein moderiertes Gespräch über die politischen und gesellschaftlichen Implikationen.
Termin: 10. Dezember 2025, 9.30–12.30 Uhr, online via Zoom
Kosten: kostenfrei
Anmeldung bis: 9. Dezember 2025 unter www.vnb.de/schnacknroll
-
09.12.2025
Klimawandelbedingte Migration ist eine der großen globalen Herausforderungen unserer Zeit. Extreme Wetterereignisse, der Anstieg des Meeresspiegels und schleichende Umweltveränderungen zwingen Millionen Menschen dazu, ihre Heimat zu verlassen. Besonders betroffen sind ohnehin fragile Regionen, in denen Armut, Instabilität und Ressourcenknappheit die Folgen des Klimawandels verschärfen. Migration wird dabei nicht nur als Problem sichtbar, sondern auch als mögliche Anpassungsstrategie.
Die Tagung nimmt die vielfältigen Zusammenhänge von Klimawandel und Migration in den Blick und fragt nach politischen, rechtlichen und gesellschaftlichen Handlungsoptionen. Ziel ist es, Wissen zu bündeln, verschiedene Perspektiven zusammenzuführen und Lösungsansätze für Herkunfts- wie Aufnahmeländer zu entwickeln.
Folgende Fragen stehen im Mittelpunkt:
- Wie lassen sich die vielfältigen Zusammenhänge zwischen Klimawandel und Migration analytisch fassen?
- Welche Möglichkeiten und Grenzen haben Prognosen und Szenarien zur klimawandelbedingten Migration?
- Welche rechtlichen Instrumente existieren, und wie weit reichen internationale Abkommen und Governance-Strukturen?
- Wie kann die internationale Politik klimawandelbedingte Migration erfassen und regulieren?
- Wie kann Entwicklungszusammenarbeit Herkunftsregionen stärken?
Die Tagung richtet sich an Fachleute aus Wissenschaft und Forschung, Politik und Verwaltung, Kirche, Entwicklungszusammenarbeit, NGOs sowie die interessierte Öffentlichkeit.
Tagungsgebühren:
- Regulär: 150€
- Ermäßigt: 100€
Antifeministische Akteurinnen bzw. Akteure prägen zunehmend das Bild von „echter Männlichkeit“: stark, dominant, unberührbar. Bilder von unverletzbarer „Kriegerischer Männlichkeit“ haben Konjunktur. Solche Narrative finden besonders bei solchen Jungen* Anschluss, die auf der Suche nach Orientierung und Anerkennung sind.
Doch welche Vorstellungen von Männlichkeit(en) machen Jugendliche empfänglich für antifeministische Haltungen? Und wie kann gendersensible Jungen*arbeit hier wirksam gegensteuern?
Für den Tag nach dem Anschlag vom 19. Februar 2020 gab es kein etabliertes Erfahrungswissen, auf das die Stadt Hanau zurückgreifen konnte. Im Rückblick formuliert Robert Erkan, damaliger städtischer Opferberater, zehn zentrale Lehren aus den ersten Tagen und Wochen nach der Tat. Sie zeigen, wie anspruchsvoll es ist, den Bedürfnissen der Betroffenen gerecht zu werden und gleichzeitig zwischen polizeilicher Aufklärung, kommunaler Krisenbewältigung und psychosozialer Unterstützung zu vermitteln. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Zusammenarbeit der vielen beteiligten Akteur:innen, die für den lokalen Zusammenhalt unmittelbar nach der Tat entscheidend sind.
Mit: Robert Erkan (Mediator und Coach, ehemaliger städtischer Opferberater der Stadt Hanau)
Der Webtalk ist Teil der Reihe „Getroffene Orte“. Sie rückt lokale Perspektiven auf islamistische und rassistische Anschläge in den Vordergrund und zeigt, wie vor Ort neue Formen von Solidarität, Erinnerung und Kooperation entstehen. Die Reihe bündelt Erfahrungen, die für Prävention wie auch für das akute Krisenmanagement relevant sind – von kommunalen Erinnerungsprojekten über Bildungsangebote bis hin zur Unterstützung Betroffener und dem Umgang mit Polarisierungen und Co-Radikalisierungen.
„Antisemitismus ist in der Türkei ein weit verbreitetes Phänomen (…) Jedoch sind zahlreiche antisemitische Topoi und Referenzen aus dem türkischen Diskurs – ob islamisch oder säkular – ohne eine Kenntnis des Hintergrunds nicht ohne weiteres erkennbar. Das führt in hiesigen Debatten zu pauschalen Vereinfachungen bezüglich des sogenannten ‚importierten‘ oder ‚islamischen‘ Antisemitismus oder aber zu seiner Bagatellisierung“, Corry Guttstadt. Der Online-Salon beleuchtet Antisemitismus in der Türkei mit Fokus auf die türkische extreme Rechte und wirft die Frage auf, wie diese Strömungen auch im deutschen Kontext wirken.
Mit Corry Guttstadt, Turkologin und Historikerin, und Kim David Amon, Fachreferent in der Fachstelle Türkischer Rechtsextremismus (FaTRex).
Hier geht es zur Anmeldung.
Der Online Salon ist eine Veranstaltung im Rahmen des Kooperationsverbund Rechtsextremismusprävention (KompRex), gefördert vom Bundesprogramm Demokratie leben!
November 2025
Die Teilnahmegebühr beträgt 490€. Anmeldeschluss ist der 15.10.
-
26.11.2025
Unter dem Titel „Politische Bildung in Zeiten rechtsextremer Bedrohung“ lädt der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten e. V. (AdB) vom 25. bis 26. November 2025 ins Gustav-Stresemann-Institut in Bad Bevensen ein.
Die Fachtagung greift das AdB-Jahresthema 2025/2026 auf und widmet sich der Frage, wie politische Bildung auf rechtspopulistische und rechtsextreme Anfeindungen reagieren kann. Im Fokus stehen strategische und konzeptionelle Ansätze, um demokratische Strukturen und Akteur*innen zu stärken.
Zum Auftakt analysiert die Politikwissenschaftlerin Natascha Strobl aktuelle gesellschaftliche Diskursverschiebungen. Der zweite Tag bietet praxisorientierte Fortbildungen, in denen Expert*innen Handlungsmöglichkeiten für Einrichtungen der politischen Bildung vorstellen.
-
25.11.2025
Auf dem Fachtag wird auch der PrEval Monitor 2025 der Öffentlichkeit vorgestellt. Der PrEval Monitor fasst alle wesentlichen Erkenntnisse und Empfehlungen zur Leitfrage des PrEval-Verbundes zusammen: Was braucht gute Evaluation, um Extremismusprävention, Demokratieförderung und politische Bildung zu stärken?
-
25.11.2025
Nach drei Jahren intensiver Arbeit zieht das Projekt PrEval - Zukunftswerkstätten Bilanz: Welche Strukturen, Formate und Netzwerke haben sich bewährt, und wie kann Evaluation und Qualitätssicherung in der Extremismusprävention, Demokratieförderung und politischen Bildung künftig weiterentwickelt werden?
Der PrEval-Fachtag 2025 bietet einen Überblick über zentrale Ergebnisse, Empfehlungen und Entwicklungen aus Praxis und Forschung. Im Fokus stehen kommunale Evaluationsstrukturen, internationale Trends sowie die Vorstellung des PrEval Monitors 2025, der die wichtigsten Erkenntnisse und Politikempfehlungen bündelt.
In einem interaktiven World Café werden Bedarfe, Herausforderungen und Perspektiven gemeinsam diskutiert – von Evaluationsmethoden über digitale Beratungsangebote bis hin zum Umgang mit Evaluationsergebnissen in Organisationen. Zudem wird ein erster Entwurf einer bundesweiten Evaluationsdatenbank vorgestellt.
Teilnahme: Vor Ort oder im Livestream
Anmeldung: Bis 10. November 2025 per E-Mail an preval@prif.org
Freuen Sie sich auf spannende Inputs, interaktive Elemente und die Vorstellung der Projektergebnisse 2025. Neben inspirierenden Keynotes erwarten Sie eine Podiumsdiskussion, eine Ideenwerkstatt sowie Gelegenheit zum Austausch.
Am 22. November 2025 lädt das Bündnis Menschenrechte grenzenlos! von 13:00 bis 18:00 Uhr zum Workshoptag „Zusammen Zukunft schaffen – Solidarische Perspektiven realisieren“. Der Eintritt ist frei, eine Kinderbetreuung wird vor Ort angeboten.
In vier Workshops werden verschiedene Perspektiven auf Solidarität, Teilhabe und gesellschaftliches Miteinander beleuchtet:
- „Ehrenamtliche Vormundschaften für minderjährige Flüchtlinge“ (Janusz Korczak Humanitäre Flüchtlingshilfe e.V. – JKV)
- „Schreiben als Widerstand und Selbstermächtigung“ (Carmela Dentice)
- „Solidarische Stadt – Gemeinsam Ideen entwickeln“ (Flüchtlingsrat Niedersachsen, Rosa-Luxemburg-Stiftung Niedersachsen)
- „Solidarisches Preppen für eine gemeinschaftliche Zukunft?“ mit Tadzio Müller, Aktivist und Autor
Zum Abschluss lädt das „Wohnzimmer der gemeinsamen Geschichten“ ab 17:00 Uhr alle Teilnehmenden zu einem offenen Austausch ein. Ziel des Workshoptages ist es, gemeinsame Perspektiven für eine solidarische, diskriminierungsfreie Gesellschaft zu entwickeln.
Anmeldung (inkl. Bedarf an Kinderbetreuung) bitte per E-Mail an: joerg.djuren@kulturzentrum-faust.de
Der Workshop zur „Ülkücü Bewegung“ richtet sich an pädagogische Fachkräfte und Multiplikator:innen.
Zunächst wird im Workshop auf die Ideologie der Bewegung eingegangen. Hier steht die sogenannte „Türkisch-Islamische Synthese“ im Vordergrund. Anschließend gibt es einen Einblick in die Organisationsstruktur der „Ülkücü-Bewegung“ in der BRD. Im Fokus stehen hier die Gewalt und Terror bis in die 90er Jahre und der Strategiewechsel in den 1990er Jahren hin zum „legalistischen Islamismus“.
Es wird eine Einschätzung über aktuelle und zukünftige Entwicklungen gegeben und die Teilnehmenden werden über die Symboliken der Anhänger:innen aufgeklärt. Abschließend wird ein Vergleich zwischen dem „deutschen“ und „türkischen“ Rechtsextremismus angestellt und über Möglichkeiten der Prävention gesprochen.
Dieser Workshop widmet sich zentralen Fragestellungen:
- Was ist Adultismus, welche Funktionen und Wirkweisen verbergen sich dahinter?
- In welcher Weise tragen Erwachsene unbewusst zur Aufrechterhaltung von Machtstrukturen bei?
- Welche Möglichkeiten gibt es, um adultistische Strukturen zu erkennen und zu durchbrechen?
Nach einem Input zur Definition und den Formen von Adultismus tauschen wir uns über Strategien und Methoden aus, um eine respektvollere und partizipative Begegnung mit Kindern und Jugendlichen zu fördern. Der Workshop bietet einen Einstieg ins Thema und lädt zur Selbstreflexion ein.
Die Teilnahme ist kostenlos.
Gemeinsam leben klingt einfach - ist aber in mehrfach und multidimensional fragmentierten Gesellschaften nicht einfach und schon gar nicht selbstverständlich. Einerseits teilen Menschen verschiedene Lebenswelten miteinander, andererseits trennen verschiedene Milieus (inklusive der dazugehörigen habituellen Formen) Menschen voneinander. Von einigen wird das als polarisierte oder gespaltene Gesellschaft empfunden und beschrieben. Anscheinend mangelt es manchen Menschen der Empathie und Perspektivenübernahme von anderen Lebensweisen und -welten.
Dieses Seminar möchte sich mit der Frage des Zusammenlebens in einer pluralen Gesellschaft mit dem Blick auf Diskriminierung, Auschluss und Gewalt gegenüber Menschen aufgrund einer tatsächlichen und/oder vermeintlichen Zugehörigkeit beschäftigen. Wie ist Zusammenleben angesichts einer aggressiven Sprache und ausgrenzenden Praktiken möglich? Welches Verständnis gibt es für die anderen Seiten? Wie kommen wir wieder zu einem gemeinsamen Sprechen und Handeln? Dabei müssen wir bei uns beginnen, mit unseren eigenen gesellschaftlichen Voraussetzungen von Wissen, Denken und Handeln auseinanderzusetzen. Woher kommt unser Vorurteilswissen? Über welche gesellschaftlichen Bestände an diskriminierenden Wissen verfügen wir? Welche Haltung möchten wir dazu einnehmen? Wie können wir zu einer zivilgesellschaftlich handelnden Person werden, die andere Perspektiven wahrnimmt, zuhört und sprechen lässt?
Unter Othering versteht man die Andersmachung von Gruppen; beispielsweise aufgrund ihrer (zugeschriebenen) ethnischen, kulturellen, religiösen Zugehörigkeit oder sexuellen Orientierung.
Machtvolle Gruppen werten weniger machtvolle Gruppen durch Fremdzuschreibungen ab und sprechen ihnen damit auch die Zugehörigkeit zur eigenen Gruppe und zu gewissen Grundrechten ab. Durch die Abwertung der „Anderen“ fällt gleichzeitig die Selbstbewertung der eigenen Gruppe positiv aus.
Aber wie entstehen eigentlich die abwertenden Bilder und Geschichten über die "Anderen", die sich dann in unseren Köpfen festsetzen? Und welche Rolle spielen hierbei gesellschaftliche Machtverhältnisse und unsere eigene Position darin?
In dieser Online-Fortbildung setzen sich die Teilnehmenden gemeinsam mit dem Phänomen und den Wirkungsweisen von Andersmachung auseinander. Ziel ist die kritische Reflexion eigener Denk- und Verhaltensmuster, um Othering entgegenzuwirken.
Anmeldeschluss: 15.11.2025
Am 18. November 2025 lädt das Projekt Netzwerk Migrantinnen und Arbeitsmarkt Niedersachsen (NeMiA 2.0) herzlich zur Fachtagung „Migrantische Frauen als CEOs von morgen“ in die ver.di-Höfe Hannover ein. Von 12:30 bis 16:30 Uhr dreht sich alles um die Perspektiven migrantischer Frauen in Führungspositionen, ihre Chancen, Herausforderungen und Wege zu mehr Sichtbarkeit und Teilhabe in Wirtschaft und Gesellschaft.
Die Veranstaltung wird von Naciye Celebi-Bektas, Projektleitung NeMiA 2.0, moderiert. Als Keynote-Speakerin spricht Dr. Lela Grießbach, interkulturelle Strategie- und Organisationsberaterin mit eigener Migrationsgeschichte, über ihre Erfahrungen und Ansätze für diversitätssensible Führung. Ergänzend geplant ist ein kurzer Input zum Thema „Migrantische Frauen in Führungspositionen“.
Im anschließenden Panel teilen verschiedene Expertinnen ihre Erfahrungen und Perspektiven: Nadezhda Milanova, Landesmigrations- und Integrations-beauftragte, Freie Hansestadt Bremen, Dr. med. Zeynep Güner-Celebi, Oberärztin in der Transplantationschirurgie der Medizinischen Hochschule Hannover, sowie Fatime Cetinkaya, Geschäftsführerin der Cekaso GmbH.
An Thementischen besteht die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen, sich zu vernetzen, Ideen auszutauschen und Themen zu vertiefen. Zum Ausklang lädt das NeMiA-Team zu Kaffee & Kuchen ein – als Gelegenheit, die Diskussionen in entspannter Atmosphäre fortzusetzen und neue Kontakte zu knüpfen.
Bitte verbindlich per Mail anmelden: judith.frerking@aul-nds.de
-
18.11.2025
Im Rahmen des Projekts „Entschwörung lokal“ der Fachstelle für Politische Bildung und Entschwörung laden wir euch herzlich zu unserem Online-Fachtag ein um gemeinsam Antworten auf diese Herausforderungen zu entwickeln. Wir vermitteln Wissen über Verschwörungsideologie und Desinformation als Strategien gegen eine offene und solidarische Gesellschaft.
-
13.11.2025
Rechtspopulistische Akteur*innen und autoritäre Diskurse gewinnen in Europa zunehmend an Einfluss. Insbesondere seit der sogenannten Flüchtlingskrise werden Debatten über Flucht, Migration und den (vermeintlichen) Zusammenhang mit islamistischer Radikalisierung immer stärker polarisiert geführt.
Gleichzeitig führen die seit dem 7. Oktober 2023 verstärkten islamistischen Aktivitäten in Europa nicht nur zu einer veränderten realen Sicherheitslage, sondern erhöhen auch die wahrgenommene Bedrohung durch extremistische Kräfte. Diese Entwicklungen schüren antimuslimische Ressentiments, die mittlerweile auch in der sogenannten „Mitte der Gesellschaft“ Fuß fassen – ein Klima, das rechtspopulistische Akteur*innen gezielt nutzen, um ihre Unterstützerbasis auszubauen.
Die zunehmende Verbreitung antimuslimischer Diskurse und rechtspopulistischer Einstellungen hat weitreichende Auswirkungen: Sie beeinflusst die islamistische Szene und erschwert zugleich die Präventionsarbeit gegen islamistischen Extremismus. Denn fatale Wechselwirkungen entstehen, indem islamistische Akteur*innen steigenden antimuslimischen Rassismus aufgreifen, ihn in den ideologischen Kontext ihres eigenen Weltbildes einbetten und zur Mobilisierung ihrer Anhänger*innen instrumentalisieren.
Das stellt demokratische Gesellschaften – nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa – vor enorme Herausforderungen. Gemeinsam mit Ihnen möchten wir daher beim Forum RelEx am 12. und 13. November in Berlin den Blick über nationale Grenzen hinweg auf die europäische Präventionslandschaft richten, neue Perspektiven entdecken und Impulse für eine wirksame Präventionsarbeit entwickeln.
Streit/Förderung für Demokratie – Warum ist das sinnvoll und wie wird es gemacht?
Am Dienstag, 11. November 2025, lädt der Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen e.V. (VNB) zu einer Fortbildung im Hanns-Lilje-Haus in Hannover ein. Die Veranstaltung richtet sich an pädagogische Fachkräfte und Interessierte, die demokratische Streitkultur stärken möchten.
Im Fokus steht, wie konstruktives Streiten gelernt und vermittelt werden kann – als zentrale Kompetenz für eine lebendige Demokratie. Referent Dr. Christian Boeser (Universität Augsburg, Netzwerk Politische Bildung Bayern) vermittelt praxisnahe Strategien aus Kommunikations- und Verhandlungspsychologie, Fallanalysen und Übungen.
Die Teilnehmenden lernen, Gelassenheit im Umgang mit Differenzen zu fördern und klare Grenzen gegenüber Intoleranz und Demokratiefeindlichkeit zu ziehen.
Termin: 11. November 2025, 10:30–16:30 Uhr, Hanns-Lilje-Haus Hannover
Kosten: 20 € inkl. Verpflegung | Anmeldung bis: 4. November 2025 unter www.vnb-ev.de
Am 4. November 2025 lädt die Fachtagung „Der Proaktive Ansatz: Promising Practice in der Täterarbeit“ nach Berlin ein. Expert*innen aus Forschung und Praxis diskutieren opferorientierte Täterarbeit, gesetzliche Grundlagen des Gewaltschutzes sowie Best-Practice-Beispiele. Beiträge kommen u. a. von Prof. Dr. Thomas Görgen, Isabella Spiesberger, Ursula Groos und Samira Ciyow.
Am 4. November 2025 laden die VHS Kreis Offenbach, die DEXT-Fachstelle Pro Prävention Kreis Offenbach und Europe Direct Relais Rhein-Main zur Podiumsdiskussion „Demokratieförderung in Zeiten gesellschaftlicher Polarisierung“ ein.
Von 18:00 bis 21:00 Uhr im Haus des Lebenslangen Lernens (HLL) in Dreieich-Sprendlingen diskutieren Fachleute und zivilgesellschaftliche Akteur:innen über aktuelle Herausforderungen im Umgang mit extremistischen Bedrohungen und demokratiefeindlichen Entwicklungen.
Nach einem Impulsvortrag von Dr. Reiner Becker (Demokratiezentrum Hessen) sprechen Marion Altenburg (Omas gegen Rechts Dreieich), Dr. Barbara Gruber (Universität für Weiterbildung Krems) und Dr. Reiner Becker unter der Moderation von Nora Zado (Philips-Universität Marburg) über Erfahrungen und Perspektiven in der Demokratieförderung.
Oktober 2025
Gesellschaftliche und mediale Debatten sind zunehmend von Polarisierungen, Anfeindungen und demokratiefeindlichen Strömungen geprägt. Antifeminismus, Rassismus und Queerfeindlichkeit stellen dabei wachsende Herausforderungen für die Demokratie dar, indem sie gleichstellungspolitische Arbeit delegitimieren, Teilhabe beschränken und zentrale demokratische Strukturen schwächen.
Der Fachtag bietet eine Plattform, um diese Entwicklungen intersektional zu analysieren, Erfahrungen auszutauschen und gemeinsam Strategien für einen macht- und diskriminierungskritischen Umgang zu entwickeln. Fachvorträge und Workshops eröffnen Räume für Empowerment, diversitätssensible Organisationsentwicklung sowie für Ansätze, die Intersektionalität und Powersharing in den Mittelpunkt stellen. Ziel ist es, Frauen* in Verwaltung und Ehrenamt zu stärken und diskriminierungskritische Strukturen nachhaltig zu fördern.
Wann: Dienstag, 28. Oktober 2025, 09:30 – 16:00 Uhr
Wo: Freizeitheim Vahrenwald, Vahrenwalder Str. 92, 30165 Hannover
Für wen: Ehren- und hauptamtliche Amtsträgerinnen, Mitarbeiterinnen der öffentlichen Verwaltung, Gleichstellungsbeauftragte, Personen aus Migrant*innen-Selbstorganisationen sowie Interessierte, die ihre Arbeit um macht- und diskriminierungskritische Perspektiven erweitern möchten.
Workshops:
- Antifeminismus und Queerfeindlichkeit – Amelie Henze
- Empowerment-Workshop für BIPoC – Zeliha Özdemir
- Diversitätssensible Organisationsentwicklung – Hannah Lutat
- Solidarisch und intersektional: Powersharing in der Praxis – Franciska R. Petsch
Die Teilnahme ist kostenfrei.
Bei Fragen wenden Sie sich an: sandrine.witolla@vnb.de
-
30.10.2025
-
25.10.2025
Die Stiftung Forum Recht bietet mit der mehrtägigen Studienreise zum Thema „Rechtsstaat in Deutschland“ ein neues Fortbildungsformat für Multiplikator:innen an. Vom 19. bis 25. Oktober 2025 vermittelt ein dichtes Bildungsprogramm, das aus dem Besuch von Einrichtungen vor Ort, Fachvorträgen und Austauschformaten besteht, vielschichtige Informationen und ermöglicht praxisnahe Einblicke in das Themengebiet.
Das exklusive Programm der siebentägigen Reise führt in vier Städte. Die Reise startet am Stiftungsstandort Karlsruhe – der „Residenz des Rechts“ – mit Besuchen am Bundesverfassungsgericht, dem Bundesgerichtshof und der Bundesanwaltschaft. Weiter geht es nach Nürnberg (Themenschwerpunkt u.a. Nürnberger Prozesse), dann zum Stiftungsstandort Leipzig (Themenschwerpunkt (Un-)Recht und Engagement in deutscher Geschichte und Gegenwart) und schließlich nach Berlin (Themenschwerpunkt Bundesinstitutionen und Zivilgesellschaft).
Anmeldeschluss ist der 14. August.
-
19.10.2025
Der Berliner Präventionstag 2025 widmet sich dem Thema digitaler Gewalt. Im Fokus stehen Ursachen, Dynamiken und innovative Ansätze der Prävention. Fachkräfte aus Wissenschaft, Zivilgesellschaft, Verwaltung und Sicherheitsbehörden diskutieren in Vorträgen, Workshops und Panels über Wege, Hass, Hetze und Radikalisierung im Netz wirksam zu begegnen.
Seit 2015 unterstützt die Fachstelle Extremismusdistanzierung Baden-Württemberg Fachkräfte der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit sowie zivilgesellschaftliche Träger im Umgang mit Radikalisierungsprozessen. Ob in der pädagogischen Praxis, der Beratung von Kommunen oder der strategischen Weiterentwicklung von Präventionsstrukturen – wir setzen uns tagtäglich für Demokratie, gesellschaftlichen Zusammenhalt und eine klare Distanzierung gegenüber menschenfeindlichen Ideologien ein.
In diesen zehn Jahren haben wir gemeinsam mit vielen Partner:innen ein landesweites Netzwerk aufgebaut, innovative Formate der politischen Bildung entwickelt und uns als Impulsgeberin in der Extremismusprävention etabliert. Dabei verbinden wir professionelle Distanzierungsarbeit mit wissenschaftlicher Fundierung, Praxistransfer und einem klaren werteorientierten Kompass.
Anlässlich unseres zehnjährigen Bestehens laden wir Sie herzlich ein, diesen Weg mit uns zu würdigen – bei einer kompakten Abendveranstaltung mit hochkarätigen Gästen aus Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, musikalischem Rahmenprogramm und Zeit für persönlichen Austausch.
Mit der Umsetzung der Europäischen Asylreform (GEAS) plant das Bundeskabinett u. a. Sekundärmigrationszentren, Ausreisezentren sowie Einschränkungen bei Rechtsbeistand und Leistungen. Kritiker*innen warnen vor Grundrechtseingriffen und verpassten menschenrechtlichen Spielräumen.
Die Veranstaltung diskutiert, ob Freiheitsentzug ein legitimes Mittel ist und welche Alternativen es gibt, im Kontext der Verleihung des Menschenrechtspreises der Friedrich-Ebert-Stiftung 2025 an die International Detention Coalition.
Das Interdisziplinäre Zentrum für Radikalisierungsprävention und Demokratieförderung e.V. (IZRD e.V.) lädt im Rahmen des Projekts "Stark in Therapie und Weltanschauungsfragen", gefördert von der Bundeszentrale für politische Bildung, herzlich zur neuen vierteiligen Fachvortragsreihe "Gesellschaftliche Verunsicherung und dysfunktionale Bewältigungsstrategien als Thema in der Psychotherapie" ein.
Die Reihe startet am 15. Oktober 2025 und findet jeweils mittwochs von 18 bis 20 Uhr online statt.
Ziele:
- Vermittlung fundierter Kenntnisse über gesellschaftliche Verunsicherungsprozesse, psychologische Wirkmechanismen, Radikalisierungsdynamiken und Interventionen zur Deradikalisierung
- Stärkung der Handlungskompetenz im Umgang mit dysfunktionalen weltanschaulichen Orientierungen, Narrativen und Feindbildern.
- Förderung von Resilienzaufbau im therapeutischen Kontext.
- Sensibilisierung für Dimensionen einer rassismuskritischen Psychotherapie vor dem Hintergrund rassistischer und antisemitischer Feindbilder sowie der Betroffenheit von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit.
Die Vortragsreihe richtet sich insbesondere an approbierte Psychotherapeut*innen aber auch andere berufsnahe Fachkräfte und möchte ihnen praxisnahes Wissen an die Hand geben, um diese Dynamiken frühzeitig zu erkennen, professionell zu bearbeiten und resilienzstärkende Ansätze gezielt zu fördern.
Alle Informationen zu den Vorträgen und Anmeldung finden sie hier.
Vortrag: Das sterben der Demokratie
Rechtspopulismus verändert die Gesellschaft – oft unbemerkt, aber mit tiefgreifenden Folgen. Was passiert, wenn Parlamente entmachtet, Gerichte geschwächt und Medien unter Druck gesetzt werden? Und warum ist gerade die schleichende Aushöhlung demokratischer Werte so gefährlich?
Prof. Dr. Peter R. Neumann, Politikwissenschaftler und Extremismusforscher, analysiert in seinem Vortrag rechtspopulistische Bewegungen in westlichen Demokratien. Er zeigt, mit welchen Strategien sie Institutionen unterwandern und was dies für unsere Gesellschaft bedeutet. Im Anschluss sind das Publikum und die Moderation von Dr. Hazim Fouad zur Diskussion eingeladen.
Lesetipp: Richard C. Schneider & Peter R. Neumann: Das Sterben der Demokratie. Der Plan der Rechtspopulisten – in Europa und den USA, Rowohlt, 2025.
Die Demokratie steht zunehmend unter Druck – autoritäre und antidemokratische Akteur*innen versuchen, Institutionen und Prozesse zu schwächen. Doch wie lassen sich diese Angriffe abwehren? Und was braucht es, um demokratische Strukturen zu stärken?
Diesen Fragen widmet sich die 5. Demokratiekonferenz Oldenburg. In Workshops am Nachmittag werden konkrete Handlungsmöglichkeiten in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen – von Zivilgesellschaft über Verwaltung bis Justiz – erarbeitet. Ab 18 Uhr spricht Journalist und Autor Arne Semsrott in seinem Vortrag „Demokratie schützen – Worauf kommt es an?“ über aktuelle Herausforderungen und Perspektiven.
Die Konferenz ist Teil der Partnerschaften für Demokratie Oldenburg und wird vom Präventionsrat Oldenburg sowie dem Amt für Zuwanderung und Integration getragen.
Die Krisen der letzten Jahre – von Pandemie über Klimakatastrophen bis zu Kriegen – haben auch das Vertrauen in die Demokratie erschüttert. Gemeinsam soll der weltweite Zustand der Demokratien beleuchtet, aktuelle Trends analysiert und Strategien gegen demokratiefeindliche Strömungen diskutiert werden. Einblicke aus dem internationalen FES-Netzwerk zeigen zudem positive Entwicklungen, die Mut machen und zum Lernen einladen.
-
09.12.2025
Die zweiteilige Fortbildung „Starke Begleitung statt Ohnmacht – Traumasensible Unterstützung nach diskriminierenden Polizeikontakten und Polizeiarbeit“ mit Eben Louw (Fachberater für Psychotraumatologie) richtet sich an Fachkräfte, die Betroffene nach belastenden Erfahrungen professionell begleiten möchten.
Im ersten Modul (15.10.2025, online) stehen strukturelle Diskriminierung und Viktimisierungsprozesse im Fokus.
Das zweite Modul (17.10.2025, Mannheim) vermittelt praxisnahes Wissen zu Traumafolgen, Stabilisierung und Ressourcenaktivierung.
Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung bis zum 12.10.2025 unter info@adb-mannheim.de
Diskussionsabend: Tradwives – eine antifeministische Neuauflage tradierter Frauenbilder im Netz?!
Im Rahmen der sozialpolitischen Reihe des Frauenzentrum Laatzen
Tradwives – „traditionelle Ehefrauen“ – inszenieren sich in sozialen Medien als perfekte Hausfrauen im Vintage-Look. Zwischen Sauerteigbrot, Familienidylle und klarer Rollenverteilung stellt sich die Frage: Handelt es sich um eine selbstbestimmte Lebensweise oder um einen gefährlichen Rückschritt in tradierte Frauenbilder?
Katharina Perlbach und Lynn Benda beleuchten das Phänomen aus historischer, soziologischer und feministischer Perspektive. Sie analysieren die Tradwife-Bewegung auf Plattformen wie TikTok und Instagram, ordnen sie politisch ein und fragen, welche gesellschaftlichen Sehnsüchte dahinterstehen. Im Anschluss sind Diskussion und Austausch erwünscht.
-
08.10.2025
Soziale Arbeit hat den Auftrag, sich aktiv in gesellschaftliche Entwicklungen einzumischen, soziale Ungleichheiten sichtbar zu machen und sich für die Rechte und Teilhabe benachteiligter Gruppen einzusetzen. Gerade in Zeiten zunehmender rechtlicher Restriktionen, strukturellem Abbau von Unterstützungsangeboten und wachsendem politischem Druck ist eine kritische, menschenrechtsorientierte Soziale Arbeit gefordert.
Diese Tagung lädt dazu ein, gemeinsam zu analysieren, wie sich die aktuellen politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen auf junge geflüchtete Menschen auswirken und welche Handlungsoptionen die Soziale Arbeit im Rahmen ihres Einmischungsauftrags hat. In Vorträgen, Workshops und Diskussionsrunden werden wir erarbeiten, wie solidarische, widerständige und emanzipatorische Ansätze weiterentwickelt und praktisch umgesetzt werden können.
September 2025
Die Hannah Arendt Tage widmen sich 2025 dem Spannungsverhältnis von Macht und Gewalt – inspiriert von Arendts gleichnamiger Studie. Angesichts wachsender Herausforderungen wie Populismus, Fake News und politischer Einflussnahme diskutieren verschiedene Formate die Folgen aus der Balance geratener Macht.
Den Auftakt bildet am 30. September 2025 ein Seminar an der Leibniz Universität Hannover („Die Macht der Kommunikation versus die Stummheit der Gewalt“). Dozentin Dr. Diana Häs beleuchtet Arendts Verständnis von Kommunikation als Grundlage politischer Macht im Kontrast zur „stummen“ Gewalt.
Die Teilnahme ist kostenfrei, Anmeldung erforderlich: info@ghs.uni-hannover.de
Digitale Gewalt: Informationsveranstaltung am 24. September 2025 in Hannover
Bildbasierte sexualisierte Übergriffe im Netz nehmen zu und stellen Fachkräfte vor neue Herausforderungen. Die Koordinierungsstelle des Landesprogramms für Demokratie und Menschenrechte bietet in Kooperation mit HateAid eine kostenfreie Präsenzveranstaltung an. Themen sind Formen digitaler Gewalt, professionelle Handlungsmöglichkeiten und Schutz besonders vulnerabler Personen. Eingeladen sind Fachkräfte aus Beratung, Bildung, Sozialer Arbeit, Verwaltung und Politik. Anmeldeschluss: 16. August 2025 (begrenzte Plätze, Reihenfolge des Eingangs).
Im Rahmen des Projektes „SENSA – Sensibilisierung zu besonderen Schutzbedarfen von asylsuchenden Menschen in Sachsen-Anhalt und Thüringen“ bietet die Qualifizierungsreihe „Einführung Asylverfahren“ in zwei Online-Modulen einen Überblick über 1) den Ablauf des Asylverfahrens und das materielle Flüchtlingsrecht (Schutzformen) und 2) die Anhörung im Asylverfahren. Die Teilnehmenden bekommen einen umfassenden Einblick in die Grundlagen für die alltägliche Beratungspraxis unter besonderer Berücksichtigung von besonderen Schutzbedarfen im Asylverfahren (z.B. LGBTIQ*-Personen, Personen mit Traumata, Personen mit Behinderung).
Die Qualifizierungsreihe ist eine Grundlagenfortbildung und wird innerhalb des Projektzeitraumes bis 2026 viermal wiederholt. Sie richtet sich insbesondere an Mitarbeitende aus der Flüchtlingssozialarbeit und Asylverfahrensberatung, als auch an Mitarbeitende aus Regelstrukturen, welche in ihrer täglichen Praxis Kontakt mit Menschen im Asylverfahren haben. Eine konsekutive Teilnahme an beiden Fortbildungsteilen der Qualifizierungsreihe ist erstrebenswert.
-
23.09.2025
Die 9. Speyerer Migrationsrechtstage widmen sich den Folgen der Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS), die bis 2026 in nationales Recht umgesetzt werden muss. Im Fokus stehen die Auswirkungen auf Verfahren, Zuständigkeiten und Registrierungspflichten.
Besonderes Augenmerk gilt den neuen Aufnahmebedingungen für Schutzsuchende, etwa bei Unterbringung und Beschulung. Auch die Bedeutung der Reform für Verwaltungspraxis in Bund, Ländern und Kommunen wird beleuchtet.
-
28.09.2025
Dieses Seminar richtet sich an weiß positionierte Fach- und Honorarkräfte aus Pädagogik, Sozial- und Bildungsarbeit, die sich bereits mit Rassismus und dem eigenen Weißsein auseinandergesetzt haben. Gemeinsam reflektieren wir herausfordernde Situationen aus dem (Arbeits-)Alltag, entwickeln Handlungsmöglichkeiten und stärken eine rassismuskritische Haltung. Mit Methoden aus politischer Bildungsarbeit, kollegialer Beratung und Coaching bieten wir Raum für Austausch, Selbstreflexion und praktische Strategien.
Kosten: 300 € inkl. Übernachtung im DZ & Verpflegung (Ermäßigung möglich, z. B. über Bildungsprämie/Bremer Weiterbildungsscheck).
Kontakt: Samuel Njiki Njiki – Tel. (0421) 69 272-22, Mail ans LidiceHaus.
Am 19. September findet der bundesweite Aktionstag „Tag der Zivilcourage“ statt. Ziel ist es, Menschen zu ermutigen, sich öffentlich gegen Diskriminierung, Gewalt und Rassismus einzusetzen und demokratische Werte zu stärken. Initiativen, Kommunen, Vereine und Einzelpersonen sind eingeladen, ihre Aktionen zu melden und sichtbar zu machen.
Kinder und Jugendliche, die in Unterkünften für geflüchtete Menschen leben, haben dieselben Rechte, wie nicht geflüchtete Kinder. Die Kinderrechte sollten dazu genutzt werden, um eine angemessene Unterbringungsqualität für Eltern und Kinder sicherzustellen bzw. zu verbessern. Doch wie lassen sich das Recht auf Schutz, Partizipation oder eine kindgerechte Umgebung in der Praxis umsetzen? Der digitale Fachtag bietet zuständigen Behörden, Betreibern, Einrichtungsleitungen und Fachkräften Gelegenheit, praxisnahe Beispiele/Ansätze zur Verbesserung der Unterbringung kennenzulernen, Erfahrungen auszutauschen und gemeinsam Lösungsansätze zu entwickeln.
Rechtspopulistische Influencer und Parteien verbreiten über Social-Media-Plattformen wie TikTok und Instagram Hass, Fake News und Verschwörungstheorien. Insbesondere deren Reichweite unter jüngeren Menschen ist in den letzten Jahren erschreckend gestiegen. Doch was kann ich gegen menschenfeindliche Abwertungen im Netz tun?
Zu dieser Frage lädt die Akademie Waldschlösschen in Kooperation mit dem Bundesverband Lambda zu einem Social-Media-Workshop ein. Im Mittelpunkt stehen die Inhalte und Strategien rechtsextremer und -populistischer Influencer sowie deren Einfluss auf die Gesellschaft. Der Workshop bietet die Möglichkeit, Ansätze für den Umgang mit Hass und Fakenews in sozialen Medien zu entwickeln. Zudem werden Strategien erarbeitet, um die Reichweite eigener (queerer) Inhalte auf Social Media zu steigern. Das Wochenende bietet Raum für queeren Austausch und Vernetzung in der herbstlich-gemütlichen Atmosphäre der Akademie.
Der Workshop richtet sich an schwule, lesbische, bisexuelle, asexuelle, queere, trans* und inter* Menschen bis einschließlich 27 Jahre. Erfahrung in der Kampagnenarbeit und Produktion eigener Inhalte auf Social Media ist willkommen, jedoch keine Voraussetzung. Auch Neueinsteiger*innen und Interessierte sind herzlich eingeladen.
Internationale Pflegekräfte erleben im Berufsalltag immer wieder Rassismus und Diskriminierung – dies belegen unter anderem Studien der Bundeszentrale für politische Bildung. Angesichts des Fachkräftemangels in der Pflege ist die nachhaltige Integration und Wertschätzung dieser Mitarbeitenden für Ihre Einrichtung von entscheidender Bedeutung. Diskriminierende Erfahrungen können dazu führen, dass Fachkräfte den Beruf oder sogar Deutschland verlassen – mit spürbaren Auswirkungen auf die Versorgungssituation.
In einem Präsenzworkshop am 11.09.2025 erhalten Sie einen kompakten Überblick über rechtliche Grundlagen, institutionelle Verantwortung und konkrete Maßnahmen für ein diskriminierungssensibles Arbeitsumfeld. Sie erarbeiten praxistaugliche Strategien sowie eine Musterbetriebsvereinbarung und tauschen sich mit Expertinnen und Experten aus dem Gesundheitswesen über Lösungsansätze für den Umgang mit Rassismus und Diskriminierung aus.
Der Praxis-Fachtag in Kooperation mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband Niedersachsen e.V. widmet sich den besonderen Anforderungen in der Arbeit mit unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten. Ziel ist es, Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe durch Wissensvermittlung, Austausch und Reflexion zu stärken und sie in ihrer pädagogischen Arbeit zu unterstützen.
Eine Online-Fortbildung thematisiert, wie extremistische Akteur*innen Social Media nutzen, um Narrative zu verankern, Ängste aufzugreifen und genderspezifische Aspekte einzubeziehen. Meike Krämer und Luis Kreisel (Violence Prevention Network, Projekt „dist[ex]“) geben Einblicke in aktuelle Monitoring-Erkenntnisse und diskutieren Herausforderungen für Präventions- und Distanzierungsarbeit.
-
09.09.2025
ProPeace lädt ein: Die 10. IKFT-Tagung beleuchtet zentrale Herausforderungen kommunaler Akteure im Umgang mit Migration, gesellschaftlicher Polarisierung und internationalen Konflikten. Im Fokus: Ihre praktischen Erfahrungen und der Austausch über Lösungen. Neben moderierten Erfahrungswerkstätten gibt es Einblicke in wissenschaftliche Perspektiven, z. B. von ConflictA Bielefeld. Jetzt vernetzen, reflektieren und Impulse sammeln!
Referent: Prof. Dr. Vincent Knopp, Professor für Soziale Arbeit an der International University (IU), mit den Schwerpunkten Wandel des Kapitalismus, soziale Ungleichheit und Rechtsaußenspektrum.
Die demokratisch engagierte Zivilgesellschaft ist gegenwärtig mit enormen Herausforderungen konfrontiert: Rechtsautoritäre Kräfte gewinnen an Einfluss, gesellschaftliche Polarisierung nimmt zu, Ressourcen schwinden, Handlungsspielräume verengen sich. Nicht nur auf politischer Bühne, auch im Alltag geraten engagierte Menschen und Initiativen unter Druck – finanziell, diskursiv und zunehmend auch physisch. Vor diesem Hintergrund widmet sich die Konferenz Kompetenzen der Widerständigkeit dem demokratischen Engagement in Zeiten zunehmender Spaltung und antidemokratischer Radikalisierung.
In Vorträgen und Panels diskutieren Expert*innen aus Wissenschaft und Praxis die politischen und sozialen Verschiebungen nach den jüngsten Wahlen – mit besonderem Augenmerk auf ostdeutsche Realitäten wie auch auf bundesweite Trends. Wir fragen nach den Bedingungen demokratischer Resilienz und beleuchten die Herausforderungen, denen sich eine plurale Zivilgesellschaft angesichts rechter Raumnahme und politischen Angriffen gegenübersieht.
-
04.12.2025
Antifeminismus ist in sozialen Medien, Alltagskultur und extremistischen Ideologien weit verbreitet und stellt Pädagog*innen vor neue Herausforderungen. Die vierteilige Webtalkreihe von ufuq.de beleuchtet antifeministische Narrative, ihre Attraktivität für Jugendliche sowie Anschlussstellen an patriarchale Milieus, Popkultur und religiöse Argumentationen. Im Fokus stehen Fragen wie: Welche Rollenbilder und Identitätsangebote stecken hinter diesen Narrativen? Wie können Fachkräfte handlungsfähig bleiben, ohne zu verharmlosen oder zu stigmatisieren?
Von September bis Dezember 2025 findet jeweils am ersten Donnerstag im Monat ein Webtalk via Zoom statt. Themen sind u. a. Misogynie als Motor extremistischer Gewalt (mit Prof. Cynthia Miller-Idriss), religiös begründeter Antifeminismus (mit Mehmet Koç) sowie der Umgang mit antifeministischen Positionen in sexueller Bildung und gendersensibler Jungen*arbeit. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist erforderlich.
Die Fortbildung vermittelt Grundlagenwissen zu traumatischen Ereignissen und Traumafolgestörungen bei geflüchteten Menschen sowie zum Thema „Sexualisierte Gewalt gegen geflüchtete Mädchen* und Frauen*“. Ziel ist es, das Schweigen über diese Erfahrungen zu durchbrechen und Handlungssicherheit in Beratung und Begleitung zu stärken.
Das Angebot richtet sich vor allem an haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter:innen in Gemeinschaftsunterkünften, Erstaufnahmeeinrichtungen sowie in kommunalen und Landesbehörden. Durchgeführt wird die Fortbildung in Kooperation mit dem Netzwerk für traumatisierte Flüchtlinge in Niedersachsen gGmbH.
August 2025
Rechtsextreme Angriffe auf demokratische Initiativen in Hannover nehmen zu und bedrohen die Zivilgesellschaft. Um dem entgegenzuwirken, lädt eine Veranstaltung am 27.08.2025 zum Austausch von Engagierten aus Zivilgesellschaft, Politik, Verwaltung und Polizei ein. Ziel ist die Entwicklung eines Schutzkonzepts gegen rechtsextreme Bedrohungen. Teilnahme kostenfrei, Anmeldung erforderlich.
-
10.09.2025
Internationale Pflegeteams bereichern den Pflegealltag durch Vielfalt an Kulturen, Sprachen und Arbeitsweisen. Gleichzeitig entstehen dadurch besondere Herausforderungen: Unterschiedliche Werte, Kommunikationsstile und Erwartungen können leicht zu Missverständnissen und Konflikten führen – vor allem für Sie als Führungskraft. Studien zeigen, dass für Konfliktlösungen häufig mehrere Stunden pro Woche aufgewendet werden müssen – Zeit, die an anderer Stelle fehlt.
In einem Präsenzworkshop zum interkulturellen Konfliktmanagement erhalten Sie praxisnahe Methoden und konkrete Handlungsmöglichkeiten, um interkulturelle Missverständnisse frühzeitig zu erkennen, den eigenen Konflikttyp zu reflektieren und schwierige Gesprächssituationen sicher zu meistern. Anhand von Fallbeispielen, Rollenspielen und Übungen entwickeln Sie individuelle Lösungsansätze für den Umgang mit Konflikten im Pflegealltag.
Im Rahmen der bundesweiten Projektarbeit bieten Mitglieder des Projekts nexus – Psychotherapeutisch-Psychiatrisches Beratungsnetzwerk spezialisierte psychologische, psychotherapeutische und psychiatrische Fallhilfen an, die Beratungsfachkräfte bedarfsorientiert in ihrer Arbeit unterstützen können. Neben der Möglichkeit der Einzelfallberatung findet ab sofort eine Fachkräfte-Sprechstunde in einem Online-Format statt. Sie ist niedrigschwellig und kann punktuell besucht werden.
Dieses Format bietet den Teilnehmenden die Möglichkeit,
- Fälle anonymisiert vorzustellen,
- konkrete Fragestellungen zu erörtern und Fachfragen aus dem Bereich psychische Gesundheit zu stellen,
- gemeinsam Lösungen zu erarbeiten,
- den Raum für inhaltliche Diskussion, Reflexion und der Beantwortung von Fachfragen zu nutzen,
- Unterstützung im Umgang mit Herausforderungen oder Belastungen zu erhalten, die im beruflichen Kontext auftreten können.
- eine weitere Perspektive für Ihre Arbeit im Bereich der Distanzierungs- und Ausstiegsbegleitung gemeinsam zu entwickeln.
Die Sprechstunde wird von einer psychologischen Psychotherapeutin i.A. und einem Assistenzarzt für Psychiatrie und Psychotherapie moderiert.
Zielgruppe:
Für Fachkräfte von Präventions- und Beratungsstellen der Extremismusprävention, insbesondere aus den Phänomenbereichen Islamismus und Rechtsextremismus.
Anmeldung:
Wenn Sie Interesse an einer Teilnahme haben oder Fragen klären möchten, können Sie sich gerne unter nexus-fachstelle@charite.de melden. Sie erhalten den Zugangslink per Email nach formloser Anmeldung. Die Teilnahme bzw. die Beratungen sind kostenfrei.
Veranstalter:
nexus – Psychotherapeutisch-psychiatrisches Beratungsnetzwerk
Termine:
Nach kurzer Sommerpause wieder alle zwei Wochen ab Montag, 11. August (ungerade Wochen), 18:30–20:00 Uhr, online über MS Teams
Ort:
Online
Klassismus, also die Diskriminierung aufgrund der Klassenherkunft- oder zugehörigkeit ist eine meist unsichtbare Diskriminierungsform. Sie zeigt sich in Vorurteilen, Stereotypen und Benachteiligungen, die Menschen aufgrund ihrer sozialen Position oder ihres sozialen Status erfahren. Hierbei geht es neben Fragen zu Vermögen und Einkommen auch um den Bildungshintergrund, die Wohnsituation und den sozialen Kontext, in dem Menschen aufwachsen. Betroffen sind häufig arme, erwerbslose oder wohnungslose Menschen, sowie Arbeiter*innen und deren Kinder.
Klassismus ist oft nur schwer zu erkennen, da er sich nicht immer offen zeigt und häufig mit anderen Diskriminierungsformen wie Rassismus oder Sexismus verflochten ist. Außerdem gibt es Hürden in der klassismuskritischen Auseinandersetzung, da Betroffenen oft vermittelt wird, dass der Grund für ihre Situation in ihrem eigenen Versagen liegt und die Thematisierung von erlebtem Klassismus ihnen Nachteile bringt. Umso wichtiger ist es diese Diskriminierungsform stärker in den Blick zu nehmen und ihre Funktionsweise zu verstehen. Insbesondere, weil diese Form der Ungleichheit bestimmte Gruppen der Gesellschaft an der gleichberechtigten Teilhabe an dieser hindert. Um Klassismus entgegentreten zu können, müssen wir diesen also stärker thematisieren und sichtbar machen.
Vor diesem Hintergrund möchten wir uns in diesem Online-Vernetzungstreffen gemeinsam zum Thema Klassismus austauschen und uns folgende Fragen stellen: Welches Verständnis haben wir von Klassismus und dessen Auswirkungen? Wie können wir Klassismus in der politischen Bildung, aber auch in anderen Praxisfeldern abbauen? Was könnten demnach Ideen für eine klassismuskritische Praxis sein?
Juni 2025
Städte, Gemeinden und Landkreise sind mit einer Vielzahl an Konflikten konfrontiert. So wirken sich Krisen und gesellschaftliche Spannungsfelder häufig direkt vor Ort aus. Hinzu kommen lokale und regionale Herausforderungen und konflikthafte Auseinandersetzungen, etwa um Veränderungsprozesse in Stadtgesellschaften oder im sozialen Nahraum. Der Fokus unserer Qualifizierung liegt daher auf sozialen Konflikten, die öffentlich ausgetragen werden. Dies können z.B. Konflikte zum Umgang mit Vielfalt, demokratiefeindlichen Akteur:innen, um Identitäts- und Zugehörigkeitsfragen oder auch Nutzungskonflikte sein.
Die Qualifizierungsreihe
- vermittelt grundlegendes Handwerkszeug für die Demokratische Konfliktbearbeitung,
- stärkt Kompetenzen, um Konflikte im kommunalen Raum zu erkennen und systemische Zusammenhänge zu analysieren, und
- erweitert das Methodenrepertoire für den strategischen Umgang mit kommunalen Konflikten.
Zielgruppe
- Mitarbeitende aus der kommunalen Verwaltung,
- Zivilgesellschaftliche Akteure aus den Bereichen der Demokratieförderung / Integration / Gemeinwesenarbeit und
- Multiplikator:innen, die in ihrer Tätigkeit mit kommunalen Konflikten konfrontiert sind.
Die mehrtägige Qualifizierung findet als reine Online-Veranstaltung (Gruppe 1) sowie als Online- und Präsenzveranstaltung in Berlin (Gruppe 2) von Juni bis November 2025 statt. Die Teilnahme ist kostenfrei.
Anmeldungen sind über diesen Link bis Ende Mai möglich.
-
27.06.2025
Die Jugend(sozial)arbeit steht unter Druck: Immer jüngere Heranwachsende vertreten lautstark menschenverachtende und demokratiefeindliche Haltungen. Auch das Gewaltpotenzial steigt bei Jugendlichen wieder und es sind wieder mehr jugendkulturelle rechtsextreme Gruppierungen zu sehen. Die Frage, wie Kinder und Jugendliche in demokratischen und menschenrechtlichen Haltungen gestärkt werden können, wird immer herausfordernder. Dabei fehlt es der Jugend(sozial)arbeit auch immer wieder an der nötigen Unterstützung durch lokale Akteure und kommunale Strukturen. Mehr denn je gilt es, fachliche Kompetenzen, Netzwerke und Unterstützungsstrukturen zu bündeln und Dynamiken entgegenzutreten, die letztlich auf eine Schwächung von Demokratie und
Menschenrechten abzielen.
In dieser Praxiswerkstatt geht es darum, sich zu den konkreten Problematiken im Arbeitsfeld auszutauschen und gemeinsam praxisorientierte Lösungswege für die jeweiligen Herausforderungen zu entwickeln.
Das GMK hat vier Referent*innen, die jeweils einen Kurzinput geben werden. Im Anschluss an die Kurzinputs wird die Möglichkeit geboten, sich in Breakout Sessions zu unterschiedlichen Arbeitsfeldern auszutauschen und Vorschläge für eine strukturelle Implementierung von Digitalisierung und inklusiver Medienbildung zu sammeln. Der Fachtag wir über Zoom stattfinden.
Es wird vier themenspezifische Kurzinputs von Dr. Nadine Hüning (vediso), Dr. Claudia Mertens (Uni Bielefeld), Jakob Sponholz (Uni Köln) und Dr. Christine Ketzer (LAG Lokale Medienarbeit) geben. Darüber hinaus wird es ausreichend Zeit für den Austausch und der Arbeit in Breakout Sessions geben.
Auf Social-Media-Plattformen und in Messenger-Apps zählt das junge Rechtsaußenspektrum zu den Gewinnern im Kampf um Klicks, Reichweite und Aufmerksamkeit. Eine selbst ernannte Mosaik-Rechte strebt als Teil eines modernisierten Rechtsextremismus nach der Herrschaft über Deutungen, Definitionen und Diskurse. Eine zentrale Rolle spielen weibliche Aktivistinnen, die als Influencerinnen extrem rechte Ideologie zielgruppengerecht bewerben. Welche Strategien setzen sie in ihrer Social-Media-Kommunikation ein? Wen wollen sie erreichen - und wie genau? In diesem interaktiven Online-Workshop wird versucht, gemeinsam Antworten auf diese Fragen zu finden.
Machtvolle Gruppen werten weniger machtvolle Gruppen durch Fremdzuschreibungen ab und sprechen ihnen damit auch die Zugehörigkeit zur eigenen Gruppe und zu gewissen Grundrechten ab. Durch die Abwertung der „Anderen“ fällt gleichzeitig die Selbstbewertung der eigenen Gruppe positiv aus.
Aber wie entstehen eigentlich die abwertenden Bilder und Geschichten über die "Anderen", die sich dann in unseren Köpfen festsetzen? Und welche Rolle spielen hierbei gesellschaftliche Machtverhältnisse und unsere eigene Position darin?
In dieser Fortbildung wollen wir uns gemeinsam mit dem Phänomen und den Wirkungsweisen von Andersmachung auseinandersetzen. Ziel ist hierbei die kritische Reflexion der eigenen Denk- und Verhaltensmuster, um Othering entgegenzuwirken.
-
24.06.2025
Der 30. Deutsche Präventionstag findet am 23./24. Juni 2025 in Augsburg statt. Er steht unter dem Schwerpunktthema „Prävention und gesellschaftlicher Frieden“.
Die Schirmherrschaft haben der Bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder und die Augsburger Oberbürgermeisterin Eva Weber übernommen. Austragungsort ist die Messe Augsburg. Die Stadt Augsburg bietet bereits ab dem 21. Juni 2025 ein umfangreiches Rahmenprogramm an.
Immer häufiger setzen mächtige Akteur*innen sogenannte SLAPP-Klagen ein, um kritische Berichterstattung zu unterdrücken – oft mit absurden Forderungen und hohem Druck. Wie gefährdet ist die Pressefreiheit? Was hilft den Betroffenen?
Darüber sprechen am 19. Juni 2025 um 20 Uhr auf Zoom der freie Journalist Emran Feroz und die Juristin Hannah Vos (FragDenStaat). Moderation: Jana Pareigis und Mohamed Amjahid.
Neben Inputs gibt es Raum für Austausch und Beratung. Anmeldung bis 14.06.2025 hier.
Im Mittelpunkt der Fachtagung "WÜRDE! – Migrantinnen gestalten Zukunft und Teilhabe am Arbeitsmarkt" steht neben der großformatigen Ausstellung „WÜRDE!“ mit eindrucksvollen Porträts von Frauen mit Migrationsbiografie ein vielfältiges Programm mit Fachimpulsen, einer Panel-Diskussion sowie einer Gesprächsrunde mit Beteiligten aus Praxis und Politik. Die Ausstellung umfasst Exponate im Format 4 x 3 Meter und macht migrantische Perspektiven rund um Arbeit und Würde sichtbar.
Programm-Highlights:
- Grußwort des Niedersächsischen Ministerpräsidenten Olaf Lies
- Fachimpulse von Prof. Dr. Seda Rass-Turgut und Dr. Jens Lehmann
- Panel-Diskussion „Arbeitsmarktintegration und Würde – Perspektiven und Lösungsansätze“ mit Vertreter*innen aus Politik, Wissenschaft und Praxis
- Spoken Word & Gesprächsrunde mit Porträtierten
- Ausstellung & Vernetzung bei Kaffee und Kuchen
- Moderation: Cosima Schmitt (Autorin & ZEIT-Journalistin)
Einladung zum „Kurz und Knapp“-Input „Evaluiert – und dann?“
Die Bundesinfrastruktur dist[ex] und PrEval laden am 17. Juni 2025 von 10–13 Uhr zum ersten Qualitätszirkel ein. Unter dem Titel „Evaluiert – und dann?“ berichten das API NRW und eine externe Evaluatorin praxisnah über ihren Evaluationsprozess. Im Fokus: Umsetzung, Herausforderungen und Austausch zur Weiterentwicklung der Evaluationspraxis.
Eine Anmeldung ist bis zum 12. Juni 2025 möglich: https://eveeno.com/qualitaetszirkel-evaluiert-und-dann
In dem interaktiven Workshop setzen sich die Teilnehmenden mit Rassismus als gesundheitliches Risiko und der Frage auseinander: Wie wird die Gesundheit von Betroffenen beeinflusst?
Es geht zudem um Barrieren im Zugang zu Gesundheitsdiensten für Migranten und Migrantinnen und People of Color: Welche Rechte stehen von Diskriminierung Betroffenen zu?
Es geht auch um Anlaufstellen und Unterstützung, um Handlungsstrategien für mehr Selbstsicherheit zu bekommen.
Krisen verändern Gesellschaften. Sie sind ein Offenbarungseid: Sie entlarven politische Prioritäten und machen sichtbar, wessen Rechte geschützt werden – und wessen nicht. Sie verschieben, was selbstverständlich schien, und stellen alte Fragen neu: Wer trägt Verantwortung? Wo entstehen Brüche? Mit wem sind wir solidarisch – und mit wem nicht? Und wie können wir Zusammenhalt verteidigen und neu begründen?
In unserer Diskussion fragen wir gemeinsam mit unseren Gästen, wie sich gesellschaftlicher Zusammenhalt unter Druck verändert, welche sozialen und politischen Kräfte Resilienz stärken – und welche Konfliktlinien sichtbar werden, wenn Solidarität eingefordert wird.
- Was macht Gemeinschaften wirklich krisenfest?
- Wo vertiefen sich bestehende Ungleichheiten?
- Und wie können politische, zivilgesellschaftliche und individuelle Handlungsspielräume genutzt werden, um demokratischen Zusammenhalt zu sichern?
Unsere Gäste:
- Bodo Ramelow – Vizepräsident und Mitglied des Deutschen Bundestages
- Dr. Janine Dieckmann – Wissenschaftliche Mitarbeiterin des Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt am Standort Jena
- Joël Ben-Yehoshua – Sprecher des Jungen Forums der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Jena
Die Diskussion wird Rebecca Schmidt (Geschäftsführerin des Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt) moderieren.
Das Angebot richtet sich hauptsächlich an approbierte Psychotherapeut*innen aber auch (nahe) andere Berufsgruppen oder Psychotherapeut*innen in Ausbildung sind herzlich eingeladen.
Bitte beachten Sie, dass die Anzahl an Teilnehmenden auf 25 Personen pro Fortbildung begrenzt ist und wir aus formalen Gründen verpflichtet sind, approbierte Teilnehmende bevorzugt anzumelden.
Bei den Fortbildungen handelt es sich um Wiederholungsveranstaltungen der gleichnamigen Angebote des letzten Jahres. Inhaltlich wird die Arbeit mit Betroffenen von digitalisierter Gewalt sowie in der zweiten Fortbildung Verschwörungsdenken im Kontext von Psychotherapie und Beratung vertiefend behandelt.
Alle Informationen zu den Workshop-Leitenden, Terminen und Anmeldemodalitäten finden Sie in der Einladung auf unserer Webseite:
https://www.izrd.de/de/izrd-projekte/fortbildungskurs-weltanschauungs-und-extremismus.html
Die Zertifizierung der Vortragsreihe bei der Psychotherapeutenkammer Berlin wurde beantragt, so dass Aussicht auf Fortbildungspunkte für die Teilnahme besteht.
Die Auseinandersetzung mit Antisemitismus und Rassismus stellt in der politischen Bildung eine zentrale Herausforderung dar. Obwohl beide Phänomene miteinander verwoben sind, bestehen historische und strukturelle Unterschiede. Gleichzeitig gibt es Versuche, sie gegeneinander auszuspielen – dem gilt es entschieden entgegenzutreten.
Wie können Antisemitismus und Rassismus gemeinsam thematisiert werden? Wo liegen Gemeinsamkeiten in den Erfahrungen, wo Unterschiede? Und wie kann eine antisemitismus- bzw. rassismuskritische Bildungsarbeit aussehen, die beide Perspektiven ernst nimmt?
Der Fachtag bietet Raum für Austausch mit Akteur*innen aus der antisemitismus- und rassismuskritischen Bildungsarbeit. Eingeladen sind Fachkräfte aus der Jugend- und Erwachsenenbildung, politischer Bildung, Gleichstellung und Migrationsarbeit sowie Lehrkräfte. Auch andere Interessierte sind herzlich willkommen.
Die Schulung richtet sich an angehende Fachkräfte und Fachkräfte, die neu in die Arbeit mit geflüchteten jungen Menschen eingestiegen sind oder einsteigen.
Qualifizierung, Austausch und Reflexionen zur eigenen Arbeitshaltung sind in dem Arbeitsbereich unerlässlich. Die Grundlagenschulung vermittelt praxisnah jugendhilferechtliche und asyl- und aufenthaltsrechtliche Grundlagen, Informationen zu Vormundschaft und ihrer Rolle im Asylsystem sowie zur Begleitung und Übergangsgestaltung von und mit jungen volljährigen Geflüchteten. Neben den Schulungsinhalten wird es Raum für interaktiven Austausch und zur Reflexion der Herausforderungen und Haltungen im Arbeitsalltag geben.
-
08.06.2025
Das CSD Hannover lädt erneut dazu ein, an der Demonstration und dem Straßenfest am 07. und 08.06.2025 teilzunehmen.
Zum Programm:
Samstag, 07. Juni 2025, 12-22 Uhr
- Auftaktkundgebung und Demonstration
- Musik auf zwei Bühnen
- Essen und Trinken sowie zahlreiche Sitzmöglichkeiten
- Awareness-Team und Zelt
- Infostände und Aktionen
Sonntag, 08.Juni 2025, 13-22 Uhr
- Musik auf zwei Bühnen
- noch mehr Infostände und Aktionen
- Essen und Trinken sowie zahlreiche Sitzmöglichkeiten
- Awareness-Team und Zelt
Alleine auf dem CSD? Ab 11 Uhr trifft sich eine Gruppe am Quader des Opernhauses, erkennbar am Schild – Connect at CSD. Komm gerne dazu. Mehr Infos.
-
06.06.2025
In der Praxis der Demokratieförderung und Extremismusprävention werden verschiedene Elemente der Selbstevaluation bereits im Rahmen von Qualitätssicherung oder für interne Lern- und Austauschprozesse genutzt. Allerdings ist das Anliegen, Selbstevaluation als Kompetenz systematisch zu entwickeln und aus ihr generierte Daten in externe Evaluationen mit einzubeziehen, erst kürzlich in den Fokus von Auftraggebenden, Praxisakteuren und Wissenschaftler*innen gerückt. Bedingt ist dies durch zwei sehr unterschiedliche Entwicklungen: zum einen, der zunehm enden Akzeptanz der Praxis als gleichwertige*r Partner*in von Evaluation und Expert*in in eigener Sache. Zum anderen, dem Wunsch, Zugang zu Daten – z.B. Zielgruppen – zu erhalten, die extern nur aufwändig erhoben werden könnten, gleichzeitig für die Feststellung von beispielsweise Zielerreichung und Wirkungen aber sehr relevant sind.
Wichtige Fragen, die sich in diesem Zusammenhang stellen, sind u.a.: Wie bewerten Praxisakteur*innen ihre bisherigen Erfahrungen mit Selbstevaluation – als zusätzlichen Zeitaufwand, der neben der Arbeit geleistet werden muss oder als hilfreiches Element lernender Projektentwicklung? Welches Wissen über Ablauf und Methoden von Selbstevaluation, aber auch über Standards und Rahmenbedingungen, sind dabei wichtig und wie können diese seitens der Wissenschaft sinnvoll unterstützt werden? Welche Good Practices gibt es bereits in der Projektpraxis, auch bezüglich der Umsetzung von aus Selbstevaluation gewonnenen Erkenntnissen? Wo liegen die Chancen und Grenzen von Selbstevaluation für Auftraggebende? Kann Selbstevaluation eine kostengünstige und zeitsparende Alternative zu Fremdevaluationen sein? Welche anderen Einblicke bietet sie für Auftraggebende in die Projektpraxis? Und wie können mögliche Risiken (mangelnde Objektivität, Betriebsblindheit) begrenzt werden, um eine sichere Rechenschaftslegung gegenüber Dritten zu gewährleisten?
Mai 2025
-
28.05.2025
Irreguläre Migration ist ein politisch hoch relevantes Thema, doch die Datenlage dazu bleibt äußerst umstritten. Das Fehlen eines Konsenses führt zu stark unterschiedlichen Einschätzungen des Phänomens und seiner politischen Auswirkungen. Um eine fundierte Grundlage für Entscheidungen zu schaffen, ist es unerlässlich, wissenschaftliche Befunde und praktische Erfahrungen systematisch zu erfassen und einen Austausch zwischen Wissenschaft, Politik und Praxis zu ermöglichen.
Im Mittelpunkt stehen folgende Fragen:
- Wie lässt sich das Spannungsfeld zwischen Flüchtlingsschutz und irregulärer Migration bewältigen?
- Wie finden irreguläre Migrantinnen und Migranten Zugang zur Gesundheitsversorgung, und welche Auswirkungen hat das auf das Gesundheitssystem?
- Welche Möglichkeiten und Praktiken der Regularisierung bestehen, und wie wirksam sind sie?
- Wie funktionieren die Maßnahmen und Infrastrukturen der Rückführung, und wie nachhaltig sind sie?
- Welche politischen Weichenstellungen zeichnen sich aktuell ab?
Das Angebot richtet sich hauptsächlich an approbierte Psychotherapeut*innen aber auch (nahe) andere Berufsgruppen oder Psychotherapeut*innen in Ausbildung sind herzlich eingeladen.
Bitte beachten Sie, dass die Anzahl an Teilnehmenden auf 25 Personen pro Fortbildung begrenzt ist und wir aus formalen Gründen verpflichtet sind, approbierte Teilnehmende bevorzugt anzumelden.
Bei den Fortbildungen handelt es sich um Wiederholungsveranstaltungen der gleichnamigen Angebote des letzten Jahres. Inhaltlich wird die Arbeit mit Betroffenen von digitalisierter Gewalt sowie in der zweiten Fortbildung Verschwörungsdenken im Kontext von Psychotherapie und Beratung vertiefend behandelt.
Alle Informationen zu den Workshop-Leitenden, Terminen und Anmeldemodalitäten finden Sie in der Einladung auf unserer Webseite:
https://www.izrd.de/de/izrd-projekte/fortbildungskurs-weltanschauungs-und-extremismus.html
Die Zertifizierung der Vortragsreihe bei der Psychotherapeutenkammer Berlin wurde beantragt, so dass Aussicht auf Fortbildungspunkte für die Teilnahme besteht.
Der 2025 veröffentlichte 9. Altersbericht der Bundesregierung schreibt der offenen Altenhilfe sowie der ambulanten und stationären Altenpflege eine besondere Verantwortung bei der Gewährleistung einer guten Lebens- und Pflegequalität für ältere LSBTI*-Personen zu. Hierzu zählen unter anderem die Sensibilisierung von Fachpersonal sowie Auszubildenden, die Etablierung von quartiersbezogenen und pflegeintegrativen Wohnkonzepten sowie die diversitätssensible Gesundheitsförderung in Pflegeeinrichtungen und Hospizen.
Im Rahmen des Fachtags werden Auszüge aus dem 9. Altersbericht der Bundesregierung vorgestellt und anhand von Praxisbeispielen gezeigt, wie queersensible Altenhilfe sowie -pflege konzeptionell angegangen werden kann. Ein Podiumsgespräch wird Impulse aus Bremen zu queersensibler Altenhilfe und Pflege sowie Bedürfnissen von älteren Trans- und Interpersonen aufgreifen. Am Nachmittag werden die Inhalte des Vormittags in drei Praxisworkshops vertieft.
Wie reagiere ich, wenn meine Schüler*innen ablehnend auf das Thema Sexualität im Unterricht reagieren? Welchen Einfluss hat Social Media auf das Verständnis von Sexualität und Gender bei Jugendlichen? Und wie können Eltern sowie Sorgeberechtigte wertschätzend und diskriminierungssensibel eingebunden werden?
Auf unserem Fachtag wollen wir uns gemeinsam mit Ihnen darüber austauschen, wie eine wertschätzende, diversitätsorientierte und religionssensible Haltung in der pädagogischen Arbeit mit Jugendlichen entwickelt und vertieft werden kann. Dabei lassen wir uns von der Grundannahme leiten, dass gerade die superdiverse Gesellschaft eine wertvolle Grundlage für Bildungsarbeit darstellt, in der unterschiedliche Perspektiven anerkannt und aktiv eingebunden werden können.
Im Rahmen von Input-Vorträgen, Erfahrungsberichten und Workshops werden praxisorientierte Ansätze vorgestellt, die dabei helfen können, unter Berücksichtigung verschiedener Lebensrealitäten über Sexualität(en) und Gender in Bildungskontexten zu sprechen.
Den Abschluss bildet eine moderierte Fishbowl-Diskussion, in der Teilnehmende ihre Perspektiven und Erfahrungen teilen und gemeinsam Handlungsimpulse für eine pädagogische Praxis in der superdiversen Gesellschaft entwickeln können.
Die Fachstelle für Pädagogik zwischen Islam, antimuslimischem Rassismus und Islamismus lädt am Donnerstag, den 22. Mai 2025, in Berlin zu ihrem Fachtag ein. Unter dem Titel „Über Sexualität(en), Gender und Bildung sprechen – pädagogisches Handeln in der superdiversen Gesellschaft“ möchten sie durch Vorträge und Workshops theoretische Impulse und praxisnahe Ansätze für eine diversitätssensible Bildung bieten.
Auf dem Fachtag soll die Möglichkeit geboten werden, sich gemeinsam darüber auszutauschen, wie eine wertschätzende, diversitätsorientierte und religionssensible Haltung in der pädagogischen Arbeit mit Jugendlichen entwickelt und vertieft werden kann. Grundannahme des Austausches ist es, dass gerade die "superdiverse" Gesellschaft eine wertvolle Grundlage für Bildungsarbeit darstellt, in der unterschiedliche Perspektiven anerkannt und aktiv eingebunden werden können.
In dem Vortrag des Projekts "Über Hassreden - Medienkompetenz und Strategien gegen Diskriminierung im Netz?" am 22. Mai 2025 stellt die Beratungsstelle ihre Arbeit vor und nimmt das Phänomen digitale Gewalt genauer in den Blick. Dabei geht sie nicht nur auf Präventions- und Handlungsstrategien ein, sondern spricht auch über die rechtlichen Handlungsmöglichkeiten.
Bei Interesse gelangen Sie hier zur Anmeldung: https://forms.office.com/e/0g7J48k7ca
Basierend auf der Publikation "Kinder - Minderheit ohne Schutz" von Aladin El-Mafaalani, Sebastian Kurtenbach und Klaus Peter Strohmeier lädt die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Niedersachsen zur gemeinsamen Lesung mit dem Autor und Politikwissenschaftler Kurtenbach.
-
23.05.2025
In den vergangenen Jahren hat sich der Rechtsextremismus hierzulande deutlich verändert. Seine Resonanzräume, Netzwerke und Agitationsformen wandeln und verbreiten sich. Extremistische Einstellungen setzen sich zunehmend in der Mitte der Gesellschaft fest. Rechtsradikale Straftaten nehmen deutlich zu. Medien, Zivilgesellschaft, Kirchen und Politik geraten unter wachsenden Druck. Der Bundestagswahlkampf 2025 verspricht eine wachsende Polarisierung. Wie könnte eine Gegenstrategie aussehen?
Wie kann Künstliche Intelligenz fair, divers und empowernd gestaltet werden? Welche Kompetenzen brauchen wir als Pädagog*innen, um Jugendliche beim verantwortungsbewussten und kreativen Umgang mit KI zu unterstützen?
Bei diesem Fachtag werfen wir einen kritischen Blick auf KI-Anwendungen und lernen Good-Practice-Beispiele aus der Jugendarbeit kennen.
Europa, die Europäische Union begegnen uns täglich – sei es in den Medien oder in unserem Alltag. Dennoch ist die europäische Idee für viele sehr abstrakt. Das will das Europa-Café auch in diesem Jahr ändern.
Auf Einladung von Landtagspräsidentin Hanna Naber findet das Bildungsformat erneut im Landtag statt. Das Motto für den 19. Mai 2025: „Mitmachen! Mitreden! Es ist Dein Europa!“. Schülerinnen und Schüler verschiedener niedersächsischer Schulen (ab Klassenstufe 10) werden sich von 10:00 bis etwa 15:30 Uhr mit dem Zustand der Europäischen Union befassen und – sowohl untereinander als auch mit Landtagsabgeordneten – über ihre Zukunft diskutieren.
-
18.05.2025
Teilhabe und Anerkennung sind die integrationspolitischen Prinzipien der Sozialen Demokratie. Nur wenn es gelingt, unterschiedliche kulturelle und religiöse Identitäten wechselseitig anzuerkennen und die rechtsstaatliche Demokratie als Grundlage der gemeinsamen Bürger_innenschaft zu verankern, können Spannungen überwunden und Konflikte gelöst werden. Zentrale Voraussetzung: die gleichberechtigte Teilhabe aller an den gesellschaftlichen Ressourcen und Chancen. Konkrete Instrumente kennen, zentrale Begriffe klären, umstrittene Punkte ansprechen und unterschiedliche Positionen vergleichen: Stärken Sie sich für die Diskussion im Themenfeld Integration, Zuwanderung und Soziale Demokratie!
Kurz und Kompakt:
• Grundlagen der Integrationspolitik
• Wechselseitige Anerkennung in der Praxis
• Soziale Demokratie und kultureller Pluralismus
• Gleichberechtigte Teilhabe und gemeinsame Bürgerschaft
Die TIB ist am „Citizen Science-Tag“ mit dem Projekt Gestapo.Terror.Orte. vertreten. Das Ziel der Veranstaltung ist es, gemeinsam mit Bürger:innen das Wissen über die Verbrechen der Gestapo digital zugänglich zu machen. Über die Plattformen Wikidata und Wikimedia Commons können Interessierte selbstständig Daten zum Gestapoterror eingeben und Fotografien und Archivalien veröffentlichen.
Der „Citizen Science-Tag“ findet am 15. Mai 2025 in der Zeit von 9 bis 16 Uhr im Lichthof im Hauptgebäude der LUH (Welfengarten 1 B, 30167 Hannover) statt.
-
14.11.2025
Die gleichwertige Versorgung in der Kinder- und Jugendhilfe ist für junge Menschen mit Fluchterfahrung gerade nicht gegeben. Ausgehend von den Erfahrungen junger Geflüchteter als Expert*innen wird diskutiert wie eine gerechte und inklusive Kinder- und Jugendhilfe gestaltet werden kann.
Jeder junge Mensch hat unveräußerliche Rechte auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit (§ 1 SGB VIII). Dies gilt uneingeschränkt für junge Geflüchtete, unabhängig davon, ob sie begleitet oder unbegleitet nach Deutschland eingereist sind. Das ausdifferenzierte Kinder- und Jugendhilfesystem versorgt und unterstützt alle jungen Menschen mindestens bis zum 21. Lebensjahr. Die Lebensrealität von jungen Geflüchteten in der Kinder- und Jugendhilfe sieht jedoch anders aus. Ihre Teilhabe und die Zuständigkeit der Kinder- und Jugendhilfe wird immer wieder infrage gestellt – im Verlauf des Jahres 2023 haben diverse Bundesländer Erlasse und Empfehlungen zur Abweichung von Qualitätsstandards der Kinder- und Jugendhilfe bei Hilfen für unbegleitete minderjährigen Geflüchteten (umF) veröffentlicht. Dies hat gravierende Auswirkungen auf die jungen Menschen und ihr Ankommen hier.
Als Beitrag zur Diskussion rückt das Forum die subjektiven Erfahrungen von jungen Geflüchteten selber in den Vordergrund und schafft Raum für praxisnahe Berichte, die verdeutlichen, was gute Kinder- und Jugendhilfe für diese Zielgruppe leistet und wie sie Teilhabe ermöglichen kann.
-
16.11.2025
Das IZRD bietet 2025 zum dritten Mal 20 Plätze für Fachkräfte von Berliner (Grund-)Schulen (Lehrkräfte, Schulsozialarbeiter*innen, Schulpsycholog*innen, o.Ä.) sowie der (offenen) Kinder- und Jugendarbeit für den Fortbildungskurs „Kinderschutz, religiös begründeter Extremismus und antidemokratische Weltanschauungen“ an.
In acht Modulen lernen Sie, Situationen im Kontext von Radikalisierung und religiös begründetem Extremismus im Zusammenhang mit Kindeswohl und Kindeswohlgefährdungsfragen einzuordnen. Sie trainieren praxisnah, die Resilienz betroffener Kinder und Jugendlicher zu stärken und mit Erziehungsberechtigten sowie Kolleg*innen konstruktiv ins Gespräch zu gehen. Darüber hinaus erhalten Sie einen Überblick darüber, welche Hilfs- und Unterstützungsangebote in Berlin bestehen und tragen anschließend als Multiplikator*innen entsprechendes Wissen in Ihr Arbeitsfeld. Das gewonnene Wissen wird in das (bestehende) Kinderschutzkonzept Ihrer Einrichtung integriert.
- Kostenfreie, berufsbegleitende Fortbildung mit insgesamt 8 Präsenzterminen in Berlin
- Blended-Learning: begleitendes E-Learning zu allen Modulen zum Selbststudium + Austauschmöglichkeiten
- Online-Fachvorträge mit Expert*innen zu spezifischen Themenwünschen (freiwillige Teilnahme)
- Insgesamt umfasst der Kurs 58 Stunden
- (Präsenzmodule: 37h + E-Learning: 21h)
- Freiwillige Online-Fachvorträge (6h)
- Anerkennung im Rahmen der Lehrkräftefortbildungsverordnung (FBLVO) durch die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie nach erfolgreichem Abschluss möglich
- Zertifikat nach erfolgreichem Abschluss
Anmeldungen sind über den folgenden Link möglich:
-
14.05.2025
Die Folgen des menschengemachten Klimawandels haben gravierende existentielle Auswirkungen in immer mehr Regionen unserer Erde. Klimabedingte Migration ist längst Realität, wird sich nach Einschätzung von Expert*innen weiter verschärfen und somit in diversen gesellschaftlichen Diskursen zunehmend an Bedeutung gewinnen. Ziel unserer Tagung ist es, der hochkomplexen Thematik aus unterschiedlichen Perspektiven zu begegnen, gemeinsam zu diskutieren und einen Austausch zu Fachwissen und Erfahrungsberichten zu ermöglichen. Im Rahmen der Tagung werden verschiedene Themen behandelt, darunter die politische Instrumentalisierung des Klimawandels, Klimagerechtigkeit, Klimarassismus, Präventionsarbeit, der aktuelle Stand der Forschung sowie die historische Einordnung. Wir fragen außerdem nach: Welche konkreten Instrumente für eine nachhaltige Veränderung stehen zur Verfügung und wie können Menschen mit demokratischen Werkzeugen und interkultureller Arbeit im Bereich Klimagerechtigkeit selbst aktiv werden? Die Tagung wird abgerundet durch eine Exkursion mit allen Teilnehmenden zu Initiativen der Dortmunder Nordstadt, die best-practice zum Thema Klima und Migration vorstellen und soll allen als abschließende Inspiration dienen.
Die Teilnahme ist auf bundesweiter Ebene möglich. Der erste Teil der Tagung findet am 13. Mai online statt. Die Vertiefung der Themen erfolgt in Form von Workshops am 14. Mai in Dortmund.
Aus dem "Gebäudeenergiegesetz", in dem es um eine Reduktion fossiler Brennstoffe ging, wurde in der Presse schnell ein "Heizhammer", der Menschen angeblich bevormunde und überfordere.
Dieses und weitere Beispiele wie der Streit um das Verbrenner-Aus, um autofreie Innenstädte oder Windräder verdeutlichen, dass die Frage, wie und in welcher Geschwindigkeit Klimaschutz umgesetzt werden soll, sehr unterschiedlich beantwortet wird. Bei nährer Betrachtung unserer Gesellschaft zeigt sich, dass Klimaschutz und ein damit einhergehender "sozial-ökologischer Umbau", unmittelbar mit Verteilungsfragen und Klassenkonflikten verbunden ist: Die Befürwortung des Wandels hängt direkt mit der gesellschaftlichen Position, den Besitz- und Selbstbestimmungsmöglichkeiten der Einzelnen zusammen. Dies bedeutet auch, dass politisch und ökonomisch darauf eingegangen werden musste.
In einem Projekt der Forschungsgruppe "Mentalitäten im Fluss (flumen)" an der Friedrich-Schiller-Universität Jena werden die erwähnten Konfliktpotentiale herausgearbeitet und Möglichkeiten des Gelingens eines "sozial-ökologischen Umbaus" beschrieben.
https://www.eeb-niedersachsen.de/Media/%C3%9Cberregional/Braunschweig/Klimaschutz-Flyer.pdf
-
09.05.2025
Der Ton in Bürgergesprächen ist rauer geworden – sei es bei Anfragen, kommunalen Dienstleistungen oder neuen Vorhaben. Mitarbeitende in Verwaltungen und zivilgesellschaftlichen Organisationen sind teilweise mit polarisierten Argumenten, emotional aufgeladenen Diskussionen und aggressivem Auftreten konfrontiert. Neu ist, dass die bewährte Strategie, die Dinge möglichst sachlich, rechtlich begründet und im jeweiligen Kontext darzustellen, oft nicht mehr greift oder die emotionale Aufwallung sogar verstärkt.
Um mit Sachargumenten durchzudringen, ist es notwendig, mit den auftretenden Affekten umgehen zu können. Affekte sind eng verwobene Gefühls- und Denkmuster, die von außen schwer einzuordnen sind. Professionelles Verhalten und eine gute Gesprächsführung brauchen neben Kompetenz in der Sache auch die Fähigkeit, emotionale Hintergründe zu verstehen und mit diesen entsprechend umgehen zu können.
Schwerpunkte:
- Auswirkungen von Emotionalisierung und Polarisierung auf gesellschaftlichen Zusammenalt
- Grundlagen von Affekt- und Konfliktlogiken
- Umgang mit Triggerpunkten
- Erkennen von Hintergründen und Motiven aggressiven Verhaltens
- Grundlagen lösungsorientierter Gesprächsführung
- Vorgehen, um in den jeweiligen Rollen situationsangemessen und professionell agieren zu können
Die Teilnehmer:innen erhalten ein Arbeitsheft mit konkreten Anleitungen und Hilfestellungen.
Zielgruppe:
- Mitarbeitende aus Kommunal- und Kreisverwaltungen
- MItarbeitende aus zivilgesellschaftlichen Organisationen und Verbänden mit direktem Kunden kontakt
Organisatorisches:
Gemeinsam mit der CommunAid guG bietet Pufii dazu ein zweitägiges Kommunikationstraining in Präsenz ian. Die Trainer:innen, Dorothe und Kurt Faller, sind als Mediator:innen, Organisationsberater:innen und Autor:innen seit vielen Jahren in der Beratung von Kommunen in Konflikt- und Krisensituationen tätig. Die Teilnehmergebühr beinhaltet die Verpflegung während der Veranstaltung.
Teilnehmergebühr 530 € und 430 € für DEFUS-Mitglieder und Pufii-Partner
Vor 80 Jahren, am 8. Mai 1945, endeten die Verbrechen des nationalsozialistischen Regimes. Mit der Kapitulation der deutschen Wehrmacht und dem Sieg der Alliierten wurde Deutschland vom Faschismus, vom Holocaust, von Kriegsverbrechen und politischer Repression befreit. Der Aufbruch nach 1945 war mit dem Anspruch verbunden, dass der Faschismus auf deutschem Boden nie wieder eine Chance bekommen sollte.
Aus diesem Anlass lädt die Friedrich-Ebert Stiftung zu einer Gedenkveranstaltung in die ver.di-Höfe, Hannover ein. Der renommierte Sozialwissenschaftler Harald Welzer wird in seinem Festvortrag nicht nur die historische Bedeutung dieses Tages beleuchten, sondern auch dessen gesellschaftliche Dimension in der Gegenwart reflektieren.
-
06.05.2025
Für islamistische Ideologien sind Krisenzeiten eine Chance – sie können Nährboden und Beschleuniger sein. Tatsächlich waren islamistische Bewegungen immer dann besonders stark, wenn sich um sie herum politische und gesellschaftliche Krisen und Kriege entfalteten. Das zeigte sich im „Arabischen Frühling“ und im syrischen Bürgerkrieg genauso wie nach dem Abzug internationaler Streitkräfte aus Afghanistan.
Nach der militärischen Niederlage des „Islamischen Staates“ (IS) im Frühjahr 2019 wurde es in der öffentlichen Wahrnehmung zunächst ruhiger – die Zahl der Anschläge in Europa ging zurück, ebenso das islamistische Personenpotenzial in Deutschland, und auch die mediale Debatte hierzulande ebbte ab. Eine Phase trügerischer Ruhe, wie wir heute wissen, denn Expertinnen und Experten waren und sind sich einig, dass der „IS“ und der Islamismus insgesamt nie weg waren.
Insbesondere der Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 und die darauffolgende Eskalation im Nahen Osten wirken aus heutiger Sicht wie eine Zäsur: Die Welt erlebt eine neue Mobilmachung für die islamistische Sache und die Auswirkungen sind auch in Europa und Nordamerika zu spüren. Wichtigstes Instrument für die Mobilmachung sind die Sozialen Medien, mancherorts ist bereits von neuen „TikTok-Dschihadisten“ die Rede.
Wie steht es also angesichts multipler Krisen, regionaler Kriege und globaler Konflikte um den Islamismus und seine Prävention im Jahr 2025?
Die international besetzte Fachtagung lenkt den Fokus auf weltweite Entwicklungen im Islamismus und nimmt aktuelle Herausforderungen in den Blick. (Wo) müssen wir das Rad wirklich neu erfinden, wann können wir an bewährte Erkenntnisse, Ansätze und Methoden anknüpfen? Was können Prävention und politische Bildung, was können die Sicherheitsbehörden tun? Was können wir von anderen Ländern und früheren Krisen lernen? Und: Wie gehen wir mit dem Gefühl um, immer wieder auf Krisensituationen reagieren zu müssen?
-
04.05.2025
April 2025
-
29.04.2025
"Die Geflüchteten, Verfluchten, die über die Grenzen hinweg nach Europa gelangt waren, langten nach den Augen der Welt, in den Augen der Europäer*innen, denn in ihren Augen waren sie die Welt, sie trugen eine Frage im Gepäck: Wer nur noch sein Leben zu retten hat, der hat nichts mehr zu verlieren, auch das Leben nicht, Widerstand zwecklos, wer trägt dann noch die Hoffnung?"
Zwei kritische, aber nicht hoffnungslose Blicke auf und über das Mittelmeer – das nicht nur Burggraben und Massengrab, sondern auch ein internationaler Raum der Bewegungsfreiheit und Solidarität sei
Move Your Town“ (MYT) heißt es im April in Hannover – mit einem Vorprogramm am 26. April und einem Hauptevent am 29. April. Die Veranstaltungsreihe wird in diesem Jahr durch den gemeinnützigen Verein TaBeKu - Verein zur Förderung von interkulturellem Austausch durch Tanz, Bewegung und Kunst e.V. mit einem neu überarbeiteten Konzept ausgetragen. „Move Your Town“ zielt darauf ab, die Freude am Tanz zu feiern und die Stadtgemeinschaft durch inklusive und vielfältige Tanzformate zusammenzubringen.
Das Programm findet an verschiedenen Ort statt - im Vorprogramm startet das MYT mit einer Filmvorführung "Fly - der Tanzfilm" am 26.04.2025 um 18.00 Uhr im Kino im Künstlerhaus (KOKI). Am 29. April startet das Hauptprogramm am Tanzhaus Ahrbergviertel, Ilse-Ter-Mer-Weg 7 von 9:30 bis 12:30 Uhr mit einem Tanzworkshop für Kinder mit Hans Fredeweß und einer offenen Probe mit mónica garcía vicente DANCE PROJECT.
Antisemitismus – ein Phänomen, das trotz jahrhundertelanger Weiterentwicklung und tiefer Verankerung in unserer Gesellschaft oft schwer zu greifen ist. Der Dokumentarfilm „Antisemitismus erkennen – von den Wurzeln bis zur digitalen Welt“ lädt ein zu einer aufschlussreichen Reise durch die über 2000-jährige Geschichte des Judenhasses und beleuchtet seine verschiedenen Facetten. Speziell für die schulische und außerschulische Bildung konzipiert, bietet der ca. 30-minütige Film Lehrenden und Lernenden eine wertvolle Grundlage für eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema.
Der Film greift auf die fundierte Expertise von Wissenschaftler:innen zurück und vereint historische Analyse mit aktuellem Bild- und Videomaterial aus Feldbeobachtungen des JFDA. So wird Antisemitismus in all seinen Erscheinungsformen und politischen Milieus authentisch dargestellt – von alltäglichen Vorurteilen bis hin zu wahnhaften Verschwörungsideologien. Die Zuschauer:innen erfahren, wie sich antisemitische Motive über Jahrhunderte hinweg erhalten haben. „Antisemitismus erkennen – von den Wurzeln bis zur digitalen Welt“ unterstreicht, dass Antisemitismus nicht nur Jüdinnen und Juden betrifft, sondern die Grundfesten demokratischen Zusammenlebens erschüttert. Der Film ist ein hilfreiches Instrument zur Aufklärung und betont die Notwendigkeit, gemeinsam gegen Diskriminierung und Hass vorzugehen. Ein wichtiger Beitrag für die politische Bildung und das respektvolle Miteinander – praxisnah, spannend und motivierend für alle, die für eine offene Gesellschaft eintreten möchten.
März 2025
Im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus bietet das Anne Frank Zentrum am 30. März eine öffentliche Führung durch die Ausstellung "Alles über Anne" an.
Die Ausstellung erinnert an Anne Frank und die Verbrechen der Nationalsozialisten. Sie greift Themen auf, mit denen sich Anne Frank in ihrem Tagebuch auseinandersetzte und die bis heute aktuell sind. In der Führung wird eine Verbindung zwischen Anne Franks Tagebuchaufzeichnungen und Antisemitismus, Rassismus und weiteren Formen der Diskriminierung in der Gegenwart hergestellt. Die Führung richtet sich an Familien.
Eintrittspreis: 8 Euro, ermäßigt: 4 Euro. Die Führung ist kostenlos. Keine Anmeldung erforderlich.
Betroffene berichten von alltäglichen Rassismus-Erfahrungen in Deutschland. Meist wird Rassismus jedoch nur im Zusammenhang mit Rechtsextremismus gesehen und nicht als Problem, dass in der Mitte der Gesellschaft zu verorten ist. Rassismus gilt nicht als Alltagsphänomen und Normalität in der Demokratie. Im Seminar soll für verschiedene Formen von Diskriminierung und insbesondere für Alltagsrassismus sensibilisiert werden. Darüber hinaus soll das Verhältnis zwischen individuell verantwortetem und strukturellem Rassismus thematisiert werden. Es werden Handlungsoptionen für Reaktionen auf Alltagsrassismus in Kommunikationsübungen erprobt.
Prof. Dr. Joachim Häfele, Polizeiakademie Niedersachsen, und Prof. Dr. Eva Groß, Professur für Kriminologie & Soziologie an der Hochschule der Akademie der Polizei Hamburg, stellen die Ergebnisse des Forschungsprojektes HateTown vor.
Die Veranstaltung findet von 14-15 Uhr online statt. Die Teilnahme ist kostenlos.
Im Haus der Jugend in Langenhagen findet am 22. März, von 14 bis 18 Uhr ein Workshop für Jugendliche statt. Das Motto lautet „Was sage ich wann? Wann sage ich was? Haltung zeigen gegen Rassismus“. Die Veranstaltung richtet sich an Personen im Alter von 14 bis 27 Jahre. Junge Menschen sollen lernen auch in ihrem direkten oder familiären Umfeld klare Positionen gegen alltäglichen Rassismus zu vertreten.
Der Workshop ist kostenlos, es wird um eine Anmeldung bis zum 19.03.25 erwünscht unter: jugendbeteiligung@langenhagen.de
Kurzentschlossene sind auch herzlich willkommen!
Die fachkundige Unterstützung von begleiteten und unbegleiteten minderjährigen Ausländer:innen ist sowohl in der Kinder- und Jugendhilfe als auch im asyl- und aufenthaltsrechtlichen Verfahren ein entscheidender Faktor für das Gelingen einer erfolgreichen Integration.
Das Aufenthaltsgesetz bietet auch außerhalb des Asylverfahrens vielfältige Möglichkeiten, den Aufenthalt von jungen Geflüchteten zu sichern. Teil 4 der Fortbildungsreihe legt den Fokus auf die verschiedenen Aufenthaltserlaubnisse, die nach einem negativ beendeten oder anstatt eines Asylverfahrens für minderjährige Ausländer in Betracht kommen könnten. Dabei wird praxisnah und verständlich auf die jeweiligen Erteilungsvoraussetzungen eingegangen.
Menschenfeindliche Sprüche, rechtsextreme Bilder und Zeichen, NS-verherrlichende Aussagen: Dies sind nur einige Beispiele für rechte Vorfälle an Schulen. Egal in welcher Form sie auftreten – ein Umgang mit ihnen ist nicht immer leicht und führt nicht selten zur Verunsicherung in der Schulgemeinschaft. Daher wollen wir uns zusammen mit Ihnen, Mitarbeiter*innen der Gedenkstätte Bergen-Belsen und der Mobilen Beratung Niedersachsen anschauen, was aktuell an Schulen im Kontext Rechtsextremismus und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit passiert und welche Umgangsstrategien es mit menschenfeindlichen Vorfällen und rechten Angriffen geben kann.
-
21.03.2025
Schon vor dem DBS-Fachtag gibt es in der Aktionswoche des Deutschen Bildungsservers zu Demokratiebildung für gesellschaftlichen Zusammenhalt vom 17.-21.03.2025 die Möglichkeit sich in täglichen Onlinesprechstunden auszutauschen.
Von Montag bis Donnerstag sind in dieser Woche Kolleginnen und Kollegen aus dem Team des Deutschen Bildungsservers im Rahmen von virtuellen Sprechstunden erreichbar und stehen für Ideen, Fragen und Diskussionen zur Verfügung.
-
30.03.2025
Vom 17.03. bis 30.03.2025 präsentiert das LeZ eine Ausstellung mit Kunst von und für queere Geflüchtete. Diese Ausstellung bietet einen einzigartigen Einblick in die Perspektiven und Erlebnisse von queeren Geflüchteten, die ihre Geschichten durch verschiedene Kunstformen ausdrücken. Neben der bildenden Kunst wird es Veranstaltungen wie einen Poetry-Abend geben, bei dem queere Künstler*innen ihre Werke teilen. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, gemeinsam ein starkes Zeichen für Vielfalt und gegen Rassismus zu setzen.
nicht barrierefrei.
-
30.03.2025
Die Kinder der Grundschule Frohmestraße haben sich zwei Monate mit Fragen rund um das Thema Menschenwürde auseinandergesetzt und ihre Gedanken und Gefühle dazu in Worten festgehalten. Ihre Perspektiven sind direkt, berührend und inspirierend – sie zeigen uns, worauf es wirklich ankommt. Die Ausstellung lädt dazu ein, die Stimmen der Kinder zu hören und über die Bedeutung von Menschenwürde nachzudenken. Die Ausstellung kann 24/ 7 in den Fenstern des FZS angeschaut werden.
Der Eintritt ist kostenfrei.
-
03.07.2025
Mehr als 20 Prozent der 18- bis 27-Jährigen stimmen inzwischen menschenfeindlichen Aussagen zu, auf TikTok verbreiten sich zunehmend Hass und Hetze und neonazistische Jugendgruppen mobilisieren Jugendliche gezielt für Proteste. Diese Entwicklungen sind längst in Einrichtungen der Jugend(sozial)arbeit angekommen. Doch das Erkennen von menschenverachtenden, antidemokratischen oder extrem rechten Tendenzen bei Jugendlichen, ihre differenzierte Einordnung sowie der angemessene Umgang damit stellen Jugend(sozial)arbeiter*innen vor große Herausforderungen.
Erprobtes Handlungskonzept zum Umgang mit Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und Rechtsextremismus
Um adäquat und wirksam reagieren zu können, benötigen pädagogische Fachkräfte Kenntnisse über aktuelle rechtsextreme Jugendphänomene, über Hinwendungs- und Radikalisierungsprozesse bei Heranwachsenden sowie Fach- und Praxiswissen zu Präventions- und Interventionsansätzen. Von März bis Juli 2025 vermittelt cultures interactive deshalb in einer modularen Fortbildung ein systematisches Handlungskonzept zum Umgang mit Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit sowie rechtsextrem orientierten oder gefährdeten Jugendlichen. Aufbauend auf einem Stufenplan wird im Fortbildungskurs spezifisches Sach- und Handlungswissen weitergegeben und auf Praxisfälle angewendet. Die Teilnehmenden entwickeln gemeinsam fallbezogene Maßnahmen und Handlungskonzepte, um die Handlungssicherheit zu stärken.
Gemeinwesenarbeit (GWA) ist ein unverzichtbares Instrument zur Stärkung der Demokratie und des sozialen Zusammenhalts. In Zeiten zunehmender gesellschaftlicher Spannungen und knapper werdender Ressourcen ist es essentiell, GWA nicht als zusätzliche finanzielle Belastung, sondern als strategische Investition in die Zukunft unserer Gesellschaft zu begreifen.
An dem Tag erwartet Sie/euch:
Expert*inneninput aus dem PraxisNetzwerk und darüber hinaus
Ausprobieren, Produzieren, Mitmachen – Nachbarschaftsdialoge live
Über 100 Gesprächsmethoden, Ideen, Aktionen für Nachbarschaftsdialoge
Nachbarschaftsdialoge als strategisches Instrument nutzen
Finanzierung von GWA – auch wirtschaftlich denken
Kosten-Nutzen von GWA aufdecken
Überblick und Austausch zu Finanzierungsstrategien von über 70 Projekten
In 2025 feiert der Landespräventionsrat Niedersachsen sein 30 jähriges Bestehen. Dies möchte er feiern und lädt herzlich zu seiner Jubiläumsveranstaltung „Prävention verbindet: 30 Jahre Engagement im Land Niedersachsen“ ein. Dieses besondere Fest findet am 10. März 2025 im Rahmen des Niedersächsischen Präventionstages in Hannover statt.
In den letzten drei Jahrzehnten haben der LPR und seine Mitglieder sowie Partner*innen und Unterstützer*innen entscheidend dazu beigetragen, die Lebensqualität der Menschen in Niedersachsen nachhaltig zu verbessern und ein sicheres Umfeld für alle Bürger*innen zu schaffen.
Der LPR lädt zu einem Tag voll anregenden Austauschs ein, zu einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm mit faszinierenden Vorträgen, inspirierenden Diskussionsrunden, Poetry Slam, Impro-Theater und einem Markt der Möglichkeiten.
-
04.04.2025
Die Fotoausstellung vom Büro für Integration der Stadt Göttingen zeigt 16 Porträts von Menschen, die von ihren rassistischen Erfahrungen berichten.
-
07.03.2025
Krieg, Flucht, Leben in der Fremde: Viele geflüchtete Menschen sind durch erschütternde Erfahrungen traumatisiert. Wichtig für Menschen in psychischen Ausnahmesituationen ist vor allem, das Gefühl von Sicherheit und Stabilität wiederzuerlangen. Mit einer traumasensiblen Grundhaltung können diese Menschen unterstützt werden, indem sie zum Beispiel Wertschätzung und Partizipation erfahren.
In dieser Schulung lernen haupt- und ehrenamtlich Engagierte Methoden kennen, die ihnen im Umgang mit traumatisierten Menschen mit Fluchterfahrung helfen. Die Schulung wird von qualifizierten Traumafachberater:innen durchgeführt.
-
06.03.2025
Kriminalitätsprävention und Gewaltprävention spielen eine zentrale Rolle für die gesellschaftliche Sicherheit und Resilienz gegenüber extremistischen Einflüssen. Der Verein NEUSTART ist seit Jahrzehnten in Österreich tätig und gilt als Vorreiter im Bereich der opferschutzorientierten Täterarbeit und Rückfallprävention.
Im Rahmen dieser Veranstaltung beleuchtet Alexander Grohs, Leiter der NEUSTART-Standorte Niederösterreich und Burgenland, die Arbeit des Vereins aus verschiedenen Perspektiven:
- Zahlen, Daten, Fakten zur Wirksamkeit der Programme
- Theoretische Ansätze und innovative Methoden in der Gewalt- und Extremismusprävention
- Die Bedeutung der Rückfallprävention und ihre langfristigen Effekte
- Praxisberichte über die Arbeit mit radikalisierten und extremistischen Personen
Dieses Format bietet fundierte Einblicke in die Arbeit von NEUSTART, insbesondere in zwei sehr unterschiedlichen Regionen Österreichs. Es richtet sich an Fachkräfte der Präventionsarbeit, Strafrechtsexperten sowie Interessierte, die mehr über praxisorientierte Ansätze in der Resozialisierung erfahren möchten.
-
31.03.2025
Der Frauenpolitischer Rat Land Brandenburg e.V. läd ein, am 08. März 2025 in Potsdam mit zu diskutieren, wie Menschen verschiedenster Gruppenzugehörigkeiten in Brandenburg leben wollen und was dafür gebraucht wird. Erstmals öffnen sie die Türen und bieten der Zivilgesellschaft, der Politik und gleichstellungspolitisch Interessierten einen Nachmittag voller Gespräche.
Weitere Infos erhalten Sie hier.
Februar 2025
Inhalte der Fortbildung sind: Einblicke in die Erfahrungswelten von geflüchteten Jugendlichen und jungen Erwachsenen, eine Aneignung von Grundwissen zum Thema Flucht und Trauma, ein Austausch über die Un/Möglichkeiten traumapädagogischer Hilfen in Wohn-Einrichtungen, Handlungsanregungen für konkrete Probleme wie Schlafstörungen, Suizidalität und Dissoziationen. Es wird Zeit für die Relfexion von Fällen und Selbstfürsorge geben.
-
04.04.2025
Gesellschaftliche Veränderungsprozesse bringen oft Herausforderungen mit sich, die an erster Stelle dort zum Vorschein kommen, wo Menschen Seite an Seite zusammenleben - in den Städten, Gemeinden und Stadtteilen. Als Ansprechpartner*in für Träger, Verwaltung und Politik werden Sie immer wieder beauftragt solche spannungsgeladene Konfliktsituationen im Quartier zu bearbeiten. Hiefür benötigen Sie Werkzeuge der Konfliktbearbeitung und die Möglichkeit diese entlang praktischer Beispiele zu erlernen und einzuüben.
In dieser Fortbildung lernen Sie, spannungsgeladene Veränderungsprozesse zu gestalten und nachhaltig zur Bearbeitung von damit einhergehenden Konflikten beizutragen. Dafür vertiefen Sie Ihr Konfliktverständnis und erlernen Methoden der Konfliktanalyse und Konfliktbearbeitung, die Sie anhand eines selbst gewählten Fallbeispiels anwenden. Sie schärfen Ihren Blick für Machtasymmetrien, Ihre eigene Rolle in Konfliktbearbeitung, sowie für externe Unterstützungsangebote. Als eine Form der externen Unterstützung lernen Sie die Kommunale Konfliktberatung kennen. Der prozessorientierte, systemische Ansatz setzt unterschiedliche Perspektiven und Interessen von Bevölkerungsgruppen in Zusammenhang und macht Konflikte damit bearbeitbar. Dieser Ansatz wird derzeit vom forumZFD sowie dem K3B – Kompetenzzentrum Kommunale Konfliktberatung des VFB Salzwedel umgesetzt.
Termine
27. Februar 2025 | 09.00 - 16.00 Uhr | Online
28. Februar 2025 | 09.00 - 16.00 Uhr | Online
03. April 2025 | 09.00 - 16.00 Uhr | Präsenz
04. April 2025 | 09.00 - 16.00 Uhr | Präsenz
-
24.08.2025
Wie kann ich Menschen in meiner Einrichtung, die Rassismus und/oder Antisemitismus erfahren, am besten unterstützen?
Was bedeuten Antisemitismus und Rassismus überhaupt? Wie hängen sie zusammen, wie unterscheiden sie sich? Inwiefern hängen sie auch mit sozialen Ungleichheiten im Kapitalismus zusammen?
Wie können wir uns als Betroffene von Rassismus, Antisemitismus und rechter Gewalt gegenseitig unterstützen und empowern?
Was tue ich, wenn ich die Rückmeldung bekomme, dass ich mich (unbewusst) rassistisch oder antisemitisch geäußert habe?
Wie lassen sich institutioneller Rassismus und Antisemitismus am Arbeitsplatz nachhaltig abbauen?
Dies sind einige der zentralen Fragen, denen wir uns widmen werden. In allen Modulen behandeln wir sowohl Grundlagen als auch aktuelle gesellschaftliche Debatten. Eine wichtige Rolle spielt das Reflektieren eigener Bezüge und Emotionen zu Rassismus und Antisemitismus.
Vorläufiger Ablauf- Modul I: Rassismus als alltägliches, strukturelles und globales Problem (21.02.-23.02.2025)
- Modul II: Antisemitismus als alltägliches, strukturelles und globales Problem (23.05.-25.05.2025)
- Modul III: Getrennte Räume für Empowerment und für kritische Reflexion von weiß-Deutsch- und nicht-Jüdisch-Sein (13.06.-15.06.2025)
- Modul IV: Von der Reflexion in die Praxis und zurück (22.08.-24.08.2025)
Die Module bauen aufeinander auf. Sie sind nur zusammen buchbar. Zwischen den Modulen ist das Arbeiten in Peer-Gruppen vorgesehen.
Antifeminismus ist nicht nur eine Gefahr für Frauen, queere und trans Personen, sondern fungiert auch als Brückenideologie: Er verbindet und verstärkt menschenfeindliche Strömungen wie Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus. Dadurch werden Feindbilder geschaffen, die demokratische Grundwerte untergraben und gesellschaftliche Spaltungen vertiefen. Die Amadeu Antonio Stiftung läd daher zur Diskussion ein, die Funktionen des Antifeminismus' zu erläutern, warum er eine direkte Bedrohung für Demokratie und gesellschaftlichen Zusammenhalt darstellt und was wir alle dagegen tun können.
Datum: 17.02.
Uhrzeit: 19:00 Uhr
Livestream via YouTube
-
14.02.2025
„Ressentiment“ bezeichnet die Verfestigung eines Gefühls der Kränkung, das negative soziale Erfahrungen hypostasiert, positive Erfahrungen hingegen entwertet. Kränkungsgefühle dieser Art können dauerhaft zu negativen Einstellungen gegenüber der sozialen Umwelt beitragen. Ein positives Selbstbild kann dann oft nur noch durch Abwertung derjenigen, von denen man sich herabgesetzt fühlt, aufgebaut werden. Verfestigen sich derartige Gefühle der Unterlegenheit und führen sie zu einer Haltung der fortgesetzten Selbstbehauptung und Empörung und gehen sie gleichzeitig mit einem Mangel an Selbstkritik und Lernbereitschaft einher, ist von einer durch Ressentiment geprägten Affektlage zu sprechen.
Das Forschungsprojekt hat in den letzten vier Jahren untersucht, inwieweit derartige ressentimentale Affektlagen einen Nährboden für Polarisierungs- und Radikalisierungsprozessen unter Muslim:innen in Deutschland bilden können. In zwei qualitativen Teilprojekten wurden über 160 leitfadengestützte Interviews mit Muslim:innen in türkisch- und arabischstämmigen Milieus geführt. In die Befragung des quantitativen Teilprojekts waren 1.887 Muslim:innen einbezogen.
Mit der Abschlusstagung will der Veranstalter die Forschungsergebnisse der einzelnen Teilprojekte sowie übergreifende Überlegungen vorstellen. Über diese Befunde will der Veranstalter mit Wissenschaftler:innen, die zu ähnlichen Themen arbeiten und mit Praktiker:innen aus der Integrationsarbeit und Gewaltprävention ins Gespräch kommen, um die wissenschaftliche Diskussion voranzubringen und Implikationen für die Radikalisierungsprävention aufzuzeigen.
Thüringen nimmt rund 2,7 % aller Asylsuchenden in Deutschland auf, darunter viele junge Menschen aus Afghanistan, Syrien, Irak, Nigeria und der Türkei. Eine große Zahl der Geflüchteten wird für eine unbestimmte Zeit und dauerhaft bleiben, weil in ihren Heimatländern anhaltend Krieg und politische Verfolgung drohen. Damit verbunden ist die Frage, wie eine Integration in die Gesellschaft und in Schule/Ausbildung gelingen kann.
Seminarinhalte:
- Rahmenbedingungen und Fakten zur Situation von Geflüchteten in Deutschland und Thüringen
- Status: Aufenthaltstitel, Duldungsvarianten
- Arbeitsmarktzugang für Menschen mit Gestattung, Duldung und Aufenthaltserlaubnis
- Fördermöglichkeiten AsylbLG/SBG III und SGB III
- Bleibeperspektiven, insbesondere Neuerungen durch das Chancenaufenthaltsrechtsgesetz
- Der Chancenaufenthalt in Thüringen
-
27.06.2025
Wo Menschen zusammenleben entstehen Konflikte. Auch die großen gesellschaftlichen Krisen schlagen sich oft als erstes vor Ort in den Städten und Gemeinden nieder. Kleine wie große Konflikte aufzufangen, aber auch das Zusammenleben in Vielfalt zu gestalten, stellt verschiedene Akteure vor Ort oft vor Herausforderungen. Die Fortbildung möchte Wege aufzeigen, diesen zu begegnen und im Rahmen der eigenen Möglichkeiten Konflikte in der Kommune anzugehen.
Teilnehmende stärken ihre kommunikativen Fähigkeiten und erarbeiten sich einen analytischen Blick auf Konflikte in ihrem jeweiligen kommunalen Kontext. Sie erlernen, wie Konflikte genutzt werden können, um gesellschaftliche Veränderungsprozesse zu gestalten, und welche Rolle sie dabei einnehmen können. Ein fundiertes Konfliktverständnis hilft nicht nur, die Dynamiken hinter den Konflikten zu entschlüsseln und Polarisierung zu begegnen. Es unterstützt auch dabei, verschiedene Positionen, Interessen und Bedürfnisse in den Blick zu nehmen und dazu passende Strategien zu entwickeln, die über das eigene gewohnte Handeln hinaus gehen.
Januar 2025
-
31.01.2025
Am 31. Januar ruften die Omas gegen Rechts zu einer Menschenkette rund um das Hamburger Rathaus auf: "Wir wollen keine rechten Parteien in unserer Bürgerschaft!" hieß ihr Appell.
Schulisches Personal steht vor der Herausforderung, professionell mit Radikalisierung unter Schüler:innen umzugehen. Im Rahmen der CleaRNetworking-Weiterbildung erlernen die Teilnehmenden
ein siebenstufiges Clearing-verfahren im Umgang mit sich radikalisierenden Schüler:innen. Das Projekt wird von der Bundeszentrale für politische Bildung gefördert. Projektträger ist die 1981 gegründete Aktion Gemeinwesen und Beratung e.V., anerkannter freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe sowie Gemeinwesenarbeit und Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband (DPWV).
Eine Teilnahme an der Weiterbildung bedeutet, dass sich die entsprechende Schule auf den Weg begibt, Stukturen von Radikalisierungsprävention zu implementieren. Schulen entsenden zwei Personen zur Teilnahme an der Weiterbildung, deren Fachkompetenz im Feld der Radikalisierungsprävention geschult wird und die Impulse für die Entwicklung eines schulischen Präventionskonzeptes erhalten. Auch nach Abschluss der Weiterbildung bietet CleaRNetworking Austauschangebote, um Schulen auf dem Weg der Implementierung nachhaltiger schulischer Präventionsstrukturen zu unterstützen.
- Interessierte weiterführende Schulen (keine Grundschulen) bundesweit können bei erfolgreicher Bewerbung zwei Personen (idealerweise in unterschiedlicher Funktion, z.B. Lehrkraft & Schulsozialarbeit) zur Teilnahme an der Weiterbildung entsenden.
- Die Weiterbildung schult Fachkompetenz im Feld der Radikalisierungsprävention und gibt Impulse für die Entwicklung eines schulischen Präventionskonzeptes. Eine Teilnahme an der Weiterbildung bedeutet, dass sich eine Schule auf den Weg begibt, Strukturen von Radikalisierungsprävention zu implementieren.
- 8 jeweils zweitägige Schulungstermine in ausgewählten Tagungshotels mit Fernverkehrsanbindung liegen zwischen Januar 2025 und November 2025.
-
Während und nach Abschluss der Weiterbildung bietet CleaRNetworking Austauschangebote, um Schulen auf dem Weg der Implementierung nachhaltiger schulischer Präventionsstrukturen zu unterstützen.
-
Der Eigenanteil für die Teilnahme an der Weiterbildung liegt bei 450€ pro Person.
-
Die Anmeldung ist eröffnet, erfolgt mit wenigen Klicks hier und ist möglich bis Donnerstag, 31.10.2024, oder bis alle Plätze belegt sind.
-
18.06.2025
-
18.01.2025
Seit den Ereignissen des 7. Oktober 2023 hat der Nahostkonflikt auf der ganzen Welt Eingang in unterschiedliche Lebens- und Arbeitsbereiche gefunden. Die Schule ist einer dieser Räume, in denen mitunter tiefe Gräben zwischen den Schüler:innen und Lehrer:innen entstehen können, die aufgrund von Unkenntnis der Sachlage und vor dem Hintergrund der eigenen Herkunft und religiösen Sozialisation zum Teil emotional aufgeladen werden. In diesem Zusammenhang kann es zur Revitalisierung antisemitischer und anti-muslimischer Vorurteile und Stereotype kommen, die zu Ausgrenzungs- und Diskriminierungserfahrungen im Klassenzimmer führen können.
Das Haus der Religionen lädt Sie deshalb zur Fachveranstaltung "Der globale Konflikt im Klassenzimmer" (GKiK) am 17. und 18. Januar 2025 ein, die sich explizit an den Bedürfnissen von Lehrer:innen orientiert. Mit Hilfe namhafter Expert:innen werden der Nahostkonflikt und dessen Auswirkungen sowie damit korrespondierende Themen wie Antisemitismus und anti-muslimischer Rassismus sowohl aus der wissenschaftlichen als auch aus der praxisbezogenen Perspektive vorgestellt. Die Lehrkräfte erhalten hierdurch einen guten Überblick über diese Themenfelder und können zugleich in den direkten Austausch mit den Fachleuten treten.
-
02.06.2025
Migration ist eines der prägendsten Phänomene unserer Zeit und beeinflusst Gesellschaften weltweit. Historisch ein Motor für Entwicklung und kulturellen Austausch, wird sie heute oft als Problem gesehen, was sich in polarisierten Debatten und Veränderungen in der politischen Landschaft zeigt.
Die digitale Ringvorlesung "Migration im Fokus" beleuchtet Dynamiken und Gestaltungsmöglichkeiten, aber auch migrationsbedingte Herausforderungen in Bezug auf die Gesellschaft und die öffentliche Verwaltung. Ziel ist es, ein tieferes Verständnis zu fördern und zu einer sachlicheren Auseinandersetzung beizutragen.
Vor diesem Hintergrund finden ab Januar 2025 einmal im Monat Veranstaltungen statt, die sich mit Teilaspekten des Themas Migration beschäftigen. Es handelt sich um ein Angebot des Netzwerks Weltoffene Hochschulen, des Instituts für Polizei- und Kriminalwissenschaften (IPK) und des Instituts für Geschichte und Ethik (IGE).
Qualifizierung, Austausch und Reflexionen zur eigenen Arbeitshaltung sind in dem Arbeitsbereich unerlässlich. Die Grundlagenschulung vermittelt praxisnah jugendhilferechtliche und asyl- und aufenthaltsrechtliche Grundlagen, Informationen zu Vormundschaft und ihrer Rolle im Asylsystem sowie zur Begleitung und Übergangsgestaltung von und mit jungen volljährigen Geflüchteten. Neben den Schulungsinhalten wird es Raum für interaktiven Austausch und zur Reflexion der Herausforderungen und Haltungen im Arbeitsalltag geben.
Dezember 2024
Was haben wir in zehn Jahren Beratungsarbeit gelernt? Wie hat sich Beratung über die Jahre professionalisiert, und wie wird der Erfolg von Beratung gemessen? Wie können Zugänge zu radikalisierungsgefährdeten oder bereits radikalisierten Personen gefunden werden, damit Beratung da ankommt, wo sie gebraucht wird?
Das Berliner Beratungsmodell weist im tertiärpräventiven Bereich durch die enge Zusammenarbeit von Zivilgesellschaft und Sicherheitsbehörden eine deutschlandweit besondere Beratungsarchitektur auf.
Wie lassen sich der sicherheitspolitische Auftrag mit dem Ziel der Gefahrenabwehr auf der einen und der sozialarbeiterische Auftrag, der in erster Linie die Bedürfnisse des Individuums in den Blick nimmt, auf der anderen Seite zusammendenken? Welche Vorteile, aber auch Herausforderungen, bietet dieses Modell?
Über diese und weitere Fragen möchten wir mit Ihnen ins Gespräch kommen.
Der Fachtag richtet sich an Personen aus dem Bereich der Islamismusprävention, Sicherheitsbehörden und Polizei, Politiker*innen, Fachkräfte aus Schule und Sozialer Arbeit sowie an Vertreter*innen von Kommunen und Behörden. Er wird von der Berliner Landeskoordinierungsstelle Radikalisierungsprävention und Violence Prevention Network durchgeführt.
Einsamkeit unter Jugendlichen nimmt besonders in Krisenzeiten zu. Ob durch die Coronapandemie, politische Instabilität oder persönliche Herausforderungen – viele junge Menschen fühlen sich sozial isoliert und von der Politik unverstanden. Diese Gefühle von Entfremdung und Ausgrenzung können dazu führen, dass Jugendliche das Vertrauen in die Gesellschaft verlieren und autoritäre oder radikale Einstellungen entwickeln.
Welche Risikofaktoren begünstigen das Gefühl von Einsamkeit? Welche präventiven Maßnahmen können pädagogische Fachkräfte ergreifen, um Einsamkeit und demokratiefernen Tendenzen vorzubeugen? Und welche intervenierenden Maßnahmen gibt es, wenn soziale Isolation und radikale Einstellungen schon bestehen?
-
13.12.2024
Das Phänomen der „Incels“ (involuntary celibates) hat in den letzten Jahren zunehmend Aufmerksamkeit erlangt. Inzwischen hat sich eine weitere Untergruppe gebildet, die sogenannten „Mincels“, also muslimische Incels. Vildan Aytekin erläutert, was hinter diesem Phänomen steckt und präsentiert die Ergebnisse ihrer Analyse verschiedener Online-Plattformen.
November 2024
"Im Rahmen unserer Arbeit beschäftigen wir uns intensiv mit den dynamischen Wechselwirkungen zwischen präventiven und repressiven Ansätzen im Umgang mit religiös begründetem Extremismus. Dieses komplexe Spannungsfeld steht auch im Fokus unseres diesjährigen Politik- und Pressegesprächs, bei dem wir gemeinsam über nachhaltige Lösungsansätze sprechen wollen. Die Veranstaltung ist kostenfrei und findet am 28. November 2024 von 18:00 bis 19:30 Uhr statt.
Im Umgang mit religiös begründetem Extremismus stehen wir als Gesellschaft vor der Herausforderung, eine Balance zwischen repressiven und präventiven Maßnahmen zu finden. Oft liegt der Fokus hier auf Verbotsdiskursen, sowie dem Umgang mit Herausforderungen im Schulkontext und Inhalten in den Sozialen Medien. Bei unserem diesjährigen Politik- und Pressegespräch möchten wir diese Themen vertiefen und gemeinsam mit Vertreter*innen aus Politik, Presse und Zivilgesellschaft darüber diskutieren, wie wir vor allem präventive Maßnahmen stärken können, ohne notwendige repressive Maßnahmen zu vernachlässigen. Dabei geht es um die Frage, wie sinnvoll Vereinsverbote sind, welche Wirkung sie auf jugendliche Zielgruppen haben und wie extremistischer Propaganda im digitalen Raum effektiv entgegengetreten werden kann
Auf dem Podium begrüßen wir zur Diskussion Sandra Bubendorfer-Licht (MdB, FDP), Daniel Baldy (MdB, SPD), Christoph Koopmann (Süddeutsche Zeitung) sowie Rüdiger José Hamm (Co-Geschäftsführer BAG RelEx)."
• Wie gehe ich mit den Schnittstellen und Überschneidungen verschiedener Diskriminierungsformen um?
• Wie kann ich Raum für alle schaffen und dabei meine eigenen Privilegien reflektieren?
• Welche Methoden helfen dabei, intersektionale Perspektiven in der Bildungsarbeit zu verankern?
Diesen und anderen Fragen widmen wir uns in dieser interaktiven Fortbildung. Ein Input zur intersektionalen Rassismuskritik bildet die Grundlage, um die vielfältigen Diskriminierungserfahrungen und Machtstrukturen sichtbar zu machen, die Teilnehmende in den Lernraum einbringen können. Durch praxisnahe Methoden und Austauschrunden vertiefen wir die Thematik und reflektieren gemeinsam eigene Positionierungen und mögliche Interventionen. Dabei erhalten Sie Gelegenheit, die Ansätze und Fallbeispiele auf Ihre eigene Arbeit zu übertragen.
-
27.11.2024
Das Massaker vom 7. Oktober ist ein tiefer kollektivbiografischer Einschnitt und eine Zäsur für das Leben der jüdischen und israelischen Community in Israel und Deutschland. Die Verdichtung antisemitischer Reflexe und der Gewalt gegen Jüdinnen_Juden nach dem 7. Oktober bilden eine weitere Front. Seit dem Massaker und dem Krieg in Israel und Gaza-Streifen ist die antisemitische Bedrohung massiv angestiegen – Betroffene berichten von Diskriminierung, verbalen und physischen Übergriffen, schwindenden Bündnissen, beeinträchtigter Teilhabe. Sowohl in der Forschung als auch Bildung entstehen neue Bedarfe; Institutionelle Schutzlücken, Unsicherheiten, Leerstellen werden dabei besonders sichtbar. Das Bewusstsein für die zunehmende Radikalisierung des Antisemitismus wächst allmählich. Gleichzeitig ist das Verständnis für die weitreichenden Veränderungen für Jüdinnen_Juden nach dem 7. Oktober noch sehr eingeschränkt.
Das diesjährige Fachsymposium gibt Einblicke in die Forschung zu den Auswirkungen des 7. Oktober auf jüdische und israelische Communities und fragt nach strukturellen Manifestationen des Antisemitismus in hiesigen Bildungsinstitutionen. Das Ziel der Veranstaltung ist es, Folgen der Gewalt und die veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in den Blick zu nehmen und Herausforderungen sowie Perspektiven für die Forschung und Bildung auszuloten
Gegenstand der Veranstaltung sind die Herausforderungen in der Kinder- und Jugendhilfe an der Schnittstelle zum Migrationsrecht. In ihrer Arbeit sehen sich Fachkräfte in Jugendämtern regelmäßig mit Fragestellungen konfrontiert, die Sachverhalte mit Migrationsbezug mit sich bringen. Für einen sicheren Umgang in diesem Bereich werden die Teilnehmenden über Themen wie Zuständigkeit, Familienzusammenführung, Abschiebung, Ablauf von Asylverfahren und der Bedeutung des Kindeswohls informiert. Kooperationswege mit Ausländerbehörden werden aufgezeigt und gemeinsame Handlungsstrategien in Workshops entwickelt.
„Geflüchtete Menschen haben das Recht, an allen Entscheidungen beteiligt zu werden, die sie betreffen.“
Dieser Anspruch ist in den | Mindeststandards zum Schutz von geflüchteten Menschen in Flüchtlingsunterkünften|formuliert, die von der | Bundesinitiative zum Schutz von geflüchteten Menschen in Flüchtlingsunterkünften|erarbeitet wurden.
Eine multiperspektivische Betrachtung des Themas „Partizipation in Unterkünften für geflüchtete Menschen“ ist ein Kernanliegen dieses Fachtages. Vertreter:innen aus Erstaufnahmeeinrichtungen, Kommunen und geflüchtete Personen selbst werden ihre Perspektiven und Erfahrungen teilen.
Zudem geben wir Einblicke in Projekte zur Teilhabe und Partizipation mit geflüchteten Kindern und Erwachsenen. Dabei stehen Gelingensbedingungen sowie Lösungsansätze bei auftretenden Herausforderungen im Fokus.
Seit 2020 haben wir pädagogische Fachkräfte unterstützt, gute Demokratiebildung umzusetzen, Jugendliche für die Wahl ab 16 fit gemacht und zu Themen rund um Antidiskriminierung und Antirassismus sensibilisiert. Die aktuelle Förderphase im Programm „Demokratie leben!“ läuft Ende dieses Jahres aus und unser Kompetenznetzwerk endet damit. Auf einer Abschlussveranstaltung möchten wir fachlich reflektieren, was wir gemeinsam erreicht haben, welche Synergien entstanden sind und welche Themen gesetzt werden konnten.
-
15.11.2024
Mädchen und junge Frauen sind immer stärker von Radikalisierung betroffen und werden von extremistischen Netzwerken direkt angesprochen. Bei ihren Hinwendungsprozessen spielen viele Faktoren eine Rolle. Einige davon haben etwas mit ihren persönlichen Geschlechtervorstellungen, den Werten und Normen, die ihnen familiär oder in der Schule vermittelt wurden, und den gesellschaftlichen Erfahrungen, die sie als Mädchen gemacht haben, zu tun.
All das wird gezielt von extremistischen Akteur*innen aufgegriffen und vor allem online genutzt, um junge Frauen für islamistische (oder rechtsextreme) Zwecke anzusprechen. Dabei werden sie weiterhin viel zu oft in ihrer Radikalisierung übersehen. Gerade bei Polizei und Sicherheitsbehörden bleiben sie häufig „unter dem Radar“, da ihr Handeln weniger im öffentlichen Raum stattfindet. Studien und Erfahrungen der Radikalisierungsprävention zeigen dagegen, dass Mädchen und Frauen im Islamismus (wie auch im Rechtsextremismus) eine wichtige Rolle in verschiedenen Gruppierungen spielen können, etwa in der Weitergabe von Ideologie on- und offline, in der Familien- und Erziehungsarbeit sowie in der geschlechtsspezifischen Rekrutierung anderer junger Frauen. Dabei greifen sie häufig antimuslimischen Rassismus auf, der sich bei ihnen zu einem „Opfernarrativ“ genereller Muslimfeindlichkeit in der westlichen Welt verdichtet. Damit können sie nicht selten erfolgreich bei den persönlichen Erfahrungen von jungen muslimischen Frauen andocken.
-
15.11.2024
Seit 2022 arbeiten wir als deutschlandweites Forschungs- und Transferprojekt zu Evaluation und Qualitätssicherung in den Bereichen Extremismusprävention, Demokratieförderung und politische Bildung. Nun möchten wir die Ergebnisse und Erkenntnisse aus mittlerweile zwei Jahren „PrEval – Zukunftswerkstätten“ in Form des „PrEval Monitors“ vorstellen sowie die daraus resultierenden Empfehlungen mit allen Interessierten aus Fachpraxis, Wissenschaft und Politik diskutieren.
Grundlage für Programm und Diskussionen wird die erste Auflage des „PrEval Monitors“ sein, der im Oktober als Print- und Digitalpublikation erscheint. Darin finden sich alle aktuellen Informationen zu den einzelnen PrEval-Teilprojekten, Datenerhebungen, entwickelten Formaten sowie natürlich zu den Empfehlungen, die wir an die unterschiedlichen Ziel- und Interessengruppen richten und beim Fachtag diskutieren möchten.
Die einzelnen Teilprojekte gestalten ein abwechslungsreiches Programm, das zusätzlich über einen Livestream verfolgt werden kann. Das vorläufige Programm findet sich unten.
-
15.11.2024
Co-Radikalisierung solche Dynamiken beleuchtet werden, in denen präventives Handeln entgegen seiner Absicht Radikalisierungen verstärkt. Aus dieser Perspektive werfen wissenschaftliche Referent*innen aus Österreich, Frankreich und Deutschland einen Blick auf Maßnahmen der Prävention von religiös begründetem Extremismus. Damit wird ein Phänomenbereich der Radikalisierungs-
prävention adressiert, der in den vergangenen Jahren eine beachtliche Expansion erfahren hat.
Für alle, die sich auch weiterhin für Teilhabe, Demokratie und eine diskriminierungsarme, demokratische und gerechte Gesellschaft einsetzen und gegen rechte Tendenzen aktiv werden wollen!
Mit besonderem Fokus auf die Lebensrealitäten und Bedarfe von Menschen mit Migrationsgeschichte, Rassismuserfahrung und Drittstaatsangehörige
Wie und wo können wir unsere Macht teilen mit Menschen die weniger Macht haben? Wie können wir unsere Ressourcen (Räume, Geld, Zeit, Wissen, …) teilen? Wie können wir uns für eine gerechtere Gesellschaft einsetzen? Was können wir in Institutionen, Verwaltung und in der sozialen Arbeit tun, um soziale Gerechtigkeit zu erreichen?
Was ist meine Handlungsmacht, mein Handlungsrahmen? Wie kann ich mich für Barriere-Abbau und mehr Zugänglichkeit zu Ressourcen, Diskursen und Beteiligungsstrukturen einsetzen?
Was sind strukturelle Zugangsbarrieren und Hürden in sozialen Diensten, Behörden und der Gesundheitsversorgung?
Rassismus gehört für viele Kinder, Jugendliche, Eltern und Lehrkräfte zum Schulalltag. Oft werden rassistische Verhaltensweisen und Strukturen im Schulkontext nicht benannt, sondern verharmlost oder geleugnet. Um gleichberechtigte Bildung für alle zu ermöglichen, muss das System Schule rassismuskritisch weiterentwickelt werden.
Migrant*innenselbstorganisationen (MSO), Vereine und engagierte Menschen leisten bereits wichtige Beiträge zum Abbau von Rassismus. Rassistische Praktiken und Strukturen müssen benannt werden, damit eine inklusive rassismuskritische Lernumgebung geschaffen werden kann.
Mit diesem Fachtag werden wir rassistische Diskriminierung im Kontext von Bildung exemplarisch sichtbar machen und herausarbeiten, welche Veränderungen aus migrantischer Perspektive nötig sind, damit rassismuskritisches Handeln am Lernort Schule gelingen kann.
Der Fachtag zielt darauf ab, für Rassismus in Schule zu sensibilisieren, individuelle und strukturelle Lösungsansätze zu entwickeln und die Grundlage für den Aufbau wirksamer Antidiskriminierungsstrukturen in und um Schulen herum zu entwickeln und zu vertiefen.
Wie können pädagogische Fachkräfte komplexen Herausforderungen in der Extremismusprävention begegnen? Dieser Frage widmet sich das Interdisziplinäre Zentrum für Radikalisierungsprävention und Demokratieförderung (IZRD) e.V. mit der Fachvortragsreihe ‘Prävention. Macht. Schule’.
Im Zuge ihrer Tätigkeit kommen pädagogische Fachkräfte unweigerlich mit den vielfältigen Lebensgeschichten und (religiösen) Weltanschauungen ihrer Schüler*innen sowie deren Eltern in Berührung. Gesellschaftliche Konfliktlagen und Zugehörigkeiten, ebenso wie extremistische Einstellungs- und Verhaltensweisen, werden häufig auch im Klassenraum verhandelt. Diesen Herausforderungen wenden wir uns in der Fachvortragsreihe mit dem Ziel zu, Handlungssicherheit zu schaffen. Dabei bieten wir Mitarbeitenden der (Grund-)Schulen (u.a. Lehrkräften, Schulsozialarbeiter*innen und Schulpsycholog*innen) Einblicke in Zusammenhänge zwischen (religiös begründetem) Extremismus und Kinderschutz. Die Teilnehmenden bekommen konkrete Handlungsmöglichkeiten präsentiert, um Radikalisierungsprozesse zu erkennen, darüber in den Austausch zu kommen und präventiv in ihren Institutionen wirksam zu sein.
Die Fachvortragsreihe wird im Rahmen des Fortbildungskurses ‘Kinderschutz, religiös begründeter Extremismus und antidemokratische Weltanschauungen’ organisiert. Wir legen den Fokus der Veranstaltungsreihe auf die Prävention von islamistischen Einstellungs- und Verhaltensweisen. Gleichzeitig ist es uns ein Anliegen, die Perspektive auf weitere Phänomenbereiche zu erweitern, um auch phänomenunabhängige Transfermöglichkeiten der Erfahrungen und Umgangsweisen zu diskutieren.
Übersicht der Termine:
- 26.September 2024: Medienkonsum und Online-Prävention (IZRD e.V.)
- 17. Oktober 2024: Gendersensible Präventionsarbeit aus der Praxis (SMF-Verband)
- 07. November 2024: Pädagogische Ansätze zum Umgang mit dem ‘Nahostkonflikt’ (ufuq e.V.)
- 05.Dezember 2024: Rechtsextremismusprävention und Kinderschutz (Miteinander e.V.)
Die Termine finden jeweils von 16:00 – 17:30 Uhr statt.
Laut einer repräsentativen Umfrage der Friedrich-Ebert-Stiftung aus dem Jahr 2023 stimmt mehr als die Hälfte der deutschen Gesellschaft mindestens einer bekannten Verschwörungserzählung zu. Doch was bringt Menschen dazu, an Verschwörungserzählungen zu glauben?
Ausgehend vom kostenfreien Selbst-Lernangebot "VIVA – Verschwörungsdenken individuell verstehen und auffangen" sind die Teilnehmenden eingeladen, verschiedene Hinwendungsgründe zu Verschwörungsdenken sowie sich daraus ableitende Handlungsoptionen beim digitalen Fachtag genauer zu betrachten und mit anderen zu diskutieren.
Das vergangene Jahr war geprägt von zahlreichen Veränderungen und Diskussionen, die die Rechte und Teilhabe geflüchteter Menschen in Deutschland betreffen. Verschärfungen im Asylbewerberleistungsgesetz, ein härteres Abschiebungsrecht, die Reform des Einbürgerungsrechts, zunehmend prekäre Unterbringungssituationen und der eingeschränkte Zugang zu bedarfsgerechten Sprach- und Integrationskursen sind nur einige der Themen, die die gesellschaftliche Debatte und den politischen Prozess bestimmten. Hinzu kommen Fragen zur Situation ukrainischer Geflüchteter sowie die Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems und deren Umsetzung in Deutschland.
Schätzungen zufolge haben 10 bis 15 Prozent aller Geflüchteten eine Behinderung, unter den ukrainischen Geflüchteten ist dieser Anteil sogar noch höher. Die Entwicklungen des letzten Jahres betreffen daher auch und in besonderem Maße geflüchtete Menschen mit Behinderung, die ohnehin mit erheblichen Teilhabebarrieren und Hürden bei der Wahrnehmung ihrer Rechte konfrontiert sind und eine eigene, intersektionale Form von Diskriminierung erfahren.
Unternehmen sind gut aufgestellt, um sich dieser Herausforderung zu stellen. Durch die Mobilisierung von Mitarbeitern zur professionellen Beratung und individuellen Unterstützung von LGBTQ-Flüchtlingen können Unternehmen eine entscheidende Rolle dabei spielen, LGBTIQ-Flüchtlingen dabei zu helfen, sich besser auf dem Arbeitsmarkt zurechtzufinden und Zugang zu Beschäftigungsmöglichkeiten zu erhalten.
TENT-Germany bietet ein passgenaues Mentoring-Programm zur individuellen Begleitung von queeren Geflüchteten auf dem Weg zu einer festen und sicheren Arbeitsstelle. TENT-Mitarbeitende geben wichtige Informationen zu: ?wie kann das Programm genutzt werden, wer kann davon profitieren??
Patrick Dörr (Vorstand LSVD*-Verband Queere Vielfalt) wird im zweiten Teil einen Fachinput zum Thema Asylrecht geben mit nützlichen Informationen für alle Beratenden und Begleitenden.
-
05.11.2024
Konflikte sind in der Regel für alle Beteiligten unangenehm. Oftmals möchte man sie vermeiden, ihnen ausweichen oder wertet sie als einen Hinweis auf schlechte Führung. Konflikte sind jedoch unvermeidlich – auch und vielleicht gerade in werteorientierten Organisationen. Und hier sind sie oft sogar nützlich, um abstrakte und divergierende Vorstellungen, Werte und Positionen zu verdeutlichen und auszudifferenzieren und den Entwicklungsprozess von Organisationen zu befördern.
- Personen mit Führungsverantwortung können in unterschiedlicher Weise von Konflikten betroffen sein:
- Konflikte im Team überschatten den Arbeitsalltag und erfordern Klärung und Vermittlung durch die Führungsperson,
- als Führungsperson ist man selbst in Konflikte mit Mitarbeiter*innen, Kolleg*innen oder Vertragspartner*innen oder anderen verwickelt,
- unterschiedliche Führungsrollen in einem selbst, beispielsweise die als Vorgesetzte*r, Mentor*in, Budgetverantwortliche*r, Kolleg*in stehen im Konflikt zueinander.
Konfliktanlässe, die jeweiligen Rahmenbedingungen und Spielräume für Konfliktklärung müssen jeweils am konkreten Fall analysiert und reflektiert werden. Fragen, die sich für die Führungsperson in diesem Kontext beispielsweise ergeben, sind: Welchen Beitrag kann ich zur Klärung von Konflikten im Team leisten? Wie könnte eine gute Lösung der Konflikte aussehen? Wie komme ich aus dem Gefühl der Ohnmacht wieder zur Wahrnehmung von Handlungsspielräumen und zur Übernahme von Verantwortung, wenn widerstreitende Interessen oder Werte mich selbst blockieren?
Das Seminar bietet die Möglichkeit, eigene Praxisbeispiele und Fragen einzubringen und praxisnahe Unterstützung für Herausforderungen im Umgang mit Konflikten zu erhalten. In einem Mix aus Theorieinputs, Reflexion in der Gruppe und gemeinsamer Arbeit an Praxisfällen werden folgende Themen bearbeitet:
- Wovon sprechen wir, wenn wir von Konflikten sprechen: Arten, Anlässe, Aspekte, Ebenen?
- Worauf kommt es im Umgang mit Konflikten an: Rollenklarheit (Partei, Moderator*in, Mediator*in), Ressourcen und Grenzen, Methoden/Tools und Stolperfallen?
- Welche Auswirkungen hat meine Führungsrolle auf meinen Umgang mit Konflikten?
- Was ist meine Haltung gegenüber Konflikten und welche Auswirkungen hat sie auf meinen Umgang mit ihnen: Ressourcen, Risiko, Entwicklungspotenzial?
Oktober 2024
-
26.10.2024
Nach langjährigen Auseinandersetzungen liegt ein Kompromiss zum Gemeinsamen Europäischen Asylsystem (GEAS) vor. Diese Tagung zielt darauf ab, zentrale Akteure aus Gesetzgebung, Politik, Rechtsprechung, Wissenschaft und Zivilgesellschaft zusammenzubringen, um die künftige Gestaltung der EU-Asylpolitik und des Flüchtlingsschutzes zu erörtern. Dabei sollen sowohl aktuelle Herausforderungen als auch potenzielle Lösungsansätze auf drängende Fragen diskutiert werden.
Viele Fachkräfte und Engagierte fragen sich, wie sie Menschen in Gruppen oder Teams in einen gelingenden Austausch zu Diversitätsthemen und Fragen politischer Beteiligung bringen können.
- Welche Diskussionsthemen fördern einen konstruktiven Austausch, welche sind weniger geeignet?
- Welche Methoden und Eisbrecher gibt es, die einen einfachen Zugang und die Redebeteiligung aller ermöglichen?
- Wie leite ich eine Diskussionsrunde diskriminierungskritisch und diversitätsbewusst an?
- Und welche Rolle spielt dabei eigentlich meine eigene gesellschaftliche Position?
Diesen und weiteren Fragen wird in der Fortbildung nachgegangen. Praxiserprobte Methoden für die eigene Umsetzung von Diskussionsangeboten werden vorgestellt und gemeinsam ausprobiert.
NeMiA legt den Fokus auf die herausfordernde Situation von Frauen mit Migrationsbiografie im Kontext von Arbeitsmarktzugang und Arbeitsmarktintegration entlang der Kernproblematik der Anerkennung von Qualifizierung einerseits, sowie der strukturellen und intersektionalen Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt andererseits. Ziel des Projekts ist ein besserer Zugang zum und gerechtere Integration in den Arbeitsmarkt. Um diese Ziele zu verwirklichen, bringt NeMiA niedersachsenweit arbeitsmarkrelevante Netzwerkmitglieder aus Politik und Zivilgesellschaft zusammen, vernetzt und multipliziert Wissen und Informationen und stellt diese wiederum allen Netzwerkmitgliedern und Interessierten zur Verfügung.
Das nächste Netzwerktreffen findet am Donnerstag den 24.10. von 10 - 13 Uhr in Hannover statt. Wir begrüßen von der Antidiskriminierungsstelle Landeshauptstadt Hannover Charlotte Becker für einen Input zu Diskriminierung in der Arbeitswelt. Darüber hinaus wird sich die Kostelle Frau & Beruf Region Hannover vorstellen.
Anmeldung via Mail an: judith.frerking@aul-nds.de
Von fast allen politischen Richtungen gerät unser Sozialstaat immer stärker unter Druck - zu teuer, zu ineffektiv, zu viel Missbrauch. Bezieher*innen sozialer Leistungen werden zusehends als „Sozialschmarotzer*innen“, „Totalverweigerer*innen“ und „Faulenzer*innen“ diffamiert. Kürzungen seien die einzige Lösung, um Investitionen in die Zukunftsfähigkeit unserer Wirtschaft zu ermöglichen. Die Liste populistischer Argumente gegen unseren Sozialstaat lässt sich fortsetzen. In diesen Debatten werden die Verletzlichsten in unserer Gesellschaft – arbeitslose Menschen, Migrant*innen, Alleinerziehende, pflegende Angehörige, Kinder aus armutsgefährdeten Haushalten, Rentner*innen – gegeneinander ausgespielt und unsere Gesellschaft polarisiert. Davon profitieren einzig und allein rechtsextreme Kräfte.
Der Fachtag wird sich mit den zunehmenden Angriffen auf unseren Sozialstaat in politischen Debatten auseinandersetzen und Perspektiven entwickeln, wie wir ihn als wichtiges Instrument sozialer Teilhabe und Chancengleichheit für alle Menschen stärken. Insbesondere im Osten haben wir mit den diesjährigen Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg, der kommenden Bundestagswahl 2025 und der Landtagswahl 2026 in Sachsen-Anhalt langanhaltende und scharfe Debatten zu erwarten, in denen sozialpolitische Errungenschaften mühsam verteidigt werden müssen.
Trubel in der Stadt oder Beschaulichkeit auf dem Land – Geschmäcker, Bedürfnisse und Gegebenheiten gehen bei beiden Lebensweisen weit auseinander. Expert:innen diskutieren am 17. Oktober 2024 beim Herrenhäuser Gespräch, wie sich die scheinbaren Gegensätze wieder anziehen können.
"Hier auf’m Land ist’s hoffnungslos, da in der Stadt, da is‘ was los": Als Reinhard Mey in den 70ern über Vorzüge von Stadt- und Landleben meditierte, ging es um Moden und persönliche Vorlieben. Auch heute kann es eine Lifestyle-Frage sein, ob man den Wirbel der Metropole sucht oder die Stille des Dorfs. Zugleich hat sich zwischen Stadt und Land eine schwierig zu überbrückende Kluft aufgetan: Während in Städten der Besitz eines Autos unter klimapolitisch-moralische Vorbehalte gestellt wird, ist er auf dem Land oft unverzichtbar. Während in der Enge der Städte Wohnen unbezahlbar wird, ist auf dem Land die Versorgung mit Kultur- und Bildungsreinrichtungen prekär. Auch die Vorstellungen von Normalität, Notwendigkeiten und guter Politik klaffen auseinander. Politische Kräfte profitieren davon und befeuern die Gegensätze, um dem politischen Gegner zu schaden.
Ist diese Entwicklung neu – oder verschärft sie nur einen alten Befund? Wann ist der Verständnisfaden zwischen Stadt und Land gerissen? Und: Wie wächst neues Verständnis, damit die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Sinne des Grundgesetzes (wieder) gelingt?
Wie können pädagogische Fachkräfte komplexen Herausforderungen in der Extremismusprävention begegnen? Dieser Frage widmet sich das Interdisziplinäre Zentrum für Radikalisierungsprävention und Demokratieförderung (IZRD) e.V. mit der Fachvortragsreihe ‘Prävention. Macht. Schule’.
Im Zuge ihrer Tätigkeit kommen pädagogische Fachkräfte unweigerlich mit den vielfältigen Lebensgeschichten und (religiösen) Weltanschauungen ihrer Schüler*innen sowie deren Eltern in Berührung. Gesellschaftliche Konfliktlagen und Zugehörigkeiten, ebenso wie extremistische Einstellungs- und Verhaltensweisen, werden häufig auch im Klassenraum verhandelt. Diesen Herausforderungen wenden wir uns in der Fachvortragsreihe mit dem Ziel zu, Handlungssicherheit zu schaffen. Dabei bieten wir Mitarbeitenden der (Grund-)Schulen (u.a. Lehrkräften, Schulsozialarbeiter*innen und Schulpsycholog*innen) Einblicke in Zusammenhänge zwischen (religiös begründetem) Extremismus und Kinderschutz. Die Teilnehmenden bekommen konkrete Handlungsmöglichkeiten präsentiert, um Radikalisierungsprozesse zu erkennen, darüber in den Austausch zu kommen und präventiv in ihren Institutionen wirksam zu sein.
Die Fachvortragsreihe wird im Rahmen des Fortbildungskurses ‘Kinderschutz, religiös begründeter Extremismus und antidemokratische Weltanschauungen’ organisiert. Wir legen den Fokus der Veranstaltungsreihe auf die Prävention von islamistischen Einstellungs- und Verhaltensweisen. Gleichzeitig ist es uns ein Anliegen, die Perspektive auf weitere Phänomenbereiche zu erweitern, um auch phänomenunabhängige Transfermöglichkeiten der Erfahrungen und Umgangsweisen zu diskutieren.
Übersicht der Termine:
- 26.September 2024: Medienkonsum und Online-Prävention (IZRD e.V.)
- 17. Oktober 2024: Gendersensible Präventionsarbeit aus der Praxis (SMF-Verband)
- 07. November 2024: Pädagogische Ansätze zum Umgang mit dem ‘Nahostkonflikt’ (ufuq e.V.)
- 05.Dezember 2024: Rechtsextremismusprävention und Kinderschutz (Miteinander e.V.
Die Termine finden jeweils von 16:00 – 17:30 Uhr statt.
-
15.10.2024
Seit 2019 führte die bpb eine Online-Veranstaltungsreihe für professionelle und ehrenamtliche Community Manager/-innen durch. In dieser wurde den Teilnehmenden Wissen über und Strategien gegen digitalen Hass vermittelt, um sich Menschenfeindlichkeit in Kommentarspalten entgegen zu stellen.
Aus den Erkenntnissen, Feedbacks und Gesprächen der letzten 4 Jahren wurde nun eine Präsenz-Veranstaltung konzipiert. Diese richtet sich ganz konkret nach den evaluierten Bedarfen der Zielgruppe und bietet die Möglichkeit für eine größere Teilnehmendenzahl von der Expertise der Referierenden zu profitieren. Außerdem soll es Raum geben, sich in Vernetzungsformaten gegenseitig im Einsatz für einen demokratischen Austausch im Netz zu bestärken und für die wichtige Aufgabe des Community Managements Kraft zu tanken.
-
11.10.2024
Der thematische Schwerpunkt der Konferenz wird aufgrund der anstehenden Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen auf die Bedeutung einer migrantisch engagierten Zivilgesellschaft in Zeiten rechtsextremer Diskurse gelegt – also auf uns. Welche Rollen können und wollen wir hier im demokratischen Diskurs einnehmen? Warum ist unser Engagement gerade jetzt so wichtig? Warum braucht es dabei auch eine „rassismuskritische Selbstfürsorge“?
-
11.10.2024
Prozesse der Migration und Post-Migration haben Deutschland und Europa in den letzten Jahrzehnten nachhaltig geprägt. Sie werfen vielfältige Fragen der Anerkennung und Teilhabe sowie des Zusammenlebens und der Verständigung über Identitäten auf. In diesem Kontext wird Migration als herausfordernde Realität zwischen Konflikt und Solidarität konstruiert, interpretiert, analysiert und politisiert.
Wissenschaft und Politik beobachten und formen dieses Spannungsfeld. Dies definiert den zentralen Ausgangspunkt der diesjährigen DeZIM-Tagung. Dabei stellen sich insbesondere folgende Fragen:
- Welche Rolle spielen Informationen, wahrgenommene Chancen sowie Marginalisierungs- und Krisenerfahrungen für Migrationsprozesse?
- Welche Auswirkungen hat Migration unterschiedlicher Phasen und Herkünfte auf transnationale und lokale Räume und wie verändern sich Migrations- und Integrationsprozesse durch diese?
- Was sind die räumlichen Bedingungen von Aushandlungsprozessen: Wie lassen sich gesamtgesellschaftlich und lokal differenziert migrationsbezogene Konflikte und Muster der Solidarität erklären?
- Wer macht in welchen gesellschaftlichen Bereichen Diskriminierungs-, Rassismus- und Marginalisierungserfahrungen, wie können intersektionale Diskriminierung und Rassismus systematisch erfasst und analysiert werden?
- Welche Folgen für Teilhabe entstehen daraus und wie kann dem politisch begegnet werden?
- Wie kommt es zu Solidarität mit gesellschaftlich marginalisierten Gruppen?
- Wie werden im Kontext von Migration und Post-Migration Demokratie, Vielfalt und politische Repräsentation ausgehandelt? Wo herrscht Unsichtbarkeit in der Repräsentation? Was ergibt sich daraus für Responsivität und für migrationsbezogene Diskurse in demokratischen Öffentlichkeiten?
Die Tagung bietet eine Plattform für den Austausch von Ideen, Forschungsergebnissen und politischen wie auch Praxiserfahrungen zu diesen sowie weiteren Fragen. Wir laden Wissenschaftler*innen aller Karrierestufen, Personen aus Zivilgesellschaft und Praxis sowie Akteur*innen aus Politik und Verwaltung ein, – gerne in Kollaboration – ihre Expertisen und Erfahrungen zu teilen, Argumente und Ideen auszutauschen und politische Wege für die herausfordernden Realitäten der Migration zwischen Konflikt und Solidarität zu diskutieren.
September 2024
Die psychosoziale Situation von jungen Asylsuchenden ist von Belastungen, Ängsten und Rassismuserfahrungen geprägt. Hinzu kommen Probleme mit dem Asylsystem und der Aufnahme und Unterbringung. Fachkräfte und Ehrenamtliche, die (unbegleitete) minderjährige Asylsuchende auf ihrem Lebensweg begleiten, sind damit konfrontiert, die jungen Menschen im Umgang mit diesen Herausforderungen zu unterstützen – eine schwierige Aufgabe.
Insbesondere die komplexen rechtlichen Regelungen rund um das Asylverfahren werden von den Minderjährigen und Unterstützungsnetzwerken als undurchsichtig, kompliziert und frustrierend beschrieben. Hier soll der Workshop von IBIS e.V. ansetzen.
Der Workshop startet mit einem Vortrag über juristische Grundlagen des Asylverfahrens – im Hinblick auf die Rechte von unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden. Ziel ist, Wissen über das Asylsystem und die Möglichkeiten der betroffenen Minderjährigen zu vermitteln.
Im Anschluss wird anhand eines Intervisionskonzepts des Psychosozialen Zentrums von IBIS e.V. gemeinsam mit den Teilnehmenden über Herausforderungen und Handlungsoptionen in der Arbeit mit jungen Asylsuchenden gesprochen. Teilnehmende können anonyme Fallbeispiele einbringen, die gemeinsam aus rechtlicher, psychologischer und pädagogischer Perspektive betrachtet werden. Die Intention ist, Umgangsweisen mit aktuellen Problemstellungen in der eigenen Praxis zu finden.
Wie können pädagogische Fachkräfte komplexen Herausforderungen in der Extremismusprävention begegnen? Dieser Frage widmet sich das Interdisziplinäre Zentrum für Radikalisierungsprävention und Demokratieförderung (IZRD) e.V. mit der Fachvortragsreihe ‘Prävention. Macht. Schule’.
Im Zuge ihrer Tätigkeit kommen pädagogische Fachkräfte unweigerlich mit den vielfältigen Lebensgeschichten und (religiösen) Weltanschauungen ihrer Schüler*innen sowie deren Eltern in Berührung. Gesellschaftliche Konfliktlagen und Zugehörigkeiten, ebenso wie extremistische Einstellungs- und Verhaltensweisen, werden häufig auch im Klassenraum verhandelt. Diesen Herausforderungen wenden wir uns in der Fachvortragsreihe mit dem Ziel zu, Handlungssicherheit zu schaffen. Dabei bieten wir Mitarbeitenden der (Grund-)Schulen (u.a. Lehrkräften, Schulsozialarbeiter*innen und Schulpsycholog*innen) Einblicke in Zusammenhänge zwischen (religiös begründetem) Extremismus und Kinderschutz. Die Teilnehmenden bekommen konkrete Handlungsmöglichkeiten präsentiert, um Radikalisierungsprozesse zu erkennen, darüber in den Austausch zu kommen und präventiv in ihren Institutionen wirksam zu sein.
Die Fachvortragsreihe wird im Rahmen des Fortbildungskurses ‘Kinderschutz, religiös begründeter Extremismus und antidemokratische Weltanschauungen’ organisiert. Wir legen den Fokus der Veranstaltungsreihe auf die Prävention von islamistischen Einstellungs- und Verhaltensweisen. Gleichzeitig ist es uns ein Anliegen, die Perspektive auf weitere Phänomenbereiche zu erweitern, um auch phänomenunabhängige Transfermöglichkeiten der Erfahrungen und Umgangsweisen zu diskutieren.
Übersicht der Termine:
- 26.September 2024: Medienkonsum und Online-Prävention (IZRD e.V.)
- 17. Oktober 2024: Gendersensible Präventionsarbeit aus der Praxis (SMF-Verband)
- 07. November 2024: Pädagogische Ansätze zum Umgang mit dem ‘Nahostkonflikt’ (ufuq e.V.)
- 05.Dezember 2024: Rechtsextremismusprävention und Kinderschutz (Miteinander e.V. )
Die Termine finden jeweils von 16:00 – 17:30 Uhr statt.
-
25.09.2024
Das Zusammenleben in der Migrationsgesellschaft, die Unterbringung und Integration von Geflüchteten, die Energiewende, der Fachkräftemangel, oder auch der „Rechtsrutsch“ sind nur einige der Themen, die deutsche Kommunen derzeit bewegen. Sie müssen auf diese Herausforderungen vor Ort konkret reagieren und dabei Bundes- und Landespolitik mit dem Geschehen und den Bedarfen in ihrer Kommune in Einklang bringen. In manchen Fällen gelingt dies gut, in anderen führen die gesamtgesellschaftlichen Transformationsprozesse zu Konflikten innerhalb der Kommune.
Diese Konflikte sind einerseits sehr kontextspezifisch: Jede Stadt oder Gemeinde hat ihre ganz eigenen Herausforderungen und Rahmenbedingungen ebenso wie Potenziale. Gleichzeitig lassen sich in Ursachen und Dynamiken von Konflikten viele Gemeinsamkeiten identifizieren und so von den Erfahrungen anderer lernen. Darüber hinaus verfügen Städte, Gemeinden und Landkreise bereits über eine Vielzahl von Strukturen, Verfahren und Kompetenzen, um Konflikte konstruktiv zu bearbeiten. Welche Lösungsansätze haben sich bereits bewährt? Welche kreativen Bearbeitungsansätzen gibt es? Und in welchen Fällen ist eine zusätzliche externe Begleitung durch die Kommunale Konfliktberatung sinnvoll und welche Vorteile bringt sie? Diese Fragen werden unsere diesjährige Interkommunale Fachtagung leiten. Dabei stehen Sie und Ihre Kommunen im Fokus!
-
24.09.2024
Universelle Prävention von Islamismus soll überall stattfinden: im Sportverein, in der Schule, der Kommune, bei der Polizei oder in der Medien- und Jugendarbeit. Das hat sie mit der Prävention anderer Formen von Extremismus gemeinsam. Gefragt sind also in erster Linie die Fachkräfte in den einzelnen Feldern wie etwa Lehrer*innen, Präventionsbeamte oder (häufig ehrenamtliche) Trainer*innen. An sie – und an ihre Ausbilder*innen in den Institutionen und Regelstrukturen – richtet sich unsere Fachtagung.
Wie können Fachkräfte Jugendliche stärken und präventiv wirken? Was müssen sie zu Islam und Islamismus wissen, womit fühlen sie sich überfordert? Welche Chancen bieten sich und wie können Fachkräfte Stigmatisierung und Diskriminierung „ihrer“ Jugendlichen vermeiden? Welche positiven und negativen Erfahrungen gibt es in den Handlungsfeldern der universellen Islamismusprävention?
Die Fachtagung richtet sich an Personen aus dem Bereich der Islamismusprävention und an Fachkräfte aus den Arbeitsfeldern Medienpädagogik, Polizei- und Jugendarbeit, politische Bildung, Schule und Sport, sowie an Vertreter*innen von Kommunen und Behörden.
-
20.09.2024
Die Coronapandemie hat als zeitlich und räumlich entgrenzte Krise das kommunale Krisenmanagement vor vielfältige Herausforderungen gestellt. Statt einer erhofften Phase der Entspannung nach der Pandemie stellten sich nahtlos neue Aufgaben durch die Aufnahme von Geflüchteten, drohenden Energiemangel, steigende Inflation und eine allgemein kompliziertere Sicherheitslage. Was bedeuten diese entgrenzten und sich überlagernden Krisen für das kommunale Krisenmanagement und die Krisenstabsarbeit? Wie können Kommunen mit den Dauerbelastungen umgehen und wie lassen sich diese in der Verwaltung besser steuern? Wie gehen Kommunen in Dauerkrisen mit unterschiedlich betroffenen sozialen Gruppen um? Und wie organisiert man den Alltag im latenten Ausnahmezustand?
Diesen und weiteren Fragen geht das Seminar mit Impulsen aus Wissenschaft und kommunaler Praxis nach.
Das Seminar wird in Kooperation mit dem Deutsch-Europäischen Forum für Urbane Sicherheit (DEFUS) durchgeführt.
-
26.09.2024
Tischkickerturnier trifft Teamtalk. Gemeinsam reden und was ins Rollen bringen. Dafür kombiniert das Projekt Schnack’n Roll ein spaßorientiertes Tischkickerturnier mit lockereren Diskussionsrunden zu Diversitätsthemen und Fragen politischer Beteiligung.
Mit mobilen Tischfußballtischen werden in Niedersachsen und Bremen Vereine, Teams und Gruppen aller Art aufgesucht, Menschen an die Tische und gemeinschaftsrelevante Themen auf den Tisch gebracht.
Die Diskussionsrunden werden von im Projektrahmen geschulten Train-the-Trainer*innen moderiert und schaffen wechselseitige Anerkennung und einen partizipativ-lebensweltorientierten Austausch zu Ideen und Visionen eines gelingenden Miteinanders im Team, Dorf, Kiez und darüber hinaus.
Wie bauen politische Akteure plattformübergreifend Communities auf? Welche Rolle spielt Videoaktivismus auf YouTube? Und welche Verlinkungsstruktur steckt hinter der Telegram-YouTube-Pipeline?
In der neuesten Ausgabe von Machine Against the Rage untersucht die Bundesarbeitsgemeinschaft »Gegen Hass im Netz« auf breiter Datenbasis, wie rechtsalternative Akteure mit crossmedialen Strategien ihre Inhalte vom politischen Rand in den Mainstream bringen. Dafür spielt YouTube eine herausragende Rolle.
Beim NETTZ.Gespräch zeigt Netzwerkforscher Harald Sick (BAG »Gegen Hass im Netz«), ausgehend vom Messenger-Dienst Telegram, inwieweit die Videoplattform YouTube aus dem rechtsalternativen Ökosystem nicht mehr wegzudenken ist. Wie rechte Influencer*innen sich diese Netzwerke zunutze machen, diskutieren wir im Anschluss gemeinsam mit der WDR-Redakteurin Nadja Bascheck. Sie hat in einer Y-Kollektiv-Investigativrecherche und in Zusammenarbeit mit Correctiv die Funktionsweisen des rechten Influencer-Business auf Youtube aufgedeckt.
Wie sieht eine professionelle und menschenrechtsorientierte Beratung im Kontext von Demokratiegefährdung und Rechtsextremismus aus? Was müssen Fachkräfte, die in diesem Themenfeld arbeiten, beachten? Mit welchen Herausforderungen sind sie konfrontiert? Und wie können sie damit umgehen? Diese Fragen stehen im Fokus einer zertifizierten und berufsbegleitenden Weiterbildung, die der Bundesverband Mobile Beratung und die Alice Salomon Hochschule Berlin von 2024 bis 2026 zum dritten Mal gemeinsam anbieten.
Die Weiterbildung richtet sich an Berater*innen, Sozialarbeiter*innen und Sozialwissenschaftler*innen, die im Bereich Demokratiegefährdung und Rechtsextremismus arbeiten oder arbeiten möchten. Angesprochen sind u.a. Mobile Berater*innen, Streetworker*innen sowie Fachkräfte aus der Bildungs- und Jugendarbeit, der Familienberatung und der Quartiers- und Gemeinwesenarbeit. In sieben aufeinander aufbauenden Modulen werden die Teilnehmer*innen dazu angeregt, sich mit eigenen Positionen, Erfahrungen und Handlungsroutinen kritisch auseinanderzusetzen und neue Perspektiven für eine professionelle Beratungsarbeit zu entwickeln.
Themen, die in den Modulen diskutiert werden, sind u.a.: Demokratiegefährdung im urbanen und ländlichen Raum, Rechtsextremismus und Familie, juristische Fragen im Kontext von Beratung und Netzwerkarbeit sowie Arbeitsbedingungen und Selbstsorge. Im Fokus stehen dabei immer konkrete Fälle aus der Beratungsarbeit. Zudem werden in allen Modulen machtkritische sowie rassismus- und gendersensible Perspektiven auf Beratung vermittelt. Die Teilnahme an allen sieben Modulen ist verbindlich.
Zeitraum: 18.09.2024 – 27.06.2026
-
22.10.2024
Von September bis Dezember 2024 wird das IZRD in einem Pilotprojekt (digitale) Vorträge und Workshops für Fachkräfte der psychologischen Beratung und Psychotherapie sowie der Kinder- und Jugendpsychotherapie, Psychiater*innen und Mitarbeitende weiterer psychosozialer Berufe anbieten. Das Projekt ist gefördert von der Bundeszentrale politische Bildung.
Im Fokus steht der Umgang mit weltanschaulich-konflikthaften und extremistischen Einstellungen sowie damit verknüpften (belastenden) Herausforderungen von Klient*innen bzw. Patient*innen.
-
18.09.2024
Flucht und Vertreibung im Kontext von Gewaltkonflikten und Naturkatastrophen nehmen seit Jahren kontinuierlich zu. Gleichzeitig gewinnen rechtspopulistische Stimmen gegen Zuwanderung und schutzsuchende Menschen in vielen Staaten immer mehr Aufmerksamkeit und Einfluss.
Die 5. Konferenz des Netzwerks Fluchtforschung will die globalen, regionalen und lokalen Zusammenhänge von Flucht und Vertreibung beleuchten, einschließlich der Ursachen und Trends, die Menschen zu Mobilität, aber auch Immobilität zwingen. Konferenzbeiträge können sich vielfältigen Fragen widmen, wie den geopolitischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und weiteren Faktoren, die zu Flucht und Vertreibung weltweit beitragen. Fallstudien aus verschiedenen Ländern, Regionen und Kommunen können zeigen, wie diverse Akteur*innen auf Zuwanderung reagieren und welche Strategien sich im Umgang mit den Herausforderungen von Flucht und Vertreibung etabliert haben.
-
17.09.2024
Antisemitismus, Rassismus, Islamfeindlichkeit – Migrationsgesellschaft, Konkurrenzen, Bildungsstrategien: Diese Stichworte prägen zunehmend die gesellschaftliche, wissenschaftliche und pädagogische Auseinandersetzung mit Vorurteilen und mit ausgrenzenden Denk- sowie Deutungsmustern. Vielfach schwankt die Diskussion zwischen Eifer und Orientierungslosigkeit, zwischen eindeutigen Positionen und Differenziertheit.
Die Tagungsreihe „Blickwinkel. Antisemitismus- und rassismuskritisches Forum für Bildung und Wissenschaft“ beleuchtet seit 2011 aktuelle Analysen, diskutiert innovative Bildungsansätze und setzt diskurskritische Akzente. Die Veranstaltungsreihe lädt zum Austausch und zur Vernetzung von Wissenschaft und pädagogischer Praxis ein.
Die 15. Blickwinkel-Tagung wird vom 16. bis zum 17. September 2024 in Erfurt stattfinden.
Dass Digitalisierung die Demokratie verändert, ist heutzutage ein Allgemeinplatz. Von den Sozialen Medien über ChatGPT: Die Digitalisierung prägt Alltag und Politik immer stärker; ihre Dynamik kann dabei Gefühle gesellschaftlicher und politischer Ohnmacht wecken. In einer Gesellschaft, in der Antisemitismus und Rassismus tief verankert sind, stellt sich unweigerlich die Frage: Was bedeutet es, wenn „die Maschine“ von „uns“ lernt und andersherum? Die handlungsorientierte politische Bildung steht also vor großen Herausforderungen. Antisemitische und rassistische Diskurse, Praktiken und Politiken lassen sich nicht adressieren, ohne ein Verständnis für die Verbreitungswege „im Netz“, ihre Funktionsweisen und Algorithmen zu haben. Um von den digitalen Entwicklungen nicht überholt zu werden, ist es daher entscheidend, diese genau im Blick zu haben, sie zu verstehen und dann mitzugestalten, statt nur darauf zu reagieren.
Muslimisch gelesenen Menschen begegnen im Alltag Zuschreibungen und Diskriminierungen, die eine vermeintliche religiöse Bindung als unwandelbar und mit dem Leben in einer modernen, säkularisierten Gesellschaft unvereinbar interpretieren.
Bei kaum einer anderen Diskriminierungsform wird so intensiv über Begrifflichkeiten gestritten. Sollen wir von antimuslimischem Rassismus oder von Islamfeindlichkeit, Muslimfeindlichkeit oder Islamophobie sprechen? Wo endet legitime Religionskritik, wo beginnt Rassismus? In der Fortbildung diskutieren wir, wie wir im (sozial-)pädagogischen Berufsalltag auf antimuslimischen Rassismus reagieren können, sensibilisieren für Erscheinungsformen und geben Hinweise auf Anlaufstellen und Beratungsangebote in Berlin.
-
13.09.2024
ChatGPT und andere KI-Anwendungen präsentieren sowohl Herausforderungen als auch Chancen für die Demokratiebildung in Schulen. Der Vortrag behandelt sowohl die Neudefinition der Ziele von überfachlicher Demokratiebildung im KI-Zeitalter als auch die Einbeziehung von Schüler:innen in die Umgestaltung von Schule und Unterricht. Dafür werden Einblicke in das ProKIS-Projekt und ein Essener Teilprojekt im Verbund PrEval präsentiert und diskutiert. Das Publikum ist zur aktiven Teilnahme eingeladen.
Die jüngsten Wahlerfolge der AfD bei Europa-, Kommunal- und Landtagswahlen markieren einen Wendepunkt in der deutschen Nachkriegsgeschichte. In einigen Regionen wurde die Partei zur stärksten politischen Kraft. Dies gilt insbesondere in Teilen Ostdeutschlands. In den Medien ist von einem „politischen Erdbeben“ und „tektonischen Verschiebungen“ die Rede, deren langfristige Auswirkungen noch nicht absehbar sind.
Teilweise wird befürchtet, dass diese Wahlergebnisse zur weiteren „Normalisierung“ der AfD beitragen könnten: Dabei werden Positionen, die früher als extremistisch galten, von der Mitte der Gesellschaft zunehmend akzeptiert. Außerdem wird vor den möglichen negativen psychosozialen, ökonomischen und wohlfahrtsstaatlichen Konsequenzen gewarnt, sollten sich AfD-Politiken durchsetzen. So könnte eine noch restriktivere Migrationspolitik und Diskriminierung bestimmter Gruppen den Fachkräftemangel verschärfen und ausländische Investoren abschrecken.
Eine neue Kurzstudie des DeZIM-Instituts mit dem Titel „Angst, Ablehnung und Abwanderungspläne: Die gesellschaftlichen Folgen des Aufstiegs der AfD“ widmet sich diesem Thema empirisch. Die Ergebnisse zeigen: Die Mehrheit der Befragten sieht die AfD als demokratiefeindlich und rassistisch an. Besonders die Pläne zur sogenannten Remigration – der massenhaften Ausweisung von Menschen – wecken Angst in breiten Teilen der Bevölkerung. Menschen mit und ohne Migrationshintergrund denken darüber nach, innerhalb Deutschlands oder ins Ausland um- bzw. wegzuziehen.
Die Studie von Sabrina Zajak, Fabio Best, Gert Pickel, Matthias Quent, Friederike Römer, Elias Steinhilper und Andreas Zick erscheint am 06. September 2024.
Ausgehend von den Ergebnissen der repräsentativen Bevölkerungsbefragung möchten wir in einer Gesprächsrunde mit Vertreter*innen aus Zivilgesellschaft und Wissenschaft diskutieren. Dazu laden wir Sie herzlich ein.
Nach dem Erfolg unseres Onlineformats "Tipps und Tricks" in den letzten Jahren, haben wir das Stiftungsforum als ein analoges Zusammenkommen für unser Projektnetzwerk entwickelt. Euch erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit spannenden Workshops, wertvollen Netzwerkmöglichkeiten und leckerem Essen.
Freut euch auf Themen wie Fundraising, Diversität, Changemanagement, Digitalisierung und Social Media für Vereine.
Eine Besonderheit dieses Jahr: für die besonders beliebten Themen bieten wir dieses Jahr auch Vertiefungsworkshops an, damit alle neue Inhalte mit nach Hause nehmen können.
-
05.09.2024
Brücken verbinden Menschen und führen zusammen. Auch Gedanken, Einstellungen oder Ideologien können verbindende Elemente sein und als Brücken dienen. Antifeminismus, Antisemitismus, Verschwörungserzählungen oder auch Sexismus und Queerfeindlichkeit können Brücken zwischen radikalisierten Gruppen schlagen und zu Wechselwirkungen führen. Für die politische Bildungsarbeit und die Präventionsarbeit ist es daher sinnvoll, diese Phänomene in den Blick zu nehmen.
Vor welche Herausforderungen stellen sogenannte Brückennarrative die politische Bildungsarbeit und die Präventionsarbeit? Was sind Chancen und Grenzen phänomenübergreifender Ansätze? Was können Praxis, Wissenschaft und Sicherheitsbehörden mit Blick auf diese Phänomene voneinander lernen? Wie können wir uns dazu austauschen? Das BarCamp bietet Akteurinnen und Akteuren aus der politischen Bildungsarbeit und der Präventionsarbeit den Raum gemeinsam über diese Themen ins Gespräch zu kommen. Dabei sind die Teilnehmenden herzlich eingeladen eigene Fragestellungen, Themen oder Anliegen in das Programm einzubringen.
Komplexe Probleme können nur dann bewältigt werden, wenn wir ab und zu einen Perspektivwechsel vornehmen und uns über den Tellerrand des eigenen Arbeitsalltags hinweg inspirieren lassen. Das BarCamp bietet einen Raum zum Austausch, zur Reflexion und zum Zusammen.Denken.
Wie wird ein differenzierter Diskurs und Umgang mit Geflüchteten in Politik und Öffentlichkeit wieder möglich? Zwei Tage nach den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen möchten wir diese Frage diskutieren. Wenn alle großen Parteien in den beiden Bundesländern – wenn nicht bundesweit – eine restriktivere Politik gegenüber Geflüchteten versprechen, dann antizipieren und verstärken sie eine Stimmung in der Bevölkerung, die die Aufnahme und Integration von Schutzsuchenden ablehnt. Doch weder aktuell noch historisch waren die Einstellungen gegenüber Geflüchteten immer und überwiegend negativ. Was braucht es also, um wieder eine differenziertere Debatte zum Thema Flüchtlingsschutz, wenn nicht gar eine erneuerte Willkommenskultur, zu ermöglichen?
Prof. Klaus Neumann hat in einer ausführlichen historischen Studie den Umgang mit Geflüchteten – unter anderem in Südsachsen und Hamburg-Altona – seit der Wiedervereinigung untersucht. Er wird zentrale Befunde dazu aus seinem neuen Buch „Blumen und Brandsätze. Eine deutsche Geschichte, 1989-2023“ vorstellen.
Im Anschluss diskutieren wir die Lehren aus dieser Geschichte und mögliche Wege vorwärts mit ihm und Vertreter*innen der Zivilgesellschaft aus Sachsen und Hamburg.
Die Schulung richtet sich an angehende Fachkräfte und Fachkräfte, die neu in die Arbeit mit geflüchteten jungen Menschen eingestiegen sind oder einsteigen.
Qualifizierung, Austausch und Reflexionen zur eigenen Arbeitshaltung sind in dem Arbeitsbereich unerlässlich. Die Grundlagenschulung vermittelt praxisnah jugendhilferechtliche und asyl- und aufenthaltsrechtliche Grundlagen, Informationen zu Vormundschaft und ihrer Rolle im Asylsystem sowie zur Begleitung und Übergangsgestaltung von und mit jungen volljährigen Geflüchteten. Neben den Schulungsinhalten wird es Raum für interaktiven Austausch und zur Reflexion der Herausforderungen und Haltungen im Arbeitsalltag geben.
-
04.09.2024
Die Terrorangriffe vom 7. Oktober 2023 und die darauffolgende Invasion Israels in Gaza haben die internationale Gemeinschaft stark polarisiert. Angesichts der Präsenz propalästinensischer und potenziell antisemitischer Positionen unter südosteuropäischen Intellektuellen sollen gegenwärtige Diskurse und gesellschaftliche Kontexte zu Muslimfeindlichkeit und Antisemitismus in Südosteuropa ausgelotet werden. Gefragt wird zudem nach der Aushandlung dieser Debatten in Deutschland.
August 2024
Wie kann die Integration Geflüchteter in Bildungsprozesse, in Ausbildung und Arbeit in ländlichen Räumen gelingen? Damit beschäftigt sich eine Fachtagung des ONnFIT-Projekts der Regionen der hessischen Landkreise Hersfeld-Rotenburg, Fulda und Werra-Meißner sowie des Hessischen Flüchtlingsrats.
Neben Stimmen aus der Migrations- und Arbeitsmarktforschung bieten eine Reihe von Workshops die Gelegenheit, mehr zu Strategien der Aufenthaltsstabilisierung, der Qualifizierung und des beruflichen Einstiegs zu erfahren. Eingeladen sind haupt- und ehrenamtliche Akteur*innen aus Arbeitsagenturen, Jobcentern, Behörden, Verbänden, Unternehmen, Bildungseinrichtungen und aus der Flüchtlingsberatung.
-
06.06.2025
Noch immer sind Frauen* in der öffentlichen Verwaltung, in Verbänden und Kommunalpolitik von antifeministischen Äußerungen betroffen. Oftmals sehen sie ihre gleichstellungspolitischen Tätigkeiten auch innerhalb der eigenen Institutionen in Frage gestellt und müssen sich gegenüber persönlichen Anfeindungen behaupten. Die Intensität der Angriffe durch Akteur*innen hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Es stellt sich die Frage, warum Menschen Verantwortung übernehmen und Ämter bekleiden sollten, wenn sie damit die Möglichkeiten erhöhen, diskriminiert und bedroht zu werden.
Dies hätte den Rückzug von vor allem mehrfach marginalisierten Frauen* aus öffentlichen Ämtern und aus ehrenamtlichem Engagement zur Folge und steht einer demokratischen Gesellschaft entgegen. Mit dieser modularen Qualifizierungsreihe sollen Frauen* durch praxisnahe Trainings mit vorangehenden theoretischen Einheiten zu Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit (GMF), den spezifischen Projektionen und Abwehrmechanismen von Antifeminismus und Rassismus und deren intersektionale Verknüpfung sensibilisiert und in ihren Handlungsmöglichkeiten gestärkt werden.
Juli 2024
„Vielfalt willkommen! Sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität in Deutschland – Themenheft für den Unterricht in Integrationskursen“ Im Curriculum für Integrationskurse sind zwei Unterrichtsstunden zu diesem Thema vorgeschrieben. Dies sind die Inhalte der Fortbildung für Integrationskursleitende:
- Einführung in geschlechtliche und sexuelle Identitäten.
- Die Verfolgungssituation in den Herkunftsländern – Warum fliehen LSBTI?
- Die einzelnen Kapitel des Lehrbuchs sowie das Lösungsheft.
- Vertiefung des Gelernten durch interaktive Fragen, die sich mit Fragen und Ablehnung von Unterrichtsinhalten zum Thema LSBTI* und Gender beschäftigen.
In Brandenburg lebt ein Großteil der asylsuchenden Menschen in Gemeinschaftsunterkünften, die kaum Privatsphäre bieten. Die Aufnahme- und Lebensbedingungen für geflüchtete Menschen in Brandenburg unterscheiden sich je nach Art und Ort der Unterbringung stark. Der Umzug in eigene Wohnungen wird durch gesellschaftliche, politische und bürokratische Hürden erschwert, obwohl privater Wohnraum entscheidend für ein erfolgreiches Ankommen vor Ort ist.
Neben den Wohnbedingungen selbst, sind auch die infrastrukturellen Gegebenheiten von zentraler Bedeutung. Diese reichen von der Anbindung an Communities bis hin zu Einkaufs- und Bildungsmöglichkeiten, Sicherheit, medizinischer Versorgung sowie dem Vorhandensein von Kindergärten, Schulen und Arbeitsplätzen. All diese Faktoren beeinflussen maßgeblich, ob Menschen sich an einem Ort niederlassen und dort bleiben möchten.
Der Fachtag widmet sich nicht nur den Herausforderungen, sondern auch den Chancen, die der ländliche Raum bietet. Gemeinsam möchten wir erkunden, was ländliche Räume in Brandenburg auszeichnet, warum Menschen gehen oder bleiben möchten. Welche Formen der Teilhabe sind erforderlich, um ein langfristiges Bleiben zu ermöglichen? Wie kann das Leben in ländlichen Räumen so gestaltet werden, dass es sowohl für geflüchtete Menschen als auch für die bestehenden Gemeinschaften attraktiv ist?
-
04.07.2024
"Mit dem Brandbrief zweier Lehrer*innen, die rechtsextreme Vorfälle an einer Brandenburger Oberschule bekannt machten, hat eine Entwicklung öffentliche Aufmerksamkeit erhalten, die leider kein Einzelfall ist. Auch die Schüler*innenvertretungen der ostdeutschen Bundesländer beklagten zuletzt eine Zunahme rechtsextremer Fälle an Schulen sowie die Untätigkeit und Überforderung von Lehrer*innen und Schulleitungen im Umgang damit. Die gerade veröffentlichte „Trendstudie Jugend in Deutschland 2024“ beschreibt ebenfalls einen Rechtsruck bei Jugendlichen. Demnach hat sich das Potenzial für rechtsextreme Einstellungen unter Jugendlichen deutlich verstärkt. In der Studie zeigt sich außerdem, dass junge Menschen zwischen 14 und 29 Jahren äußerst pessimistisch in ihre persönliche Zukunft blicken. Die vielen gesellschaftlichen Krisen führen bei Jugendlichen zu einem hohen Niveau psychischer Belastungen wie Stress, Hilflosigkeit und Überforderung.
Welche Rolle kann die Jugend- und Sozialarbeit unter diesen Voraussetzungen in der Prävention und Auseinandersetzung mit rechtsextremen, menschen- und demokratiefeindlichen Einstellungen spielen? Jugend- und Sozialarbeiter*innen sollen Jugendliche bei persönlichen Belastungen unterstützen. Sie stehen im direkten Kontakt mit Jugendlichen, können Bindungen aufbauen und verfügen über Gestaltungs- und Handlungsspielräume in der pädagogischen Arbeit. Gleichzeitig besteht ihr Auftrag in der Vermittlung weltoffener und demokratischer Haltungen bei Kindern und Jugendlichen. Auch wenn rechtsextreme, menschenverachtende oder demokratiefeindliche Haltungen zu Tage treten, muss Jugendarbeit deshalb professionell und handlungsfähig bleiben. Welche Ansätze und Zugänge es hier gibt und welche Erfahrungen in der Jugend- und Sozialarbeit im Umgang mit Rechtsextremismus bestehen, wollen wir am 3. und 4. Juli 2024 im Rahmen einer zweitägigen Praxiswerkstatt bei Fachvorträgen, Workshops und Austauschformaten erarbeiten."
Juni 2024
Gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Transformationsprozesse stellen Kommunen in Deutschland vor die Herausforderung, die unterschiedlichen Interessen ihrer Bürger*innen auszuhandeln und miteinander in Einklang zu bringen. Insbesondere Anfang des Jahres 2024 wurden Konflikte in Deutschland vor allem in Form von öffentlichem Protest auf die Straße getragen. Je nach Lesart sind diese Proteste Symbol für eine Krise unserer repräsentativen Demokratie oder Ausdruck eines gestiegenen politischen Gestaltungsanspruch seiner Bürger*innen. Aus Perspektive der Konfliktbearbeitung haben Proteste vor allem eine Funktion: sie machen Konflikt sichtbar und bieten somit auch eine Chance, sie zu bearbeiten. Gemeinsam möchten wir beim digitalen Fachtag „Stadt, Land, Protest: kommunale Dynamiken gesamtgesellschaftlicher Bewegungen“ des K3B – Kompetenzzentrum Kommunale Konfliktberatung des VFB Salzwedel e.V. am 25. Juni 2024 diskutieren, wie sich gesamtgesellschaftlich begründete Proteste auf kommunales Konfliktgeschehen auswirken. Welche Dynamiken und Konfliktpotenziale werden beobachtet, (wie) werden bestehende Konflikte durch neue Proteste beeinflusst, welche Konflikte entstehen durch diese und wie können Kommunen mit Protesten umgehen? In acht spannenden Diskussionsforen werden einzelne Phänomene im Themenfeld „Protest“ aus kommunaler, praktischer und wissenschaftlicher Perspektive beleuchtet.
Die Veranstaltung richtet sich an Interessierte und Fachpublikum: Akteure aus Kommunen und Zivilgesellschaft, Wissenschaftler*innen, Netzwerkpartner*innen auf Landes- und Bundesebene und Akteure der Konfliktbearbeitung. Der digitale Fachtag will die Teilnehmenden durch Impulse zum Austausch von Erfahrungen, Analysen und Handlungsoptionen dazu einladen, ihre Perspektiven auf das Thema einzubringen und gemeinsam zu diskutieren.
-
22.06.2024
Seit vielen Jahren – und insbesondere nach den Massakern der Hamas am 7. Oktober 2023 – explodiert im Internet und in den sozialen Medien der Hass auf Jüdinnen und Juden und auf den Staat Israel. Seien es die Anschläge vom 11. September 2001, Migrationsbewegungen, Finanzkrisen oder die Corona-Pandemie: „Der Jude“ wird als Sündenbock für diese und andere Entwicklungen verantwortlich gemacht.
Personen, die ihren Hass im Netz ausbreiten, bewegen sich häufig in Echokammern und bestätigen sich gegenseitig. Dennoch wirken solche extremen Meinungen weit über diese Filterblasen hinaus und sind permanent abrufbar. Erwachsene sowie Kinder und Jugendliche werden, häufig ohne eine adäquate Medienkompetenz ausgebildet zu haben, im Internet und auf sozialen Plattformen wie Instagram, Facebook oder TikTok nahezu ungefiltert mit antisemitischen, rassistischen, verschwörungsideologischen, terrorverherrlichenden und sexistischen Inhalten konfrontiert.
Die Studientagung beschäftigt sich mit dieser besorgniserregenden Entwicklung, die das Leben von Jüdinnen und Juden konkret gefährdet und den Frieden in demokratischen Gesellschaften immer weiter destabilisiert.
Wo Menschen zusammenleben entstehen Konflikte. Auch die großen gesellschaftlichen Krisen schlagen sich oft als erstes vor Ort in den Städten und Gemeinden nieder. Kleine wie große Konflikte aufzufangen, aber auch das Zusammenleben in Vielfalt zu gestalten, stellt verschiedene Akteure vor Ort oft vor Herausforderungen. Die Fortbildung möchte Wege aufzeigen, diesen zu begegnen und im Rahmen der eigenen Möglichkeiten Konflikte in der Kommune anzugehen.
Teilnehmende stärken ihre kommunikativen Fähigkeiten und erarbeiten sich einen analytischen Blick auf Konflikte in ihrem jeweiligen kommunalen Kontext. Sie erlernen, wie Konflikte genutzt werden können, um gesellschaftliche Veränderungsprozesse zu gestalten, und welche Rolle sie dabei einnehmen können. Ein fundiertes Konfliktverständnis hilft nicht nur, die Dynamiken hinter den Konflikten zu entschlüsseln und Polarisierung zu begegnen. Es unterstützt auch dabei, verschiedene Positionen, Interessen und Bedürfnisse in den Blick zu nehmen und dazu passende Strategien zu entwickeln, die über das eigene gewohnte Handeln hinaus gehen.
An wen richtet sich die Fortbildung?
Diese Fortbildung richtet sich an Personen, die im kommunalen Raum arbeiten oder engagiert sind und auch mit integrationsbezogenen Themen befasst sind. Sie gestalten in ihrer jeweiligen Rolle das kommunale Zusammenleben mit und möchten souveräner mit Konflikten in ihrer Stadt, ihrer Gemeinde oder ihrem Landkreis umgehen. Ob Sozialarbeiter, Kontaktbeamtin bei der Polizei, ehrenamtlich Engagierte im Integrationsbeirat, Vereinsbetreuer, Pastorin oder Koordinator von Geflüchteten-Unterkünften – sie alle verbindet der Wille, Verantwortung zu übernehmen, Sicherheit im Umgang mit kommunalen Konflikten zu gewinnen und konkrete Ideen für die Konfliktbearbeitung zu entwickeln.
Studien aus Großbritannien zeigen, dass nicht nur repressive, sondern auch präventive Maßnahmen kontraproduktive nicht-intendierte Effekte hervorrufen können, indem etwa Präventionsstrategien zur Verdachtskonstruktion sowie Stigmatisierung muslimischer und/oder migrantischer Minderheiten führen können. Ein rassismuskritischer Blick auf die Islamismusprävention hierzulande erscheint somit notwendig.
Daher widmet sich das Teilprojekt »Gemeinschaften unter Verdacht – Haben proaktive Sicherheitspolitik und Extremismusprävention nicht-intendierte rassistische Nebeneffekte?« der Frage, ob die (sogenannte universelle und selektive) Islamismusprävention rassistische Effekte auf ihre Zielgruppen hat und wenn ja, wie diese vermieden werden können. Es wurden Programmpapiere der Extremismusprävention auf Bundes- und Landesebene analysiert, Interviews mit staatlichen und nichtstaatlichen Präventionsakteuren sowie mit ausgewählten Zielgruppen der Präventionsarbeit durchgeführt. Im Fachvortrag werden vorläufige Erkenntnisse des Projekts vorgestellt sowie zur Diskussion angeregt, wie innerhalb der Präventionslandschaft verankerten stigmatisierenden oder gar rassistischen Mechanismen langfristig entgegengewirkt werden kann.
Zu Beginn des Jahres hat die CORRECTIV-Recherche in aller Deutlichkeit gezeigt, welche Ziele die AfD und ihr rechtes Umfeld verfolgen. Bundesweit verzeichnen Beratungsstellen gegen Rechtsextremismus seitdem einen Anstieg an Anfragen: Immer mehr Menschen und Institutionen wollen wissen, was sie gegen die extreme Rechte und Ideologien der Ungleichwertigkeit – auch im eigenen Umfeld – tun können. Gleichzeitig könnte die AfD in den anstehenden Kommunalwahlen gerade auch in Thüringen noch weiter an Stimmen gewinnen und ihren Einfluss auf kommunaler Ebene ausbauen.
Beratungsstellen sind in dieser Situation enorm herausgefordert. Je größer die Bedrohung durch den Rechtsextremismus, desto stärker muss sich Beratung positionieren. Wir diskutieren, welche Erfahrungen die Mobilen Beratungen gegen Rechtsextremismus in dieser aktuellen Situation machen, insbesondere in Thüringen sowie in ländlichen Räumen bundesweit. Welche Erkenntnisse bietet die Mobile Beratung auf der Grundlage dieser Erfahrungen, auch für andere Beratungsstellen im Themenfeld? Und welche Rollen spielen dabei die Themen Macht, Machtkritik und gesellschaftlicher Status? In diesem Zusammenhang wollen wir auch darüber sprechen, welche Impulse sich aus der Verbindung von wissenschaftlicher Forschung und praktischer Erfahrung für eine Weiterentwicklung der Beratungsarbeit gewinnen lassen.
Geflüchtete junge Menschen treffen in Deutschland auf ein System, in dem ihre Rechte gefährdet sind, rassistische Stimmen immer lauter werden und politische Entscheidungen zugunsten von mehr Abschiebungen und Abschottung getroffen werden. Auch im Kontext der Jugendhilfe gibt es sich weiter verschärfende Missstände bei der Unterbringung, Betreuung und Unterstützung von unbegleiteten minderjährigen Personen und jungen Volljährigen. Vor diesem Hintergrund ist es für Personen aus dem Unterstützungssystem wichtig, sich tagtäglich auf die Professionsstandards und kinder-und menschenrechtlichen Grundlagen der eigenen Arbeit zurückzubesinnen, diese auch entgegen team- und trägerinterner Verfahrensvorgaben aufrecht zu erhalten, politische Missstände anzuprangern – kurz, Haltung zu zeigen, um parteiisch an der Seite der jungen Menschen zu stehen. In welchen Bereichen ist dies aktuell besonders wichtig? Wie kann dies gelingen?
Unser Fachtag widmet sich diesen sowie weiteren Fragen. Konkret blicken wir darauf, wie in unterschiedlichen Bereichen in und außerhalb der Jugendhilfe in der Arbeit mit jungen Geflüchteten Haltung gezeigt werden kann, sei es in den Sammelunterkünften, der Öffentlichkeitsarbeit oder dem Hilfeplan-Verfahren. Im Forum und in verschiedenen Workshops wollen wir Problemfelder gemeinsam reflektieren und bearbeiten. Themen werden u.a. der dreijährige Geburtstag des Kinder- und Jugendstärkungsgesetz und die Situation von Mädchen und FLINTA*-Personen in Sammelunterkünften sein.
Queere BiPoC und Geflüchtete sind von Queerfeindlichkeit betroffen und erleben parallel dazu Rassismus in verschiedenen Formen bis hin zu gewalttätigen Übergriffen.
Diese sich überlagernden Diskriminierungserfahrungen führen zu psychischen sowie seelischen Belastungen. Gemeinsam möchten wir mit Aktivist:innen, ehrenamtlich Engagierten sowie Fachpersonen über queersensible Beratungs- und Behandlungsansätze bei BiPoC und Geflüchteten mit seelischen Belastungen diskutieren. Am Nachmittag wird es zwei Workshops geben, einer für Menschen mit Rassismuserfahrungen (BIPoC Saferspace) und einen zweiten für Fachkräfte und Interessierte.
Die Veranstaltung wird von Rat und Tat Bremen e. V., Queeraspora e.V., der Koordinierungsstelle für gesundheitliche Chancengleichheit Bremen (KGC) sowie der LVG & AFS Niedersachsen Bremen ausgerichtet.
In Deutschland stellt der gleichberechtigte Zugang zur Gesundheitsversorgung eine der zentralen sozialen Herausforderungen unserer Zeit dar. Speziell die Gruppe der Menschen ohne Krankenversicherungsschutz sieht sich mit zahlreichen Barrieren im Gesundheitssystem konfrontiert – eine Realität, die sowohl individuelles Leid verursacht als auch gesellschaftliche Auswirkungen hat.
Die Fachtagung „Zugang zur Gesundheitsversorgung für Menschen ohne Krankenversicherungsschutz“ zielt darauf ab, diese Problematik in den Mittelpunkt eines transdisziplinären Dialogs zu rücken. Durch die Versammlung von Expert:innen aus den Bereichen von Wissenschaft und Praxis, konzentriert sich die Fachtagung auf die Herausforderungen und Lösungen im Bereich der Gesundheitsversorgung für Personen ohne Krankenversicherungsschutz. Sie bietet eine Plattform um aktuelle Forschungsergebnisse, bewährte Praktiken und politische Initiativen zu diskutieren, die darauf abzielen, den Zugang zur Gesundheitsversorgung für diese vulnerable Bevölkerungsgruppe zu verbessern.
Inhaltliche Schwerpunkte der Fachtagung
- Barrieren und Herausforderungen im Zusammenhang des Zugangs zur Gesundheitsversorgung,
- Auswirkungen fehlender Gesundheitsversorgung auf Individuen und die öffentliche Gesundheit sowie
- Modelle und Programme zur Bereitstellung von Gesundheitsdiensten für Personen ohne Krankenversicherungsschutz.
Geflüchtete sind oft über einen sehr langen Zeitraum erheblichen Belastungssituationen ausgesetzt, die mitunter im Herkunftsland beginnen und gegebenenfalls über eine (lebens)gefährliche ungewisse Flucht andauern. Hinzu kommen Stressoren, die sich speziell aus den Umständen der Flucht und den Alltagsbedingungen am neuen Wohnort ergeben und zusätzlich negative Auswirkungen auf ihre psychische Gesundheit haben.
Die Fortbildung vermittelt Kenntnisse zur Entstehung und den psychosozialen Folgen traumatischer Erfahrungen und bietet Fachkräften Unterstützung in der Begleitung und Beratung traumatisierter Personen. Es besteht die Möglichkeit zur Vorstellung und Diskussion von eigenen Fällen.
Die Stadt Hameln und die Koordinierungsstelle Quartiersentwicklung und Gemeinwesenarbeit – „Hameln kann‘s“ laden zum niedersachsenweiten Fachtag ein. Der Fachtag richtet sich an Partnerprojekte aus der Modellförderung und dem Bündnis Gute Nachbarschaft, Menschen aus den Quartieren und Akteursnetzwerken sowie an Fachkräfte aus Gemeinwesenarbeit, Quartiersmanagement, Sozialer Arbeit und Stadtentwicklung.
Integriert in den Fachtag findet auch das BIT – Bewohner:innen-Initiativen-Treffen für einen landesweiten Austausch von und für Bewohner:innen aus Niedersachen zusammen mit der LAG Praxisnetzwerk Soziale Stadtentwicklung Niedersachsen statt. Wir freuen uns auf aktive Bewohner:innen aus ganz Niedersachsen, denn wie sollten wir über den gesellschaftlichen Zusammenhalt diskutieren ohne die Menschen aus unseren Quartieren?
Religion und Religiosität wird in einer pluralen, sich als säkular verstehenden Gesellschaft oft mit Unbehagen und Abwehr begegnet. Aussagen wie „Religion hat in der Schule nichts zu suchen!“ sind keine Seltenheit. Themen mit einem (vermeintlichen) religiösen Bezug sind für viele emotional aufgeladen und werden leidenschaftlich diskutiert – so auch an Berliner Schulen und in pädagogischen Räumen. Im Fokus stehen dabei häufig migrantisierte Jugendliche und Jugendliche, die verschiedene Zugänge und Verhältnisse zu Religion haben.
Wie wird Religiosität in der Schule verhandelt? Welche Rolle spielen hierbei Rassismus und andere Diskriminierungsformen? Was sind meine pädagogischen Handlungsmöglichkeiten?
Der Umgang mit dem Verdacht auf eine Kindeswohlgefährdung stellt eine herausfordernde Situation für Mitarbeiter:innen in Unterkünften für Geflüchtete dar.
Dieses Online-Seminar soll Mitarbeiter:innen in ihrer Handlungssicherheit im Umgang mit diesem Thema stärken. Zum einen geht es um das Erkennen von Gefährdungsmomenten für eine Kindeswohlgefährdung, zum anderen geht es um das Handeln auf der Grundlage der geltenden rechtlichen Grundlagen, wie zum Beispiel dem Bundeskinderschutzgesetz. Kinderschutz im Kontext von Flucht und Migration erfordert zudem ein migrations- und kultursensibles Arbeiten mit den Familien. Thematisiert werden auch die Kooperation mit den Eltern und ihren Kindern sowie die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt.
Eigene Fallbeispiele und Fragen können bereits im Vorfeld gerne formuliert und anonymisiert per Mail eingesendet werden.
Die Fortbildung richtet sich an Mitarbeiter:innen in kommunalen Gemeinschaftsunterkünften und Erstaufnahmeeinrichtungen sowie in kommunalen Behörden und Landesbehörden und Beratungsangeboten für geflüchtete Menschen.
-
05.06.2024
Im Spannungsfeld zwischen der aktuellen politischen Diskursverschiebung nach rechts und großen gesellschaftlichen Solidaritätsbekundungen gegen Rechtsextremismus und Rassismus soll diskutiert werden, wie es möglich ist, die Rechts- und Versorgungsansprüche geflüchteter Menschen zu verteidigen und gleichzeitig unter immer stärker begrenzten Bedingungen im Bereich der psychosozialen Versorgung von Geflüchteten weiter zu arbeiten.
Die gemeinsame Fachtagung von BAfF e.V. und medico international e.V. wird in der Woche vor der Europawahl und kurz vor den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg stattfinden – in einer Zeit, in der in einem europäischen Einwanderungsland Migration erneut zum Problem erklärt und das Asylrecht im Namen des Einhegens radikal rechter Stimmungsmache und Gewalt geopfert zu werden droht. Es gibt auf nationaler und europäischer Ebene eine massive Diskursverschiebung nach rechts, eine kaum für möglich gehaltene Enthemmung der Sprache und angesichts der multiplen Krisen unserer Zeit in weiten Teilen der Gesellschaft das Gefühl der Ohnmacht, Alternativlosigkeit und Erschöpfung.
Zugleich zeigen mehr als eine Million Menschen auf Demonstrationen gegen Rechtsextremismus, dass das Potenzial für Zusammenschlüsse der progressiven Zivilgesellschaft gegen Feindseligkeit und gesellschaftliche Spaltung so groß ist wie seit Langem nicht mehr.
-
05.06.2024
Mai 2024
Im Rahmen des Bleiberechtsprojekts CAST (ChancenAufenthalt in Sachsen-Anhalt) des Flüchtlingsrates findet am 30.05.2024 ein Workshop zum Chancen-Aufenthaltsrecht im Coffee to Stay in Bernburg statt. Ab 14 Uhr möchten die Veranstaltenden über das Chancen-Aufenthaltsrecht und die Wege sprechen, danach langfristige Bleibemöglichkeiten zu bekommen.
Der Workshop richtet sich ausschließlich an Menschen in Duldung und an Menschen, die bereits die Chancen-Aufenthaltserlaubnis haben.
Vor diesem Hintergrund hat der VNB in Kooperation mit der Stiftung Leben & Umwelt/ Heinrich-Böll-Stiftung Niedersachsen und dem Gunda-Werner-Institut in einer mehrmodularen Qualifizierungsreihe eine Gruppe von Teilnehmerinnen im Umgang mit Antifeminismus, Rassismus und weiteren Phänomenen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit (GMF) geschult und in praxisnahen Trainings sensibilisiert.
Der Fachtag bildet den Abschluss der Fortbildungsreihe und bietet Raum für einen intensiven Diskurs über aktuelle Ausprägungen des Antifeminismus und ihre Verknüpfung zu Rassismen. Neben zwei Impulsvorträgen werden in verschiedenen Workshops Inhalte vertieft sowie Handlungsempfehlungen im Umgang mit Antifeminismus und Rassismus geteilt. Die Veranstaltung ermöglicht einen Austausch zwischen Akteur*innen aus Kommunen, Verwaltung, Wissenschaft und Zivilgesellschaft und lädt zur solidarischen Vernetzung ein.
Wer etwas politisch verändern möchte, wird meist laut und macht Stimmung für die eigenen Ziele – das gilt für alle Seiten. Dabei vergessen wir häufig, dass eine große Anzahl von Menschen in unserer Gesellschaft der Vielen sich durch dieses laute Vorgehen nicht angesprochen fühlen – vielleicht sich sogar auch abschrecken lassen. Debatten werden als spalterisch oder polarisierter wahrgenommen, als sie es sind. Es gibt Menschen, die sich nicht so einfach einer Meinungsfront zuordnen lassen. Diese Gruppen werden in der Forschung je nach Schwerpunktsetzung wahlweise als beweglich, still oder unsichtbar gekennzeichnet, machen einen großen Teil der Bevölkerung aus und sind deshalb nicht zu vernachlässigen.
Potenziell finden sich auch in der beweglichen Mitte Menschen, die bereit sind, sich für eine vielfältige Gesellschaft einzusetzen. Sie teilen aber lange nicht alle Einschätzungen von Aktivist:innen, die sich für eine offene Gesellschaft engagieren. Häufig sind ihnen andere Themen wichtiger als die der Migrationsgesellschaft, etwa Fragen kultureller Traditionen und der eigenen sozialen Absicherung. Einige von ihnen sind aber auch anfällig für Strömungen, die mit Angst Politik machen und Sorgen der Menschen für populistische Zwecke kanalisieren. Gerade im „Superwahljahr 2024“ sollten wir hier genauer hinschauen.
Im Rahmen der Fachtagung setzen wir als Kompetenznetzwerk für das Zusammenleben in der Migrationsgesellschaft den Fokus auf das Themenfeld: Wer oder was ist die bewegliche Mitte? Warum sprechen andere von still oder unsichtbar und wie erreichen wir sie? Und welche Bedeutung ergibt sich daraus für die Wahlen?
Worauf sollte bei der Passbeschaffung geachtet werden?
In diesem Seminar erfahren Sie, was bei der Passbeschaffung wichtig ist und welche Fallstricke es gibt.
Dieses Seminar richtet sich an haupt- und ehrenamtliche Helfer*innen. Für dieses Seminar sind Deutschkenntnisse auf C1-Niveau empfohlen.
In dem Praxisforum aus dem Modellprojekt PartQ – Aufsuchende politische Bildung im Quartier werden auf die Potenziale und Grenzen demokratiestärkender Quartiersarbeit hinsichtlich der vielschichtigen Herausforderungen, die wir aktuell in unseren Quartieren beobachten. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf möglichen Synergien der Gemeinwesenarbeit und aufsuchender politischer Bildung.
In drei Arbeitsgruppen werden Schwerpunktthemen diskutiert und Empfehlungen für die Weiterentwicklung der Gemeinwesenarbeit, der aufsuchenden politischer Bildung im Quartier sowie der nötigen Strukturen abgeleitet:
- AG 1: Zielsetzungen und Standards von Gemeinwesenarbeit und aufsuchender politischer Bildung im Quartier
- AG 2: Strukturen demokratiestärkender Quartiersarbeit
- AG 3: Auswirkungen gesellschaftlicher Herausforderungen im Quartier
-
16.05.2024
-
15.05.2024
Der Nahostkonflikt wird regelmäßig von Akteuren aus dem islamistischen Spektrum instrumentalisiert, um für ihre Ideologie zu werben und Anhänger*innen zu mobilisieren. Vor dem Hintergrund des seit den Angriffen der Hamas auf Israel am 7. Oktober wieder aufgeflammten Nahostkonflikts wird dies erneut deutlich: sowohl auf Demonstrationen als auch in sozialen Medien werben Islamist*innen seitdem verstärkt für ihre Zwecke.
Doch nicht nur die Instrumentalisierung durch islamistische Akteure stellt eine Herausforderung für die zivilgesellschaftliche Präventionsarbeit dar. Auch werden politische, mediale und gesamtgesellschaftliche Diskussionen um die erneute Eskalation des israelisch-palästinensischen Konflikts emotional und polarisierend geführt und beeinflussen die Debatten im Arbeitsbereich. Dabei ist zu beobachten, dass sich in der Debatte auch andere Themen abbilden, für die der Konflikt einen Katalysator darstellt. Inwiefern schwingen hier auch Debatten über Antisemitismus und antimuslimischen Rassismus mit? Welche Auswirkungen hat das Aufflammen des Konflikts auf das islamistische Radikalisierungsgeschehen in Deutschland, aber auch international? Welche Herausforderungen ergeben sich hieraus für die zivilgesellschaftliche Demokratieförderung sowie Ausstiegs- und Distanzierungsarbeit?
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei.
Eine Anmeldung ist bis zum 26. April 2024 möglich.
Das vollständige Programm steht ebenfalls online zur Verfügung
Durch das Gesetz zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung, die Verordnung zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung, das Rückführungsverbesserungsgesetz, das Gesetz zur Bestimmung Georgiens und der Republik Moldau als sichere Herkunftsstaaten und das Gesetz zur Änderung des Bundesvertriebenengesetzes sind zahlreiche Rechtsänderungen im Asyl- und Aufenthaltsrecht kürzlich in Kraft getreten.
In der digitalen Schulung am 8.5.2024 wird ein Überblick der Gesetzesänderungen für Geflüchtete insbesondere durch das „Rückführungsverbesserungsgesetz“ gegeben, u.a. zu:
- Anforderungen an den Asylfolgeantrag
- Asylablehnung als „offensichtlich unbegründet“
- Abschiebungshaft und anwaltliche Vertretung
- Betreten von Räumen Dritter in Gemeinschaftsunterkünften
- Exkurs: Thüringer Asylstreitigkeitenzuständigkeitsverordnung seit 1.1.2024
Da wir als Fachkräfte ebenfalls den Beeinflussungen unterliegen, übernehmen wir eine besondere Verantwortung, um stigmatisierende Zuschreibungen und diskriminierende Handlungen im Alltag in der Arbeit zu erkennen und zu unterbinden. Ziel des Anti-Bias-Ansatzes ist es, sich mit eigenen Bildern diversitätsreflektiert und diskriminierungskritisch auseinander zu setzen, um Schieflagen zu erkennen und Gegenstrategien zu entwickeln. Dies gilt auch für institutionelle Zusammenhänge.
Die Veranstaltung beleuchtet folgende Aspekte:
- Sensibilisierung der Fachkräfte, sich mit eigenen Erfahrungen und Bildern auseinanderzusetzen (diversitätsreflektiert und diskriminierungskritisch) und diese in einen gesellschaftlichen Kontext zu stellen
- Schärfung der Wahrnehmung für Ungerechtigkeiten auf verschiedenen Ebenen und Hinterfragung eigener Einstellungen und Haltungen
- Erarbeitung von Handlungsspielräumen im Umgang mit Schieflagen für die eigene Praxis
Für Schwarze Menschen / Menschen of Color / Menschen mit Fluchterfahrung / Menschen mit Migrationserfahrung (und anderen Selbstbezeichnungen [2] – einfachheitshalber benutzen wir fortan „Interessierte“) sind Rassismus, Sexismus und weitere Formen von Diskriminierung Teil des Lebens und auch Teil des Arbeitsalltags. Wir arbeiten in einem ständigen Spannungsfeld von eigenen Rassimuserfahrungen und denen unserer Adressat*innen, für die diese Erfahrungen einen starken Einfluss auf ihre psychische und soziale Stabilität haben können.
Soziale Arbeit kann unterstützende Strukturen anbieten, um einen Umgang mit Othering und schmerzhaften Ausschlusspraxen zu finden. Dabei seid Ihr wichtige Begleitende in diesem Prozess, denn Ihr bietet mit Euren vielfältigen Erfahrungen, Fähigkeiten, Eigenschaften und Lebensentwürfen unterschiedlicheBezugspunkte.
Der Workshop bietet für Interessierte aus dem breiten Feld der Sozialen Arbeit einen Raum, um in einen Erfahrungsaustausch zu empowernden, individuellen als auch kollektiven Strategien im Umgang mit (eigenen) Rassismuserfahrungen zu kommen.
April 2024
Im letzten Jahr haben erneut viele Menschen - aus der Ukraine und anderen Ländern - in Deutschland Schutz gesucht. Zeitgleich meldeten Kommunen zum Teil große Herausforderungen bei der Versorgung und Unterbringung von Geflüchteten vor Ort. Nicht aus dem Blick geraten darf dabei der Schutz vor Gewalt sowie die Schaffung und Aufrechterhaltung sicherer (kindgerechter) Orte als Daueraufgabe der für die Unterbringung zuständigen Behörden.
Einen wichtigen Beitrag zur Gewährleistung sicherer Unterbringungsbedingungen wie auch bei der Bewältigung von Herausforderungen bieten kommunale Schutzkonzepte. Diese bieten allen lokalen Akteur:innen Orientierung, indem Unterbringungsstandards festgehalten, die Rollen und das Zusammenwirken der relevanten Akteur:innen benannt und konkrete Maßnahmen zum Schutz von Geflüchteten definiert werden.
Die Integration zugewanderter Menschen ist und bleibt eine der dringlichsten Aufgaben, um das gute Zusammenleben aller Menschen in unserer Gesellschaft sicherzustellen. Die Arbeit an Integration einerseits und am Gemeinwesen andererseits sind also zwei Seiten derselben Medaille. Aber wie bedingen sich Integrationsmanagement und Gemeinwesenarbeit in der Praxis und welche Erkenntnisse lassen sich daraus mit Blick auf die Strukturen der sozialen Arbeit in Niedersachsen gewinnen?
Diese und weitere Fragen stellen der Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe gemeinsam mit der Landesarbeitsgemeinschaft Soziale Brennpunkte Niedersachsen e.V. in den Mittelpunkt des Fachtages „Das eine nicht ohne das andere: Integrationsmanagement und Gemeinwesenarbeit in Niedersachsen zusammendenken“.
-
30.04.2024
-
28.04.2024
Das erste Präsenz-Netzwerktreffen für BI*PoC in deutschen NGOs bietet Workshops, Vorträge und Networking-Gelegenheiten in einem Safer Space. Die Veranstaltung ist ein Angebot für Schwarze, Indigene und People of Colour, die im sogenannten entwicklungspolitischen Sektor tätig sind, bereits Berufserfahrungen im Sektor mitbringen, sowie Studierende.
Das ‘BI*PoC in NGO - Netzwerk‘ ist eine professionelle Community von Kolleg*innen aus dem entwicklungspolitischen und humanitären Sektor, die sich für Antirassismus und Dekolonisierung engagieren. Als Plattform für Schwarze, Indigene und People of Color fördern wir Chancengleichheit und die kritische Betrachtung der Machtstrukturen innerhalb unserer Arbeit.
Bildung stärkt, ermutigt und macht Hoffnung auf eine bessere Zukunft!
Doch gerade für Flüchtlinge, die fern ihrer Heimat ein neues Leben aufbauen müssen, sind die Chancen auf höhere Bildung zumeist gering.
Wer sind diese jungen Menschen, die es geschafft haben, ihren Traum zu verwirklichen und zu studieren – trotz Flucht? Was haben sie erlebt und was treibt sie an?
“Bildung hilft dir, zu werden, wer du bist”, so sagt es Richesse. Er musste mit seinem älteren Bruder von Burundi nach Ruanda fliehen und verbrachte nach seiner Ankunft jeden Tag in der Bibliothek eines Flüchtlingscamps.
Der Fotograf Antoine Tardy hat für das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) geflüchtete Studierende porträtiert und mit ihnen gesprochen. In der Sonderausstellung werden zwanzig solcher Geschichten dokumentiert, wobei die Protagonistinnen und Protagonisten auch selbst zu Wort kommen.
Sie lernen in dieser Ausstellung interessante persönliche Geschichten kennen. Darüber hinaus werden sie eingeladen, zu reflektieren, welche Bedeutung Bildung in Ihrem eigenen Leben hat.
Medien- und Mitmachstationen ermöglichen darüber hinaus eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Thema Flucht und Bildung.
Die Forschung belegt: Männlichkeitsideologische Überzeugungen sind zentrale Treiber von Radikalisierungsdynamiken. Eine Folge davon ist, dass Männer in allen Gruppierungen mit extremistischen Tendenzen statistisch klar übervertreten sind.
Im Rahmen der Online-Fortbildung stellt der Referent Markus Theunert einen fachlichen Orientierungsrahmen für Fachkräfte vor, der im Rahmen des «nationalen Aktionsplans zur Verhinderung und Bekämpfung von Radikalisierung und gewalttätigem Extremismus» für das Schweizer Bundesamt für Polizei erstellt und am 31. Januar 2024 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde.
Ziel ist es einerseits, Fachkräfte zu sensibilisieren und zu schulen, damit sie männlichkeitsideologische Radikalisierungsdynamiken frühzeitig erkennen können. Andererseits müssen Fachkräfte befähigt sein, angemessen zu intervenieren respektive die Grenzen ihrer Möglichkeiten zu erkennen und realistisch wahrzunehmen, in welchen Fällen der Einbezug weiterer Fachpersonen notwendig ist.
Zielgruppe sind Fachkräfte / Multiplikator*innen in der Bildungsarbeit sowie weitere Interessierte.
Ob die Aufnahme und Integration von Geflüchteten gelingt, zeigt sich vor allem in den Kommunen. Doch nicht zuletzt ist eine entscheidende Frage, wie die Verteilung der Geflüchteten und Schutzsuchenden auf die Kommunen organisiert ist. Denn die meisten Menschen zieht es zunächst in die großen Städte, doch der Wohnraum ist gerade dort zunehmend knapp. Wir möchten daher Projekte vorstellen, die ein passgenaues „Matching“ von Geflüchteten und Kommunen zum Ziel haben: die beiden Forschungs- und Pilotprojekte Re:Match und Match’In sind mit dieser Zielsetzung unterwegs.
Wir beginnen mit dem Projekt Re:Match, das bereits erste Ergebnisse aus der Pilotierungsphase hat. Re:Match pilotiert die Relocation von Schutzsuchenden durch ein Algorithmus-basiertes Verfahren, das Kommunen und Schutzsuchende passgenau und direkt zusammenbringt. Es berücksichtigt die individuellen Profile und Präferenzen der Schutzsuchenden und gleicht sie mit den von der Kommune aktuell erfassten infrastrukturellen Rahmenbedingungen und Kapazitäten ab. Projektleiterin Katja Wagner präsentiert das Verfahren und die bisherigen Erkenntnisse aus dem Projekt gemeinsam mit Frauke Raßmann (Koordination der Unterbringung Kriegsvertriebener aus der Ukraine im Fachbereich Soziales und Gesundheit der Stadt Braunschweig).
Diesen Fragen widmet sich „Code & Vorurteil. Über Künstliche Intelligenz, Rassismus und Antisemitismus“, der vierte Band der Edition Bildungsstätte Anne Frank, der in Kürze im Verbrecher Verlag erscheint. Begleitend zur Buchveröffentlichung laden wir für den 19. April zu einer ganztägigen Fachveranstaltung für u.a. (Medien-)Pädagog*innen und Lehrkräfte, politische Bildner*innen, Medienschaffende und weitere Interessierte in Frankfurt am Main ein.
-
06.09.2024
Die Train-the-Trainer-Qualifizierung „Antisemitismus wirksam begegnen“ stärkt Fachkräfte zivilgesellschaftlicher Organisationen in der Umsetzung zielgruppengerechter, innovativer und methodenvielfältiger präventiver Angebote im Strafvollzug. Durch Information und Sensibilisierung, praktische Übungen sowie individuelle Beratung können die Teilnehmenden nach dem Lehrgang wirksame antisemitismuskritische Maßnahmen der Distanzierungsarbeit und Extremismusprävention eigenständig umsetzen. Referent*innen aus ganz Deutschland führen in die verschiedenen Erscheinungsformen des Antisemitismus ein und üben in einem praktischen Methodenteil individuelle Handlungssicherheit. Bei der Konzeptionierung von neuen Ansätzen im eigenen Arbeitskontext werden die Teilnehmenden von zwei Experten aus den Phänomenbereichen Rechtsextremismus und islamistischer Extremismus in (digitalen) Einzel- oder Kleingruppencoachings beraten.
Termine
- 18. und 19. April 2024
- 13. und 14. Juni 2024
- 5. und 6. September 2024
- Donnerstags 10.00 – 17.00 Uhr
- Freitags 09.00 – 16.00 Uhr
Zwei weitere Termine werden in Abstimmung mit den Teilnehmenden digital durchgeführt.
-
19.04.2024
Rechtsextreme und menschenverachtende Einstellungen sind zur größten Bedrohung für das demokratische und vielfältige Zusammenleben geworden. Die rechtsextreme Mobilisierung der vergangenen Jahre zeigt Wirkung: Unsere Demokratie ist gefährdet wie lange nicht mehr. Regelmäßig nutzt der Rechtsextremismus gesellschaftliche Krisen, um gegen Minderheiten und politisch Andersdenkende zu hetzen oder demokratische Institutionen zu diffamieren. Längst sind traditionell rechtsextreme Themen wie die Abwehr von Migration, Wissenschaftsfeindlichkeit, das Verächtlichmachen von Medien und Journalist*innen, die Leugnung der Klimakrise oder die Ablehnung von Gleichstellungsstrategien für viele Menschen anschlussfähig geworden.
Vor dem Hintergrund von Wahlerfolgen von rechtsextremen Akteur*innen auf lokaler und Landesebene sind Bürger*innen ebenso wie die Zivilgesellschaft herausgefordert. Dabei wird es in einigen Regionen für engagierte Menschen aus Initiativen, demokratischen Parteien oder Kirchengemeinden zunehmend schwierig bis gefährlich, sich offen für Demokratie und Menschenrechte einzusetzen. Egal ob auf der Straße, in der Schule oder bei öffentlichen Veranstaltungen: Bedrohungen und auch Übergriffe sind zur Normalität geworden. Gleichzeitig sehen wir in weiten Teilen der Gesellschaft den Wunsch, dem Rechtsextremismus engagiert entgegenzutreten. Dies wollen wir auf der Tagung des KompRex aufgreifen.
Wie begegnen wir dieser großen Herausforderung für unsere Demokratie wirksam? Welche Bereiche und Akteur*innen sind gefragt? Wie können wir diejenigen unterstützen, die von rechtsextremen Akteur*innen angefeindet und bedroht werden? Wir wollen es nicht bei einer bloßen Bestandsaufnahme belassen, sondern gemeinsam diskutieren, wo und wie wir handeln müssen, wie eine wirksame Prävention in Zukunft aussehen soll und stellen dafür verschiedene Ansätze und Zugänge vor.
-
19.04.2024
-
17.04.2024
In den vergangenen Jahren hat sich der Rechtsextremismus deutlich verändert. Seine Resonanzräume, Netzwerke und Agitationsformen wandeln und verbreiten sich. Medien, Zivilgesellschaft, Kirchen und Politik geraten unter wachsenden Druck. Am sichtbarsten wird diese Entwicklung in der gestiegenen Zustimmung zur AfD. Wie kann der wachsende Zulauf für rechtsradikale Strukturen und Positionen gestoppt werden? Wie kann eine demokratische Gegenstrategie gelingen?
Rechtsextreme Gruppen und Verschwörungsideolog*innen nutzen die Öffentlichkeit sozialer Netzwerke geschickt, um menschenfeindliche Ideologien zu verbreiten und in der Kommentarspalte gezielt Menschen anzugreifen. Das bringt Kommunikationsverantwortliche in ein Dilemma: Eigentlich möchten sie den Urheber*innen menschenverachtender Botschaften keine zusätzliche Aufmerksamkeit bescheren. Aber Hassrede zu ignorieren, heißt auch, die Betroffenen alleine zu lassen.
Im Workshop wird diskutiert, wie es Social-Media- und Community-Manager*innen gelingen kann, konsequent Haltung zu zeigen, eine respektvolle Community aufzubauen und demokratische und plurale Debatten zu fördern. Wir üben, auf problematische Kommentare zu reagieren und erwünschte Beiträge zu fördern.
Der Bundestag hat am 23. Juni 2023 das „Gesetz zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung“ beschlossen. Ein zentraler Punkt des neuen Gesetzes ist die Einführung einer neuen Aufenthaltserlaubnis für die Ausbildung für Menschen mit Duldung(§16g), die die bisherige Ausbildungsduldung ersetzen wird.
Im Seminar wird dessen Umsetzung in die Praxis erläutert und es werden aktuelle Entwicklungen dargestellt. Die Teilnehmer erhalten im Seminar die Gelegenheit, Fragen zu stellen.
Dieses Seminar richtet sich an haupt- und ehrenamtliche Helfer*innen. Für dieses Seminar sind Deutschkenntnisse auf C1-Niveau empfohlen.
März 2024
Menschenverachtende und extrem rechte Einstellungen finden sich jedoch nicht nur unter Menschen der Mehrheitsgesellschaft,
sondern sind auch in der migrantisierten Bevölkerung verbreitet. Zu beobachten ist, dass gerade in den letzten Jahren verstärkter auch
rechtsextreme und ultranationalistische Einstellungen bei Türkeistämmigen (Graue Wölfe) zum Vorschein treten. Kemal Bozay wird
daher in seinem Vortrag die Ursachen, Formen und Auswirkungen von Rechtsextremismus unter Türkeistämmigen diskutieren
Viele Kinder und Jugendliche, die nach Europa fliehen, haben keine gültigen Identitäts- oder Passdokumente, da diese vor oder während der Flucht verloren gingen oder einbehalten wurden. Zudem verfügt in einigen Regionen der Welt eine beträchtliche Anzahl von Personen gar nicht erst über Geburtsurkunden. Das Alter wird in diesen Fällen durch Jugendamtsmitarbeitende gem. § 42 f SGB VIII durch die “qualifizierte Inaugenscheinnahme” eingeschätzt. Im Zweifelsfall wird eine medizinische Untersuchung veranlasst.
Die Konsequenzen der Alterseinschätzung sind gravierend für Betroffene, wenn sie volljährig geschätzt werden.
Mögliche Konsequenzen:
- Umzug in die Gemeinschaftsunterkunft
- Keine Ansprechperson mehr beim Jugendamt
- Verteilung
- Aufenthaltsrechtliche Konsequenzen (Dublin, Familiennachzug)
….
Wie ist die rechtliche Situation?
Was kann man tun, wenn Jugendliche volljährig geschätzt werden?
Kann Hilfe für junge Volljährige eine Notfalllösung sein?
Diese Online-Schulung richtet sich an Berater*innen, Vormünder*innen und Rechtsanwält*innen bundesweit.
In diesem Online-Seminar wird es einen Überblick über die aktuellen Gesetzesvorhaben und -änderungen im Bereich Asyl und Flucht geben. Außerdem gibt es praktische Tipps zu wichtigen Themen in der Geflüchtetenarbeit.
Vorkenntnisse im Bereich Asyl- und Aufenthaltsrecht sind notwendig.
-
13.03.2024
Das IZRD bietet 2024 erneut 20 Plätze für Fachkräfte von Berliner (Grund-)Schulen (Lehrkräfte, Schulsozialarbeiter*innen, Schulpsycholog*innen, o.Ä.) sowie der (offenen) Kinder- und Jugendarbeit für den Fortbildungskurs „Kinderschutz, religiös begründeter Extremismus und antidemokratische Weltanschauungen“ an.
In acht Modulen lernen Sie, Situationen im Kontext von Radikalisierung und religiös begründetem Extremismus im Zusammenhang mit Kindeswohl und Kindeswohlgefährdungsfragen einzuordnen. Sie trainieren praxisnah, die Resilienz betroffener Kinder und Jugendlicher zu stärken und mit Erziehungsberechtigten sowie Kolleg*innen konstruktiv ins Gespräch zu gehen. Darüber hinaus erhalten Sie einen Überblick darüber, welche Hilfs- und Unterstützungsangebote in Berlin bestehen und tragen als Multiplikator*in entsprechendes Wissen in Ihr Arbeitsfeld. Das gewonnene Wissen integrieren Sie in das (bestehende) Kinderschutzkonzept Ihrer Einrichtung.
Start des ersten Moduls ist am 23.04.2024, das letzte Modul findet am 16. + 17.11.2024 statt.
In diesem Frühjahr bietet das IZRD zudem zwei Schnupper-Workshops an, in denen wir die Inhalte und Abläufe des Fortbildungskurses vorstellen werden. Dabei wird es auch Raum zum gegenseitigen Kennenlernen und für Ihre Fragen geben.
- 12.03.2024 | 15.00 – 18.00 Uhr | In Präsenz in Berlin-Kreuzberg
- 13.03.2024 | 15.00 – 18.00 Uhr | Digital über Zoom
In Heidelberg arbeiten zahlreiche Institutionen und Akteure erfolgreich im Themenfeld „Empowerment für (migrations-bezogene) Diversität und inklusive und interreligiöse Bildung“ zusammen. Zu diesen gehören u. a. das Zentrum für Transkulturelle Pädagogik (Hei-MaT) der Pädagogischen Hochschule Heidelberg, die Muslimische Akademie Heidelberg und das Amt für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg.
Mit der Fachtagung unter dem Titel „Zwischen Konflikt und Dialog?“ soll eine Plattform geschaffen werden, welche alle Interessierten einlädt, aktuelle Herausforderungen sowie Chancen im Schnittfeld Judentum-Islam zu diskutieren – denn sowohl das Judentum als auch der Islam sind hinsichtlich gegenwärtiger und zukünftiger Migrationsbewegungen hoch dynamischen Transformations- und Veränderungsprozessen ausgesetzt. Was heißt das für uns als Gesellschaft? Wie können vielfältige Bildungsangebote diesen Prozessen Rechnung tragen?
-
12.03.2024
2-modulige Online-Fortbildung:
- Teil 1: Geschlechterreflektiert | 05.03.24 | 09.30-13.00 Uhr | zoom
Im ersten Teil der Fortbildung blicken wir gemeinsam darauf, welche Formen von Männlichkeiten es gibt. Welche Männlichkeits-Performances nehmen wir (nicht) wahr? Welchen Männlichkeits-Anforderungen wollen und welchen müssen sich einige Männer stellen? Und was hat das alles mit der praktischen Arbeit mit ihnen zu tun? Wir fragen uns gemeinsam, wie ein geschlechterreflektierter Blick dazu beitragen kann, die Arbeit mit Männern sowohl unterstützend, begrenzend und öffnend zugleich auszugestalten. Ein Grundlagen-Input schafft dafür die Basis. Danach wird Raum geboten für Austausch, Selbstreflexion und Praxistransfer. - Teil 2: Rassismuskritisch | 12.03.24 | 09.30-13.00 Uhr | zoom
Im zweiten Teil der Fortbildung geht es um die Konstruktion von „rassifizierten Männlichkeiten*“, die aus der Geschichte heraus mit der Vormachtstellung von weiß dominierten männlichen Positionen zu tun haben. Denn auch heute noch kommt im Wettbewerb um Macht, Ressourcen und Einfluss die Abwehr und Entmenschlichung von BIPoC/migrantisierten Männlichkeiten* zum Tragen, wie viele Beispiele u.a. auch die Silvester-Ereignisse 2015/16 und 2022/23 eindrücklich zeigen. In diesem Teil der Online-Fortbildung wird der Fokus auf die Intersektion von Rassismus und Männlichkeiten* gelegt und es werden erste Zugänge für die Auseinandersetzung mit Rassismuskritik für diesen Zusammenhang eröffnet.
Im Bundesprogramm ländliche Entwicklung und Regionale Wertschöpfung (BULE plus) fördert das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) das an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg bearbeitete Forschungsprojekt EMILIE. Es geht der Frage nach, wie bürgerschaftliches Engagement für und von Migrantinnen und Migranten in ländlichen Räumen nachhaltig gestaltet und aktiviert werden kann. Mithilfe der Projektergebnisse zu biographischen Konstellationen und strukturellen Rahmenbedingungen von Engagement wurde gemeinsam mit VIA Bayern – Verband für interkulturelle Arbeit e.V. ein Coaching entwickelt, das Akteure in Landkreisen und Kommunen adressiert, die Ehrenamt koordinieren oder in der Integrationsarbeit engagiert sind.
Themen des Coachings:
- Faktoren, die zu gelingendem Engagement in der Integrationsarbeit beitragen: kooperative Zusammenarbeit, Distanz-Nähe-Verhältnis, Reflexion von Erwartungen und Dankbarkeit
- Kommunikation auf Augenhöhe: unterschiedliche Kommunikationsmodelle, erleichterte Verständigung
- Lebenswelten von Migrantinnen und Migranten kennen, ihre Talente entdecken und sie für Freiwilligenarbeit begeistern
- Organisation von Engagement neu denken: vielfältige Bedürfnisse und Hintergründe berücksichtigen und Partizipation fördern
Februar 2024
Die rechtsterroristischen Morde von Wolfhagen und Hanau haben viele Menschen erschüttert. Doch es waren nicht die einzigen Taten, die ab 2018 in Hessen als rechtsterroristisch gewertet werden müssen. In Hessen existiert seit vielen Jahren eine aktive extrem rechte, gewaltbereite Szene. Doch viele Gewaltbereite treten öffentlich kaum in Erscheinung. Sie agieren in häufig kaum wahrgenommenen Netzwerken oder radikalisieren sich über Soziale Online-Netzwerke. Wie stark ist die extrem rechte, militante Szene in Hessen und welchen Einfluss hat sie auf politische und gesellschaftliche Entwicklungen?
Die Volkshochschule und die DEXT-Fachstelle Pro Prävention Kreis Offenbach laden Sie gemeinsam zu dieser interessanten
Veranstaltung ein.
Radikalisierungsprozesse beschleunigt werden. Deshalb beschäftigt sich der Fachtag mit der Frage, mit welchen Maßnahmen wir in Niedersachsen diesen digitalen Gefahren entgegenwirken können.
Partizipation, Kinderrechte, Gewaltprävention – diese fachlichen Forderungen sind gesetzlich fixiert und werden in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen auf vielfältige Weise praktiziert. Fachleute wissen: In der Regel lassen sich diese Prinzipien nicht durch vereinzelte Maßnahmen realisieren, sie betreffen vielmehr die „Kultur“ einer Einrichtung und die professionelle „Haltung“ der Mitarbeitenden insgesamt.
Ziel dabei ist es, junge Menschen im Hinblick auf ihre Rechte zu stärken und sie effektiv vor Übergriffen und Gewalt zu schützen. Die Umsetzung dieser Ziele ist eine stetige Herausforderung im pädagogischen Alltag – für einzelne Fachkräfte ebenso wie für Teams insgesamt.
Im Seminar sollen konzeptionelle und praxisbezogene Aspekte für die Verwirklichung von Partizipation und für
die Umsetzung von Gewaltprävention im Hinblick auf ihre gemeinsamen Grundlagen thematisiert werden. Beide Konzepte sind in den Kinderrechten (die natürlich auch für Jugendliche gelten) verankert – in der pädagogischen Arbeit bedingen und ermöglichen Partizipation und Prävention einander. Prävention richtet den Blick auf Risiken, die zu Gewalt führen können und fokussiert auf Ressourcen, die Alternativen zu gewalttätigem Verhalten eröffnen. Auch die Auseinandersetzung mit Machtstrukturen und pädagogischer Verantwortung spielt dabei eine Rolle. Partizipation bedeutet, Macht zu teilen – Erwachsene müssen dafür geeignete Rahmenbedingungen schaffen und prüfen, ob sie solche Prozesse akzeptieren und in die Arbeit integrieren können.
Frauenspezifische Verfolgung kommt typischerweise in patriarchalen Gesellschaften vor, in denen Frauen häufig oder systematisch von geschlechtsspezifischer Gewalt betroffen sind und keinen Zugang zu staatlichem Schutz haben. Damit frauenspezifische Verfolgung im Asylverfahren stärker gewürdigt wird, ist vieles zu beachten.
Teilweise ist den Frauen nicht bewusst, dass die im Herkunftsland erlebte frauenspezifische Gewalt in ihrem Asylverfahren relevant ist oder sie sind aus anderen Gründen nicht in der Lage, die Verfolgung vorzutragen. Auf der anderen Seite wird frauenspezifische Verfolgung häufig von BAMF und Gerichten als familiärer bzw. persönlicher Konflikt gewertet und der Verfolgungscharakter verkannt.
Die Fortbildung beschäftigt sich mit den Fragen:
- Wie lässt sich frauenspezifische Verfolgung definieren?
- Was sind wichtige Herkunftsländer?
- Welche Verfolgungsarten sind typisch?
- Was sind die Hürden für die Würdigung von frauenspezifischer Verfolgung im Verfahren?
- Wie können in der Beratung gezielt Frauen, besonders begleitete Frauen, erreicht werden?
- Wann sind Verfahrenstrennungen wichtig?
- Was sind typische Konstellationen für frauenspezifische Folgeanträge?
-
29.02.2024
Das Netzwerk gegen Gewalt Hessen veranstaltet im Zeitraum vom 08.02.24-29.02.24 in Zusammenarbeit mit Beratungsstellen, der Schulpsychologie und der Polizei eine Fortbildung zum Thema „Gewalt im Namen der Ehre. Hinsehen. Handeln. Helfen. Möglichkeiten der Prävention und Intervention“.
Recherchen und Statistiken zeigen, dass Ehrgewalt hierzulande weiterhin ein aktuelles Problem darstellt.. Die 4-tägige praxisbezogene Fortbildung greift die Themen Ursachenproblematik, Gesprächsführung mit Betroffenen, Möglichkeiten der schulischen und außerschulischen Prävention und Intervention, Möglichkeiten der Unterstützung und Beratung, Aufbau von Netzwerken, Umsetzung der Thematik in der Praxis / im Unterricht auf. Sie wird in vier Modulen in Präsenz und Online durchgeführt und ist kostenfrei.
Die Zielgruppe sind Lehrkräfte aller Schularten, Schulleitung, Schulsozialarbeit und sozialpädagogische Fachkräfte der Schulen in Hessen sowie Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte in Hessen.
In der Fortbildung wollen wir gemeinsam erforschen, wie und wo gesellschaftliche Machtstrukturen wirken und was diese mit uns persönlich zu tun haben. Wir gehen der Frage nach, wo wir selbst Macht haben und in welchen Situationen wir uns machtlos fühlen.
Januar 2024
-
19.09.2024
Die Fortbildung „Kommunal. Innovativ. Präventiv.“ richtet sich bundesweit an behördliche Fachkräfte in den Verwaltungen von Landkreisen, Städten und Gemeinden, die den Themenbereich Radikalisierungsprävention bzw. Extremismusprävention bearbeiten oder sich für die Förderung gesellschaftlichen Zusammenhalts einsetzen. Die Fortbildung ist passgenau auf die Bedarfe kommunaler Fachkräfte zugeschnitten. Im Fokus stehen die Vermittlung aktueller Wissensstände, die Erarbeitung von Schlüsselkompetenzen und innovativer Perspektiven sowie der Austausch über Herausforderungen und gelingende Ansätze kommunaler Radikalisierungsprävention.
Vier Fortbildungsblöcke von je zwei Tagen werden durch digitale Selbstlerneinheiten ergänzt, die eigenverantwortlich bearbeitet werden. Zentral sind dabei: Praxisrelevanz, Anwendbarkeit und interkommunales Lernen. Jedes Modul erlaubt den Teilnehmenden eine Strategie zu entwickeln, wie sie das behandelte Thema in ihren eigenen Arbeitskontext integrieren können. Zusätzlich bietet die Fortbildung immer wieder Räume für den intensiven, kollegialen Austausch kommunaler Fachkräfte.
Durchgeführt wird die Fortbildung vom multiprofessionellen Team des Modellprojekts „Kommunale Fachberatung“ sowie einschlägiger Expert*innen aus Kommunalverwaltung, zivilgesellschaftlicher Beratungs- und Präventionspraxis und Wissenschaft. Die Teilnahme ist kostenlos. Fahrtkosten und Übernachtungskosten können leider nicht übernommen werden.
Das Team der Kommunalen Fachberatung bietet vorab zwei digitale Informationsveranstaltungen an, damit Interessierte sich ein Bild der Fortbildung machen können. Die Informationsveranstaltungen finden online statt am 02. November 2023 (14.00 – 15.30) und am 29. November 2023 (10.00 – 11.30).
-
24.01.2024
Mit diesem Gesetz will die Bundesregierung langjährig geduldeten Personen einen Weg in einen regulären Aufenthalt ermöglichen und die Chance geben, die dafür notwendigen Integrationsleistungen nachzuweisen. Die Erfahrung der Beratungsstellen zeigt, dass die Absicht des Gesetzgebers in Bayern teilweise durch eine restriktive Behördenpraxis unterlaufen wird. Viele Betroffene können deshalb nicht von dem Gesetz profitieren. Diese und weitere Hürden in einen sichern Aufenthalt zu kommen, wollen wir gemeinsam diskutieren. Im Fokus soll dabei auch die Situation der Betroffenen selbst stehen, deren Anträge abgelehnt wurden oder die unter die Ausschlussgründe fallen. Durch fachlichen Input und vertiefende Workshops zu verschiedenen Aspekten des Chancenaufenthaltsrechts sollen die Probleme bei der Umsetzung des Gesetzes in Bayern herausgearbeitet und diskutiert werden. Gleichzeitig wollen wir uns über Lösungsstrategien austauschen.
Aus dem Fachtag sollen Forderungen an Politik und Verwaltung entwickelt werden: Welche Nachbesserungen am Gesetz braucht es? Wie muss eine Verwaltungspraxis aussehen, die der Intention des Gesetzes entspricht? Welche praktischen Probleme sehen wir, wenn es darum geht die notwendigen Integrationsnachweise zu erreichen, um in einen sicheren Aufenthalt zu kommen? Unsere Perspektiven und Forderungen werden wir anschließend in einer Podiumsdiskussion an Vertreter:innen aus Politik und Behörden herantragen.
Alle interessierten Geflüchteten, Haupt- und Ehrenamtliche sind herzlich eingeladen, ins Bellevue di Monaco zu kommen.
Ziel ist die Weiterqualifizierung der Fachkräfte für die spezifischen Bedarfe von Minderjährigen, um deren Begleitung zu verbessern. In dem Workshop werden keine rechtlichen Aspekte des Asylverfahrens behandelt, der Fokus liegt vielmehr auf der Vermittlung praktischer Handlungs- und Reflexionsmethoden. Die Fortbildung soll Fachkräften die Möglichkeit geben, weiteres Wissen über ihr Tätigkeitsfeld zu erlangen, Einblicke in relevante Methoden für ihre Arbeit zu bekommen sowie eine kritisch-reflexive Haltung für eine interkulturelle Beratungs- und Betreuungspraxis zu gewinnen.
Sie haben Lust sich mit anderen Fachkräften zu den Themen Diskriminierung, Diversität, Rassismuskritik, Sexismuskritik und Intersektionalität auszutauschen? Sie fühlen sich vielleicht allein in Ihrer Institution oder Familien- und Freund*innenkreis und suchen einen Raum, in dem sie Gleichgesinnte treffen können? Sie möchten selbstreflexiv über Ihre eigene Praxis nachdenken und von Fallbeispielen der anderen lernen? Sie möchten einen Mini-Input hören und danach mit anderen Expert*innen ins Gespräch kommen?
Dann sind Sie herzlich eingeladen, an dem Runden Tisch teilzunehmen.
Es handelt sich bei dem Austauschforum um einen informellen Raum, der von den Trainerinnen von vielgestaltig* 2.0 moderiert wird. Sie haben darin die Möglichkeit, andere Fachkräfte zu treffen, miteinander zu diskutieren und mögliche Kooperationen auszuloten. Zudem ist es ein Forum, in dem verschiedene Soziale Projekte im Raum Niedersachsen (und darüber hinaus) kennengelernt werden können. Dadurch bekommen Sie einen besseren Überblick über die Projektlandschaft in den Bereichen Migration, Asyl, Gleichstellung, Jugendarbeit und politische Bildungsarbeit.
-
13.01.2024
Antisemitismus ist kein ausschließliches Phänomen der Vergangenheit oder bestimmter Gruppen. Vielmehr durchdringt er alle gesellschaftlichen Bereiche und macht auch vor dem Lernort Schule nicht halt. Die Thematisierung und der Umgang mit gegenwärtigen Erscheinungsformen von Judenfeindschaft stellt viele Lehrkräfte vor Herausforderungen.
Die Fortbildung macht die Teilnehmenden mit unterschiedlichen Methoden der antisemitismuskritischen Bildungsarbeit vertraut, diese werden erprobt und schließlich gemeinsam reflektiert. Dabei wird der Fokus immer praxisbezogen sein. Welche Herangehensweisen sind sinnvoll? Wann sind welche Methoden einsetzbar und für wen sind sie geeignet? Welche Fallstricke bergen manche Methoden? Welches Wissen und welche Haltung zum Thema muss ich selbst mitbringen?
Lernziele:
- Sensibilisierung für Erscheinungsformen
- Methodenkompetenz
- Haltung entwickeln
In Sachsen-Anhalt findet die Praxis der elektronischen Gesundheitskarte derzeit —als einer der wenigen Bundesländer— in keinem Landkreis/ keiner kreisfreien Stadt Anwendung.
Der Fachtag bietet die Möglichkeit, das Konzept der elektronischen Gesundheitskarte für Asylsuchende kennenzulernen und sich mit Expert*innen und Praktiker*innen über dessen möglichen Umsetzung auszutauschen.
Dezember 2023
Die Plattform Zivile Konfliktbearbeitung lädt Mitglieder, Partner*innen und Gäste aus Politik und Wissenschaft herzlich zu ihrer Jubiläumsfeier nach Berlin ein um gemeinsam die Frage zu diskutieren: Wie muss sich Friedensarbeit verändern, um aktuellen Herausforderungen gerecht zu werden?
25 Jahre nach Gründung der Plattform Zivile Konfliktbearbeitung stehen Zivile Konfliktbearbeitung und Friedensförderung nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, der sicherheits- und verteidigungspolitischen Zeitenwende und jüngsten Eskalationen der Gewalt im Nahen Osten, im Balkan und anderen Weltregionen heute mehr denn je unter Druck.
Trotz des dramatischen Bedarfs aufgrund der weltweit steigenden Anzahl gewaltsam ausgetragener und bewaffneter Konflikte, humanitärer Krisen und einer ernüchternden Halbzeitbilanz der globalen Nachhaltigkeitsziele SDGs plant die Bundesregierung, die Mittel für Entwicklungszusammenarbeit, humanitäre Hilfe, Krisenprävention und Friedensförderung drastisch zu kürzen.
In der öffentlichen und politischen Debatte scheint der Friedensbegriff heute überdies umkämpft, wird zum Teil als naiv abgetan oder gekapert.
-
12.12.2023
Diese berufliche Weiterbildung möchte sozialpädagogische-psychologische (Fach) Kräfte ansprechen, die in der Migrationsarbeit tätig sind.
Die berufliche Weiterbildung hat zum Ziel, Fachkräfte sowohl soziokulturell zu sensibilisieren als auch ihr Bewusstsein und ihre berufliche Haltung im Umgang mit Menschen zu traumatischen Erlebnissen, Ängsten und Blockierungen zu stärken.
Unter sehr belastenden Bedingungen müssen Fachkräfte der Migrationsarbeit vielfältige Herausforderungen meistern. Es leitet sich die Frage ab nach erweiterten Kompetenzen, nach einer authentischen Rolle und nach einem Wissen, die den professionellen Umgang mit herausfordernden Situationen erleichtern soll.
Oft ist es so, dass Fachkräfte in der (psycho-) sozialen Migrationsarbeit nicht mehr ausreichend gewappnet sind, um mit diesen Krisen klarzukommen. Mehr denn je bedarf es in unserer Gesellschaft einer besonderen Hinwendung zu den Themen von Flucht und Traumata sowie ein Verständnis der multiplen Krisenlagen inklusive biographischer Krisen und Prozessen in unterschiedlichen geographischen und kulturellen Zusammenhängen.
Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz wurde beschlossen. Ein Gesetzesentwurf zum Staatsangehörigkeitsgesetz wird bereits diskutiert. Ein zweites Migrationspaket wird noch erwartet. In diesem online-Seminar wird es einen Überblick über die aktuellen Gesetzesvorhaben und -änderungen im Bereich Asyl und Flucht geben. Außerdem gibt es praktische Tipps in bestimmten Themen in der Geflüchtetenarbeit.
Das online-Seminar richtet sich an Interessierte und ehrenamtlich Engagierte in der Geflüchtetenarbeit. Vorkenntnisse im Asyl- und Aufenthaltsrecht sind notwendig.
Klassismus hingegen erzeugt gläserne Barrieren, die oft übersehen werden: Wir konzentrieren uns auf Männlichkeiten und auf Migrationsgeschichten und vergessen, dass die ökonomischen Bedingungen Bildungszugänge gewähren oder verschließen. Und dabei bleiben die Betroffenen i.d.R. allein: Zu stark scheint das Beschämungspotential zu sein, um sich in einem „Klassenbewusstsein“ wiederzufinden.
Transkulturelle Jungen*arbeit hat Zugänge zu Jungen* in Armutsverhältnissen entwickelt, die ein Empowerment gegen Klassenbeschränkungen ermöglichen: Klassismus prägt Bildungs- und damit Zukunftschancen, jungen*gemäße Selbstbehauptung verspricht die Chance einer realen Teilhabe.
Die Veranstaltung beleuchtet folgende Aspekte:
- Wie können Angebote der Jungen*arbeit gestaltet werden, die gegen (Selbst-)Beschränkungen unterstützen, aber nicht beschämend bei von Klassismus betroffenen Jungen* wirken?
- Inwiefern hilft die Männlichkeitsreflexion bei der Überwindung von Armutsverhältnissen? Und warum müssen wir über die Berücksichtigung der sozialen Lage hinaus genauer auf Klassenverhältnisse schauen?
- Ist ein Empowerment für Jungen* möglich und in welchem Verhältnis steht dies zur Selbstbehauptungsarbeit?
- Wie können relativ „reiche“ und „bildungserfahrene“ Pädagog*innen mit Jungen* arbeiten, die von gläsernen Barrieren der Armut(sverhältnisse) betroffen sind? Welche Haltung und welche Zugänge müssen wir entwickeln?
Wie kann Soziale Diagnostik zu einem erfolgreichen Distanzierungsprozess beitragen? Ein wesentlicher Bestandteil für einen gelingenden Beratungsprozess ist das Fallverstehen. Um fachlich fundiertes, professionelles Handeln in einem so sensiblen Handlungsfeld wie der Extremismusprävention sicherzustellen, ist ein anwendungsorientiertes und praxisnahes Diagnostikverfahren daher essenziell.
Die konkreten Herangehensweisen an Diagnostik und Falleinschätzung unterscheiden sich je nach trägerspezifischer und fachlicher Perspektive. Diese fachliche Diversität ist Ausdruck einer komplexen Antwort auf ein komplexes Phänomen – und international fast einzigartig. Das Team von Violence Prevention Network hat in den letzten Jahren viele Ressourcen in die Weiterentwicklung der eigenen Sozialen Diagnostik im Extremismuskontext investiert: Bestehende Verfahren wurden systematisch überprüft und auf Basis neuester Forschungserkenntnisse zu Radikalisierung und Distanzierung ergänzt. Die Anwendbarkeit im realen Praxisalltag der Berater*innen wurde getestet. Begleitend zu diesem Prozess wird aktuell eine App entwickelt, in die wir Ihnen im Rahmen der Fachtagung bereits ein paar erste Einblicke geben können. Ziel der App wird sein, die Anwendung des sozialdiagnostischen Verfahrens zu erleichtern und Digitalisierungsprozesse voranzutreiben.
Strömungen von Extremismus und Radikalisierung fordern alle heraus, die mit jungen Menschen arbeiten. Dabei tragen Sie dreifach Verantwortung: Für sich selbst, für die ihnen anvertrauten jungen Menschen und für die Gesellschaft.
In dem kompakten berufsbegleitenden Zertifikatskurs der Pädagogischen Hochschule Heidelberg unter Leitung von Prof. Dr. Havva Engin gewinnen die Teilnehmenden Sicherheit für ihr Handeln und profitieren vom umfassenden Netzwerk der beteiligten Dozent:innen.
"Extremistische Strömungen spielen für Radikalisierungs- und Extremismustendenzen junger Menschen eine wichtige Rolle und sind im öffentlichen Raum und auch in Bildungseinrichtungen sichtbarer geworden.
Wenn junge Menschen sich plötzlich anders verhalten oder mit demokratiefeindlichen Sprüchen auff allen, dann ist es zielführend, wenn pädagogische Fachkräfte darauf souverän reagieren können. Gerade wenn religiöse oder politische Aspekte berührt sind, ist Fingerspitzengefühl gefragt. Wie lässt sich erkennen, ob jemand nur provozieren möchte oder tatsächlich eine extremistische Haltung entwickelt hat? Warum entwickeln junge Menschen überhaupt eine Neigung zu extremistischem Denken und Handeln?
Und welche handlungsleitenden Schritte sind für pädagogische Fachkräfte möglich und sinnvoll, falls sich der Verdacht auf Radikalisierung erhärtet?
Das Kontaktstudium „Extremismus und Radikalisierung: Handlungskompetenz für die Bildungsarbeit mit jungen Menschen“ befähigt Sie, verschiedene Formen von Extremismus und Radikalisierung zu erkennen, junge Menschen im Rahmen Ihrer berufl ichen Tätigkeit für die Thematik zu sensibilisieren, sowie in begründeten Verdachtsmomenten die Gefahrenlage abzuschätzen, um gemeinsam mit Leitungspersonen und ggf. auch Akteuren der Prävention konkrete Schritte für ein angemessenes Vorgehen einzuleiten.
Unser Angebot richtet sich an alle, die mit jungen Menschen arbeiten und ist ebenso praxisorientiert wie theoriebasiert."
Es ist beispielsweise davon auszugehen, dass viele minderjährige Geflüchtete emotional sehr belastet sind – aufgrund schwieriger, traumatischer Erfahrungen im Herkunftsland und auf der Flucht und nicht zuletzt aufgrund ihrer Situation in Deutschland.
Die Tagesschulung gibt eine Einführung in das Thema und gemeinsam erarbeiten die Teilnehmenden Antworten auf Fragen rund um das Thema Trauma. Die Teilnehmenden lernen was ein Trauma ausmacht, lernen Traumafolgen und die posttraumatische Belastungsstörungen kennen sowie mögliche Anzeichen und Symptome. Ebenso lernen sie, einen sensiblen und wertschätzenden Umgang mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen zu finden, um ihnen und ihren Eltern unterstützend beizustehen – ohne dabei die eigene Selbstfürsorge aus den Augen zu verlieren.
November 2023
-
01.12.2023
Demokratie als grundlegendes Werte-, Struktur- und Organisationsprinzip der Gesellschaft muss gelebt, aktiv gestaltet und immer neu verteidigt werden. Wie in vielen anderen Ländern steht die Demokratie auch in Deutschland unter Druck: Sie ist nicht nur als Lebens-, Gesellschafts- und Herrschaftsform gefährdet – sie wird auf allen Ebenen aktiv angegriffen. Einerseits erstarken antidemokratische und menschenfeindliche Ideologien, Strukturen und Politikstile. Sie begünstigen ausschließende, die Teilhabe einschränkende und die Gerechtigkeit in Frage stellende Prozesse. Zudem steigen die Performanzdefizite des politischen Systems. Andererseits stehen antidemokratischen bis offen demokratiefeindlichen Prozessen progressive, emanzipatorische Diskurse und Bewegungen gegenüber. Sie adressieren wahrgenommene Differenzen zwischen normativer Idee und demokratischer Praxis und sind darauf gerichtet, demokratie- und menschenrechtsbezogene Positionen auszuweiten, auszubauen und zu stärken.
„Demokratie unter Druck“ heißt, sowohl anti- als auch prodemokratische Formen von Druck für den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu betrachten.
Die Fachtagung möchte für die Herausforderungen der Demokratie sensibilisieren und Perspektiven zur Stärkung demokratischer Prozesse und Strukturen diskutieren. Dabei sollen sowohl Gefährdungen als auch progressive Entwicklungen für die Demokratie aus wissenschaftlicher, institutioneller und zivilgesellschaftlicher Perspektive analysiert und aufgezeigt werden.
-
01.12.2023
Welche aktuellen Entwicklungen sind in der Evaluationsforschung zu beobachten und was zeigt der internationale Blick? Welche Methoden und Instrumente erweisen sich für die Extremismusprävention, politische Bildung und Demokratieförderung als besonders ergiebig und welche Unterstützungsangebote werden benötigt, um nachhaltige Evaluationsstrukturen zu stärken?
Seit Oktober 2022 beschäftigt sich das Forschungs- und Transfervorhaben
„PrEval - Zukunftswerkstätten” intensiv mit unterschiedlichen Fragen rund um Evaluation und Qualitätssicherung in der Extremismusprävention, Demokratieförderung und politischen Bildung.
Auf dem PrEval-Fachtag 2023 sollen erste Ergebnisse unserer Zukunftswerkstätten vorgestellt und der Dialog zwischen Wissenschaft, Präventionsakteur:innen sowie Politik und Verwaltung fortgeführt werden. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, mitzudiskutieren.
In der Extremismuspräventionsarbeit gewinnt Social Media immer mehr an Bedeutung. Häufig wird die Frage aufgeworfen, wie sich Praktiker*innen differenziert mit möglichen Maßnahmen der Extremismusprävention im Onlinebereich ihren Zielgruppen annähern können. Das Interesse bezieht sich meistens einerseits auf die zielgruppengerechte Konzeptionierung von entsprechendem Content auf Social Media und andererseits auch auf zielgerichtete Maßnahmen, die zur Steigerung der Reichweite sowie zum höheren Engagement in den Online-Räumen führen.
Welche digitalen Projekte der Extremismusprävention gibt es bereits auf internationaler Ebene? Was macht eine erfolgreiche Online-Community aus und wie gewinnt diese an Reichweite? Wie funktioniert Community-Building? Das sind Fragen, die unsere Referent*innen in kurzen Vorträgen behandeln.
- Im ersten Vortrag beleuchtet Sally Hohnstein (Deutsches Jugendinstitut (DJI)) internationale Perspektiven zur Digitalität in der Extremismusprävention, indem sie Online-Angebot der Extremismusprävention innerhalb und außerhalb Deutschlands miteinander vergleicht.
- In einem zweiten Vortrag wechseln wir von der wissenschaftlichen zur praktischen Perspektive: Lorenzo Liebetanz (CEOPS (AVP e. V.)) gibt Einblicke in die deutsche Praxisarbeit der Online-Extremismusprävention mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen.
- Im dritten Vortrag verlassen wir kurz den expliziten Bereich der Extremismusprävention und richten unser Augenmerk auf die Potenziale des digitalen Marketings. Christian Büchler (Social Ninja GmbH) berichtet davon, wie digitale Sichtbarkeitsmaßnahmen nachhaltiges Online-Community-Building unterstützen können.
-
29.11.2023
Angesichts des erheblichen Fachkräftemangels und des demographischen Wandels wird sich die Relevanz von ausländischen Fachkräften in der Gesundheitsversorgung weiter steigern. Welche Maßnahmen und Initiativen wurden bereits entwickelt, um Fachkräfte in diesen Bereichen zu werben und zu vermitteln? Worin liegen die besonderen Herausforderungen? Wie steht es um ihre Bleibeperspektiven?
Wie können Geflüchtete dabei unterstützt werden, wieder Gestalter*innen ihrer Belange und Umgebung zu werden? Und wie kann eine Unterstützung auf Augenhöhe gelingen?
Im Workshop werden sowohl der Begriff als auch der Anspruch von Empowerment thematisiert, Hindernisse erörtert, gute Beispiele gesammelt sowie die Arbeit der Flüchtlingshilfe Sprockhövel als Good Practice-Beispiel vorgestellt.
Im Rahmen des Workshops erhalten Sie außerdem Tipps und Anregungen, wie Sie Ihre Arbeit auch in Pandemie-Zeiten aufrechterhalten können.
Schließlich können eigene Vorhaben und Projekte mit Blick auf eine stärkere Beteiligung und das Empowerment von Geflüchteten konzipiert und optimiert werden.
Dieses Seminar richtet sich an ehren- und hauptamtliche Kräfte in der Arbeit mit Neuzugewanderten.
Auch wenn feministische Ansätze derzeit in dem politischen und gesellschaftlichen Raum mehr Aufmerksamkeit gewinnen, werden feministische migrantische Organisationen nicht an Ziel,- und Entscheidungsbildungsprozessen beteiligt. Sie werden nach wie vor von etablierten Institutionen ausgeschlossen und nicht als gleichberechtigte Partner*innen auf Augenhöhe anerkannt und wertgeschätzt.
In der diesjährigen Jahreskonferenz von DaMigra e.V. möchten wir daher u.a. folgenden Fragen nachgehen:
- Wer ist die sogenannte feministische Zivilgesellschaft in Deutschland, und inwiefern werden Migrant*innen und ihre Selbstorganisationen als Teil der feministischen Zivilgesellschaft gesehen?
- Welche Rolle spielen Migrant*innen, Geflüchtete und ihre Anliegen im feministischen, zivilgesellschaftlichen Diskurs in Deutschland?
- Welche Rolle spielen migrantische, insbesondere feministische migrantische Organisationen bei der Stabilisierung und Weiterentwicklung der demokratischen Zivilgesellschaft in Deutschland?
In diesem Jahr möchten wir bei unserer Jahreskonferenz die Zusammenarbeit und Überschneidungen migrantischer Selbstorganisationen und der feministischen Zivilgesellschaft in den Blick nehmen. Gemeinsam mit Vertreter*innen aus Zivilgesellschaft, Politik und Wissenschaft wollen wir uns über die Rolle feministischer, zivilgesellschaftlicher und migrantischer Akteur*innen als gleichberechtigte Partner*innen austauschen. Dabei möchten wir insbesondere die Handlungsmöglichkeiten migrantisch-feministischer Organisationen in der Weiterentwicklung der Zivilgesellschaft beleuchten.
-
24.11.2023
Gesellschaftliche Veränderungsprozesse bringen oft Herausforderungen mit sich, die an erster Stelle dort zum Vorschein kommen, wo Menschen Seite an Seite zusammenleben - in den Städten, Gemeinden und Stadtteilen. Als Ansprechpartner*in für Träger, Verwaltung und Politik werden Sie immer wieder beauftragt solche spannungsgeladene Konfliktsituationen im Quartier zu bearbeiten. Hiefür benötigen Sie Werkzeuge der Konfliktbearbeitung und die Möglichkeit diese entlang praktischer Beispiele zu erlernen und einzuüben.
In dieser Fortbildung lernen Sie, spannungsgeladene Veränderungsprozesse zu gestalten und nachhaltig zur Bearbeitung von damit einhergehenden Konflikten beizutragen. Dafür vertiefen Sie Ihr Konfliktverständnis und erlernen Methoden der Konfliktanalyse und Konfliktbearbeitung, die Sie anhand eines selbst gewählten Fallbeispiels anwenden. Sie schärfen Ihren Blick für Machtasymmetrien, Ihre eigene Rolle in Konfliktbearbeitung, sowie für externe Unterstützungsangebote. Als eine Form der externen Unterstützung lernen Sie die Kommunale Konfliktberatung kennen. Der prozessorientierte, systemische Ansatz setzt unterschiedliche Perspektiven und Interessen von Bevölkerungsgruppen in Zusammenhang und macht Konflikte damit bearbeitbar. Dieser Ansatz wird derzeit vom forumZFD sowie dem K3B – Kompetenzzentrum Kommunale Konfliktberatung des VFB Salzwedel umgesetzt.
Die Fortbildung ist Teil einer neuen Fortbildungsreihe zu integrativer Gemeinwesen-, Quartier- und Sozialraumarbeit. Mit der Belegung von mindestens drei Veranstaltungen und einem abschließenden Fachgespräch erhalten Sie ein Zertifikat der Bundesakademie für Kirche und Diakonie. Sie können die Veranstaltungen frei kombinieren und Ihren eigenen Schwerpunkt wählen.
Qualifizierung, Austausch und Reflexionen zur eigenen Arbeitshaltung sind in dem Arbeitsbereich unerlässlich. Die Grundlagenschulung vermittelt praxisnah jugendhilferechtliche und asyl- und aufenthaltsrechtliche Grundlagen, Informationen zu Vormundschaft und ihrer Rolle im Asylsystem sowie zur Begleitung und Übergangsgestaltung von und mit jungen volljährigen Geflüchteten. Neben den Schulungsinhalten wird es Raum für interaktiven Austausch und zur Reflexion der Herausforderungen und Haltungen im Arbeitsalltag geben.
Die Schulung richtet sich an angehende Fachkräfte und Fachkräfte, die neu in die Arbeit mit geflüchteten jungen Menschen eingestiegen sind oder einsteigen.
Rassismus- und machtkritische, an den Bedarfen von Geflüchteten orientierte Ansätze sind in der Sozialen Arbeit mit Geflüchteten angesichts eines erstarkenden Rechtspopulismus dringend geboten, fehlen jedoch nach wie vor häufig. Beim abschließenden Fachtag des Projekts "Aus eigener Kraft" diskutieren die Projektmitarbeitenden mit (externen) Referent*innen und den Teilnehmenden über die erprobten Ansätze rassismuskritischer Arbeit im Bereich Flucht. Wir wollen zurückblicken auf die Ergebnisse des Projekts und zusammen über Wege debattieren, wie Rassimuskritik als Querschnittsthema in der sozialen Arbeit etabliert werden kann.
Folgenden Fragen werden zur Diskussion gestellt:
- Wie können die Perspektiven von Geflüchteten dauerhaft strukturell verankert und regelmäßig mit in die Arbeit einbezogen werden?
- Wie erreichen wir eine Verstetigung rassismuskritischer Perspektiven in Organisationen von freien Träger*innen und bei Kommunen?
- Was benötigen Fachkräfte und Ehrenamtliche, um rassismuskritisch arbeiten zu können?
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei und richtet sich an haupt- und ehrenamtlich in der Arbeit mit Geflüchteten Engagierte.
Die Tagung richtet sich an Akteure aus den Bereichen Medizin, Soziales, Politik und Zivilgesellschaft. Sie bietet auch einen geeigneten Rahmen, eigene Impulse zum Thema einzubringen und für weitere Vernetzungsmöglichkeiten.
Deutschland ist seit vielen Jahrzehnten Ziel von Schutzsuchenden aus der ganzen Welt. Die meisten Menschen, die ihr Land zwangsweise verlassen, sind im jüngeren und mittleren Lebensalter. Im Jahr 2021 waren nur 1,1 Prozent der Asylantragstellenden (Erstanträge) in Deutschland älter als 60 Jahre. Ältere Menschen verbleiben oftmals am Wohnort oder fliehen lediglich in benachbarte Gebiete. Mit dem Krieg in der Ukraine haben sich die Zahlen der Geflüchteten über 60 Jahre deutlich nach oben korrigiert.
Ziel der Veranstaltung ist es, ein bisher wenig beachtetes Thema einer größeren Fachöffentlichkeit zugänglich zu machen. Neben theoretischen Inputs stellen sich Praxisprojekte aus dem Bundesgebiet vor, die erste Ansätze der Arbeit mit älteren Geflüchteten erproben. Zielgruppe der Veranstaltung sind Fachkräfte aus den Bereichen der offenen Altenhilfe, Pflege, Seniorenvertretungen, Sozialen Arbeit, Flüchtlingssozialarbeit sowie den Interessenvertretungen von Geflüchteten.
Während sich in den vergangenen Jahren der Fokus der Unterstützungsarbeit verstärkt auf geflüchtete Frauen gerichtet hat, wird in letzter Zeit die Frage präsenter, wie geschlechterreflektiert und zugewandt mit geflüchteten Männern gearbeitet werden kann.
Wie kann ein offener und nachhaltiger Dialog über Männlichkeits-Thematiken mit Männern gestaltet werden? Worauf gilt es zu achten, wenn ich möglichst männlichkeitszugewandt und -kritisch zugleich arbeiten möchte?
Der Onlineworkshop bietet einen ersten Einblick in das Themenfeld der geschlechterreflektierten und diskriminierungskritischen Männer-Arbeit und legt dabei einen Fokus auf die Lebenswirklichkeiten geflüchteter Männer.
Im ersten Teil der Veranstaltung bietet Olaf Jantz (mannigfaltig e.V.) seinem Input zum Thema „Transkulturelle Jungen*arbeit – Rassismuskritik, Männlichkeitsreflexion, Geschlechtervielfalt und andere Notwendigkeiten in der Unterstützung von männlichen* Geflüchteten“ an mit anschließender Möglichkeit zu Nachfragen und Diskussion.
Im weiteren Verlauf der Fortbildung erhalten die Teilnehmenden die Möglichkeit zum Austausch und zur Reflexion der eigenen Praxis.
Aktuelle Studien und öffentliche Debatten zeigen deutlich, dass die größte Minderheit Europas noch bis heute vielerorts Diffamierung, Diskriminierung und sozialer sowie politischer Marginalisierung ausgesetzt ist.
Was das aktuell für die Menschen der Minderheit bedeutet und wie es langfristig zum Abbau von diesem spezifischen Rassismus kommen kann, wird versucht, alltagstauglich und interaktiv im Workshop darzustellen. Ziel ist hierbei die kritische Reflexion der eigenen Denk- und Verhaltensmuster, um Rassismus gegen Sinti* und Roma* entgegenzuwirken.
Einschätzungen zufolge sind mehr als 200 Millionen Mädchen und Frauen weltweit von Genitalverstümmelung (Englisch FGM/C: female genital mutilation/ cutting) betroffen. Dieser Eingriff hat bei den Betroffenen körperliches aber auch seelisches Leid zur Folge, welches die Betroffenen oft lebenslang begleitet. Auch in Deutschland stellt die Thematik im Zusammenhang mit Flucht und Migration ein dringendes und wichtiges Anliegen dar; Tausende Frauen und Mädchen sind betroffen und viele weitere gelten als gefährdet. Aus diesem Grund möchte die Kontaktstelle für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland des DeBUG-Projekts („Dezentrale Beratungs- und Unterstützungsstruktur für Gewaltschutz in Flüchtlingsunterkünften (DeBUG)") für den Themenkomplex FGM/C im Zusammenhang mit Flucht und Asyl sensibilisieren.
Das Onlineseminar bietet einen theoretischen Zugang zur Thematik an. Dabei werden unter anderem die Definitionen, die Klassifizierung sowie die kurz- und langfristigen Folgen der FGM/C erläutert. Das Onlineseminar greift zudem die historischen Ursprünge und die soziokulturellen Hintergründe auf. Des Weiteren werden Handlungs- Möglichkeiten und Empfehlungen für die Arbeit in Unterkünften für geflüchtete Menschen gegeben. In diesem Kontext bietet das Seminar Anregungen und Denkanstöße für die proaktive, kultursensible Beratung und Unterstützung von Betroffenen und gefährdeten Frauen und Mädchen. Hierbei wird auf eine gleichberechtige und respektvolle Basis in der Beratungsarbeit ein Fokus gelegt. Zusätzlich wird im Rahmen des Seminars auf den Themenkomplex Verstehen vs. Verständnis eingegangen.
-
17.11.2023
Eine Anmeldung ist nur für die gesamte Trainer*in-Ausbildung mit allen 3 Modulen möglich. Modul 2 und Modul 3 der Ausbildung finden am 22.-26.04.2024 und 20.-24.11.2024 im GSI statt.
-
10.11.2023
Die Eskalation der Gewalt im Nahen Osten sorgt auch hierzulande für Spannungen. In den hitzigen Auseinandersetzungen - beispielsweise um Demonstrationsverbote und Antisemitismusvorwürfe - können sich Verantwortliche im kommunalen Raum schnell zwischen den Fronten wiederfinden. Das forumZFD hat langjährige Erfahrung sowohl in der Arbeit mit Kommunen, als auch mit dem Kontext Nahost-Konflikt.
In einer einstündigen Online-Veranstaltung bieten wir Raum für offenen Austausch und Orientierung im Umgang mit dieser herausfordernden Situation.
Welche Fragen und Entscheidungen sind für Kommunen derzeit in Bezug auf die Debatte zum Nahostkonflikt besonders brisant? Wie wird in unterschiedlichen Kommunen damit umgegangen und welche Erfahrungen machen sie dabei? Welche weiteren Handlungsmöglichkeiten lohnt es sich, in den Blick zu nehmen?
Neuzugewanderte Frauen suchen besonders im digitalen Raum nach Information und Beratung zu diversen Themen gesellschaftlicher Teilhabe. Die dort zur Verfügung stehenden Angebote entsprechen jedoch häufig nicht ihren Bedarfen. Sie sind sprachlich kompliziert formuliert, inhaltlich zu komplex, unübersichtlich strukturiert und zumeist nur auf Deutsch. Um diese Situation zu verbessern und damit nachhaltig zur Stärkung der gesellschaftlichen Teilhabe neuzugewanderter Frauen beizutragen, braucht es einen Perspektivwechsel!
Möglich wird dieser durch die Einbindung neueingewanderter Frauen als Expertinnen in die (Weiter)Entwicklung der bestehenden Angebote. Wie dies gelingen kann und welche Chancen sich daraus ergeben, möchten wir gemeinsam mit Ihnen und neuzugewanderten Frauen im Rahmen einer Fachtagung am 7. November am Berliner Standort der Robert Bosch Stiftung diskutieren.
Kriege, Klimawandel, Armut – die Gründe, warum Menschen Schutz in Deutschland suchen, sind zahlreich. Zur Jahresmitte 2023 lag die Zahl der Zuwandernden und Schutzsuchenden bereits deutlich höher als im gesamten Jahr 2022. In vielen Städten und Gemeinden sind die Unterkünfte für Geflüchtete voll belegt, langfristiger Wohnraum ist rar. Flucht und Migration werden zu gesellschaftlichen und politischen Konflikt- und Streitthemen. Beim "Migrationsgipfel" im Mai 2023 sagte der Bund den Kommunen für 2023 einmalig eine zusätzliche Milliarde Euro zu.
Das nächste Treffen zwischen Bund und Ländern soll im November 2023 stattfinden. Es gibt viele Baustellen vor Ort: Sprachkurse und Orientierungsangebote müssen ausgebaut werden, es fehlt an Wohnraum, Kita- und Schulplätzen. Städte und Gemeinden bringen je nach Größe, finanzieller Situation oder regionaler Lage unterschiedliche Erfahrungen und Voraussetzungen mit. Alle müssen jedoch für die Unterbringung, das Zusammenleben und die Integration kurz-, mittel- und langfristige Lösungen finden.
Im Seminar sollen u.a. folgende Fragen diskutiert werden:
- Welche Erfahrungen machen Kommunen aktuell? Welche Maßnahmen ergreifen sie, um Lösungen zu finden und Aufnahme und Zusammenleben zu ermöglichen und zu gestalten?
- Wo sehen Kommunen Chancen der gegenwärtigen Entwicklung? Welche Themen und Aufgaben führen zu einer Überforderung?
- Wie können Kommunen ihre Interessen gegenüber Bund und Ländern behaupten und ihre Perspektive im föderalen System besser verständlich machen?
Diese und weitere Aspekte sollen im Seminar anhand konkreter Beispiele aus der kommunalen Praxis und unter Einbeziehung der Erfahrungen der Teilnehmenden diskutiert werden.
-
08.11.2023
Deutschland ist eine Migrationsgesellschaft. Das Zusammenleben befindet sich stetig im Wandel und wird durch aktuelle Entwicklungen geprägt.
- Zu Beginn der Fachkonferenz wird Katharina Warda, Soziologin und Literaturwissenschaftlerin, mit ihrer Keynote zur „Migrationsgesellschaft im Wandel” Gesamtüberblick und Einstieg ermöglichen.
- Mit Rebecca Wienhold fragen wir: Wie beeinflusst Künstliche Intelligenz die Reproduktion von Klischees und diskriminierenden Narrativen?
- Lucía Muriel und Lawrence Oduro-Sarpong von Glokal möchten erörtern: Wie werden Themen wie Dekolonisierung und Klimawandel von der Mehrheitsgesellschaft verhandelt?
- Seyfullah Köse wird an unseren Glaubenssätzen rütteln: Warum sind Widerspruchskompetenzen in Debatten und Kommunikationskultur in der Migrationsgesellschaft wichtig? Welche Widerstände regen sich (bspw. gegen Diversitätspolitik, Identitätspolitik oder Geschlechterpolitik) und wie lässt sich damit umgehen?
Alle Veränderungen, Entwicklungen und Herausforderungen einer sich stetig wandelnden Migrationsgesellschaft wirken sich sowohl auf das Selbstverständnis der Migrationsgesellschaft als auch auf die Repräsentanz und Teilhabe der Menschen aus.
Diese Veränderungen und Herausforderungen wollen wir mit euch im Rahmen unserer Fachkonferenz ansprechen. Was sind die aktuellen Narrative der Migrationsgesellschaft?
Oktober 2023
Das passiert ganz automatisch. Kinder machen bereits im Kleinkindalter ausgrenzende Erfahrungen und wachsen in gesellschaftliche Macht- und Ungleichheitsstrukturen hinein. Der Anti-Bias Ansatz bietet uns einen bunten Strauß von Methoden und Ideen an, um Kindern die Freude an unserer vielfältigen Welt zu vermitteln, ihnen zu einer stabilen Identität und kritischem Denken zu verhelfen. Im Kitaalltag gibt es viele Ansatzpunkte, um an diesen Punkten mit den Kindern zu arbeiten und einzuwirken.
In dieser interaktiven und praxisorientierten Fortbildung lernen Sie antidiskriminierende Denkansätze und Methoden für Ihre pädagogische Arbeitspraxis in Kita und Kindergarten kennen. Es ist ein erfahrungsorientierter Ansatz, mit Raum für Selbstreflexion, Austausch und Erprobung vorurteilsbewusster Kommunikations- und Interaktionsformen. Ziel ist es, unser vorurteilsbewusstes und diskriminierungskritisches Bewusstsein zu schärfen, um es dann an die Kinder weiter zu geben. Spielmaterialien, Kinderbücher und best-Practice-Beispielen ergänzen diese Fortbildung.
-
04.12.2023
Islamistische Radikalisierung und Extremismusprävention als Kinderschutzthema an Grundschulen? Herausforderungen und Transfermöglichkeiten.
Islamistische und auch andere antidemokratische Weltanschauungen stellen eine Gefahr für das Zusammenleben unserer Gesellschaft dar und berühren mitunter auch unmittelbar den Kinderschutz. Lehrkräfte, Schulsozialarbeitende und Mitarbeitende der Kinder- und Jugendarbeit können dabei auf mehreren Ebenen mit Herausforderungen konfrontiert werden. Dabei entstehen Unsicherheiten und Fragen: Wie kann ich Kinder und Jugendliche stärken, mit Loyalitätskonflikten umgehen zu können und mit ihnen ins Gespräch über extremistische Inhalte kommen, denen sie in den Sozialen Medien begegnen? Wie gehe ich mit islamistisch oder salafistisch geprägten Eltern um, wenn diese antidemokratische Äußerungen tätigen? Und wie kann ich reagieren, wenn Schüler*innen menschenfeindliche Inhalte wiedergeben oder sich gewaltvoll verhalten?
In fünf abendlichen Online-Veranstaltungen werden Herausforderungen und Umgangsweisen im Themenfeld beleuchtet und diskutiert.
-
22.10.2023
This unique 8-day international training brings together (youth) workers and other multipliers from various NGOs from Italy, Poland, Romania and North-Macedonia, all of them either representing or working with migrant communities. In times of war and forced migration, racism and discrimination in Europe, we want to use this unique learning opportunity to jointly discover ways to promote diversity, anti-discrimination and inclusion of migrants, particularly through youth and educational work.
- How to engage and work on eye-level with especially young migrants?
- What approaches can be used for empowerment and promotion of active citizenship among migrant communities?
- What are successful methods and lessons learnt from others?
- What kind of possibilities are there for cooperation among NGOs on the international level?
As trainers and participants we will put our heads together to find answers to these questions and innovative impulses for our every-day practice.
Der Krieg in der Ukraine, die Klimakrise oder die Corona-Pandemie – aktuelle Krisen und Konflikte belasten auch Jugendliche in Deutschland. Sie verunsichern, wecken Zukunftsängste und werfen Fragen zu eigenen Perspektiven und Lebensentwürfen auf. Zugleich lenken sie den Blick auf historische Verflechtungen und die Verantwortung, die Deutschland im globalen Kontext zukommt. Der Reflexionstag konzentriert sich auf den Austausch von Erfahrungen und Methoden, um mit Krisen und Konflikten im Unterricht und Schulalltag umzugehen und als Lerngelegenheiten zu gestalten.
Kinder, die - mit Angehörigen oder unbegleitet - nach Deutschland geflüchtet sind, haben besondere Bedarfe: So können traumatische Erfahrungen, aber auch der Verlust des gewohnten sozialen Umfelds und fehlende Zukunftsperspektiven zu ernsten psychischen Belastungen führen. Psychosoziale Unterstützungsangebote für Geflüchtete in Deutschland können hier helfen. Doch die bestehenden Angebote können den derzeitigen hohen Bedarf nur unzureichend abdecken.
Der Fachtag dient als Austausch- und Informationsplattform rund um die aktuelle psychosoziale Versorgung von geflüchteten Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Die Agenda umfasst drei Bereiche, die sich in Bestandsanalyse und aktuelle Herausforderungen in der psychosozialen Versorgung, lösungsorientierte Ansätze für eine Verbesserung der Versorgung, sowie praxisnahe Workshops gliedern. Neben der Vorstellung von innovativen und niederschwelligen Angeboten werden besonders jene Good-Practice-Beispiele aus der psychosozialen Versorgung von geflüchteten Kindern und Jugendlichen in Deutschland und der internationalen humanitären Hilfe diskutiert, die sich besonders unter den aktuellen Herausforderungen bewähren.
Mit dem steigenden Anteil der migrantischen Bevölkerung wächst auch unser Streben nach stärkerer Sichtbarkeit, Anerkennung und politischer Einflussnahme. Es geht darum, ein inklusives gesellschaftliches Umfeld zu schaffen, in dem Menschen unterschiedlicher Herkunft gleichberechtigt teilhaben können. Herkömmliche Trennlinien zwischen „wir“ und „ihr“ verwaschen durch die Pluralisierung zunehmend, wodurch sich neue Zugehörigkeitsmuster ergeben.
Wie können wir sicherstellen, dass Menschen mit Migrationsbiografie in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens angemessen repräsentiert sind?
Welche Rolle spielen Migrant*innenselbstorganisationen bei der Interessenvertretung und in welcher Form müssen sie sich den neuen Entwicklungen anpassen, um zukunftsfähig zu bleiben?
Was ist wichtig, damit ich für geflüchtete Kinder, Jugendliche und Familien übersetzen kann? Was kann ich tun, wenn die Übersetzung mich sehr belastet? Wie kann ich mich selbst schützen? In dem Workshop informieren die Psychotherapeutin Susanne Hirschmann und die psychosoziale Beraterin Melanie Graschtat aus dem Psychosozialen Zentrum von IBIS e.V. zu Herausforderungen in der Sprachmittlung/Übersetzung. Im Anschluss können Sie über Ihre eigenen Erfahrungen sprechen und sich in der Gruppe mit anderen Übersetzer_innen zu Strategien im Umgang mit Belastungen austauschen. Außerdem werden Techniken zum Selbstschutz und zur Selbstfürsorge vorgestellt und können ausprobiert werden.
Derzeit ist von einer Zunahme der Respektlosigkeit in unserer Gesellschaft die Rede. Gerade bei jungen Menschen wird ein Mangel an Respekt und ein Anstieg der Gewaltbereitschaft behauptet. Diskussionen zu dieser Thematik werden nicht selten nach Vorkommnissen geführt, häufig verbunden mit einem Medieninteresse.
Welche Möglichkeiten bestehen, um Respekt und Toleranz zu fördern?
Die Fachtagung möchte Optionen aufzeigen. Neben Sensibilisierung und Information will die Veranstaltung Möglichkeiten zur Vernetzung geben. Die Teilnahme ist kostenfrei.
Der Vortrag von Prof. Dr. Dirk Baier setzt sich mit Thema "Jugendgewalt" Aktuelle Trends und Folgerungen" auseinander.
Fünf Workshops mit unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten zeigen Handlungsoptionen zur Förderung von Respekt und Toleranz. Am Vor- und Nachmittag haben die Teilnehmenden die Gelegenheit, jeweils zwei von fünf der angebotenen Workshops zu besuchen.
Deutschland ist eine Migrationsgesellschaft, in der Migration faktisch anerkannt ist und prinzipiell eine gesellschaftliche Normalität ist. Jedoch können nicht alle Menschen gleichberechtigt an gesellschaftlichen Prozessen teilhaben, da mit dem Verweis auf „Migration“ weiterhin Unterscheidungen von Gruppenzugehörigkeiten vorgenommen werden. Das stellt die schulische und außerschulische Demokratiebildung vor eine Herausforderung: Wie kann in einer Gesellschaft mit migrationsbedingter Ungleichheit demokratiepädagogische Arbeit gelingen?
Auf dem Fachtag soll diskutiert werdenn, welche Ansätze die schulische und außerschulische demokratiepädagogische Praxis in Bezug auf Ausgrenzungen hinsichtlich von Migration anbietet. Dabei wird eine engere Verknüpfung zwischen wissenschaftlicher Theorie und pädagogischer Praxis im Sinne von Handlungsorientierung und Reflexion angestrebt. Organisiert wird der Fachtag von der DeGeDe im Kompetenznetzwerk „Demokratiebildung im Jugendalter.”
-
18.10.2023
Mädchen* werden in der Präventionsarbeit, auch im Bereich des islamisch begründeten Extremismus, häufig übersehen oder nicht ernst genommen. Deshalb möchten wir im Oktober bei einer Fortbildung im Rahmen unseres Projekts M*iA – Mädchen im Austausch diskutieren, welche Rolle Frauen* im islamisch begründeten Extremismus spielen, welche Gendervorstellungen in dieser Ideologie anzutreffen sind und wie sich die Rekrutierung online und offline gestaltet. Vor allem aber werden wir mittels interaktiver Methoden erarbeiten, welche Strategien es im Umgang mit radikalisierungsgefährdeten Mädchen* gibt und Erfahrungen präsentieren, die cultures interactive e.V. bereits in früheren Projekten sowie mit M*iA sammeln konnte.
Die zweitägige Fortbildung richtet sich an Fachkräfte der Jugendarbeit und findet online über Zoom am 4. und am 18. Oktober 2023 statt, jeweils von 17 bis 20 Uhr.
September 2023
-
28.09.2023
Anlässlich des 5-jährigen Bestehens des DeZIM findet am 27. und 28. September 2023 eine internationale Konferenz in Berlin statt.
Die Migrations- und Integrationsforschung steht angesichts der Dringlichkeit und gesellschaftlichen Relevanz ihrer Themen vor enormen Anforderungen und Aufgaben. Diese werden durch eine globale Situation mit zahlreichen Krisen wie Pandemien, Wirtschaftskrisen, Klimawandel und Kriegen mitgeprägt und erschwert.
Unter dem Titel „Such great need - so little time?! Social research on postmigrant societies in times of multiple crises” wollen wir zentrale Herausforderungen der empirischen Forschung diskutieren - und auch ihre ethischen, methodischen und gesellschaftlichen Implikationen:
- Der gesellschaftliche Handlungsdruck erfordert eine zeitnahe Produktion solider wissenschaftlicher Erkenntnisse.
- Es besteht eine zunehmende Nachfrage seitens der Zivilgesellschaft und öffentlicher Einrichtungen nach einer Beteiligung an der Wissensproduktion.
- Mehrfache Krisen führen zu raschen Veränderungen der Randbedingungen und Phänomene der Forschung.
Ehrenamtliches bzw. freiwilliges Engagement kann beim Empowerment unterstützen – gibt es vergleichbare Strukturen in Herkunftsländern? Welche partizipativen Möglichkeiten kennen die Zugewanderten aus ihren Ländern? Ist die Vernetzung in der Zivilgesellschaft hier eine neue Erfahrung? Kennen sie die verschiedenen Möglichkeiten, sich hier in Deutschland freiwillig zu engagieren?
Gibt es Best Practice Modelle – Beispiele für erfolgreiches Ankommen und Empowerment durch den Einsatz in ehrenamtlichen Strukturen?
Auf dem Fachtag wollen wir zusammen mit Engagierten einen kritischen Blick auf unterschiedliche kulturelle Verständnisse von (ehrenamtlichem) Engagement werfen und darüber sprechen, was beim Prozess einer erfolgreichen Integration in Deutschland hilft – oder wo die Erwartungen der Aufnahmegesellschaft nicht passen.
Das Projekt mit seinen Kooperationspartner*innen stellt sich vor und lädt zum Mitmachen ein.
Die Veranstaltung wird in Kooperation mit dem Beauftragten für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen und dem Referenten für Ehrenamt bei der Diakonie SH durchgeführt.
-
28.09.2023
Das DeZIM-Institut feiert in diesem Jahr sein 5-jähriges Bestehen. Wir freuen uns, Sie aus diesem Anlass zu unserer Jahreskonferenz am 27. und 28. September 2023 in Berlin einzuladen.
Unter dem Titel „Migrationsforschung in Zeiten multipler Krisen“ wollen wir aktuelle Entwicklungen und Perspektiven der Forschung zu zentralen gesellschaftlichen Fragen mit Ihnen und weiteren Gästen diskutieren.
Die Migrations- und Integrationsforschung steht angesichts der Dringlichkeit und gesellschaftlichen Relevanz ihrer Themen vor enormen Anforderungen und Aufgaben. Diese werden durch die globale Situation mit zahlreichen Krisen wie Pandemien, Wirtschaftskrisen, Klimawandel und Kriegen mitgeprägt und erschwert. Vor diesem Hintergrund stellen sich für die empirische Forschung mehrere wichtige Herausforderungen:
- Der gesellschaftliche Handlungsdruck erfordert, zeitnah solide wissenschaftliche Erkenntnisse zu produzieren.
- Es besteht eine zunehmende Nachfrage seitens der Zivilgesellschaft und öffentlicher Einrichtungen, sich an der Wissensproduktion zu beteiligen.
- Mehrfache Krisen führen zu raschen Veränderungen der Randbedingungen und Phänomene der Forschung.
Wie in den Jahren zuvor, veranstalten die Malteser auch in diesem Jahr einen Fachtag zum Thema Gewaltschutz in Flüchtlingsunterkünften. Der Schwerpunkt der diesjährigen Veranstaltung ist die Ausschreibung, welche einen qualitätssteuernden Effekt auf den Bedingungen in den Unterkünften darstellen kann.
"Der Fachtag legt den Fokus auf aktuelle Herausforderungen. Einen qualitätssteuernden Effekt in Bezug auf Gewaltschutz in Unterkünften nutzen die Kommunen und Länder mittels Ausschreibung. Wir freuen uns, Referenten zu diesem Schwerpunkt von verschiedenen Perspektiven gewonnen zu haben. Neben Inputreferaten gibt es auch wieder die Möglichkeit, Fragen an die Experten zu stellen und sich weiträumig zu vernetzen. Aber auch die Professionalisierung im Bereich Sozialbetreuung mit angepasstem Schulungsangebot stellt sich vor, um dem Fachkräftemangel zu begegnen. Weitere Themen des Fachtages nehmen die derzeitigen Fragen der Länder und Kommunen Mitteldeutschlands auf und Best Practice werden eingebracht.
Zum Fachtag sind vorrangig Entscheidungsträger von Länder- und Kommunalebene, aber auch Betreiber und Trägerorganisationen aus Mitteldeutschland herzlich eingeladen."
-
27.09.2023
Öffentliche Debatten über diese Fragen wurden in den letzten Jahren oft stark polarisierend geführt. Damit verbundene Themen wie der Nahostkonflikt oder das Gedenken an die Shoah und andere Massenverbrechen haben große Sprengkraft und rufen starke Emotionen hervor, insbesondere in heterogenen Gruppen mit unterschiedlichen Perspektiven und Positionen in der Gesellschaft.
In der Fortbildung wollen wir uns gemeinsam Ansätze zum Umgang mit diesen Spannungsfeldern erarbeiten. Wie können wir uns konstruktiv und solidarisch mit ihnen beschäftigen, um verbindend zu wirken, statt Trennungen und Ausschlüsse zu (re-)produzieren?
Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem BildungsBausteine-Projekt 'Zusammen_denken, zusammen handeln' (www.zusammen-denken-handeln.de) statt, das vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms 'Demokratie leben!' sowie der Berliner Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung im Rahmen des Landesprogramms gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus gefördert wird.
Bundes- und insbesondere hessenweit nimmt die Zahl von Flüchtlingen aus der Türkei weiter zu. In den ersten sieben Monaten des Jahres 2023 wurden in Deutschland über 23.000 Asylanträge von Personen aus der Türkei gestellt, mehr als doppelt so viele wie im Jahr zuvor. Im Juli 2023 liegt die Türkei auf Platz 2 der am stärksten vertretenen Herkunftsländer von Asylsuchenden und überholt damit Afghanistan. Die Anerkennungsquote des BAMF liegt bei knappen 15%.
Die Türkei wird öffentlich überwiegend als Aufnahmeland für Geflüchtete aus Syrien und Kooperationspartner der EU zur Migrationssteuerung wahrgenommen. Im Rahmen der Fortbildungsveranstaltung möchten wir deshalb die Situation von Geflüchteten aus der Türkei in den Fokus rücken. Wir möchten besprechen, welche Ursachen Menschen aus der Türkei dazu zwingen, ihr Herkunftsland zu verlassen und in Europa Schutz zu suchen. Diese Erkenntnisse werden flüchtlingsrechtlich eingeordnet und durch Entscheider des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge und Berthold Fresenius, Rechtsanwalt, kommentiert. Sie erhalten wichtige Hinweise zur Beratung von Schutzsuchenden aus der Türkei.
Hybridveranstaltung zur Vorstellung der Projekt- und Evaluationsergebnisse sowie des übertragbaren Trainingskonzepts.
Seit Juli 2020 begleitet die Stiftung Deutsches Forum für Kriminalprävention (DFK) das unter anderem mit EU-Mitteln aus dem Programm „Soziale Innovation“ geförderte Projekt „BROTHERS – Gewaltprävention bei (geflüchteten) Jugendlichen supported by HEROES“. Das Projekt setzt explizit bei der präventiven Jungenarbeit im Kontext von Ehre an und adressiert erstmalig und erfolgversprechend auch junge geflüchtete Männer. Damit greift der Projektansatz der Bonveno Göttingen gGmbH Themen auf, die in der aktuellen öffentlichen Debatte unter den Schlagzeilen „Integration“, „Flüchtlingskrise“ und „toxische Männlichkeit“ besonders polarisieren.
In wöchentlichen Treffen werden junge Männer, die u.a. durch Flucht und Migration bestimmten Risikofaktoren unterworfen sind, zu Multiplikatoren für eine geschlechtergerechte Gesellschaft, den sogenannten BROTHERS, ausgebildet. Darüber hinaus werden in Workshops Reflexionsformate unter anderem für Schulklassen aber auch für Fachkräfte angeboten. Der gesamtgesellschaftliche Projektansatz stellt dabei nachweislich erfolgreich sowohl tradierte Rollenbilder und damit verbundene Gewaltlegitimationen als auch gesellschaftliche Verhältnisse zur Diskussion.
Die Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung, Wiebke Osigus, freut sich, Ihnen gemeinsam mit den Projektpartnern das Projekt, seine Ergebnisse und auch die vielversprechenden Erkenntnisse der unabhängigen Wirkungsevaluation durch das Evaluationsinstitut Camino vorzustellen.
-
22.09.2023
Neun Monate nach Beginn des neuen ESF Plus Förderprogramms "WIR - Netzwerke integrieren Geflüchtete in den regionalen Arbeitsmarkt" und 264 Tage nach Einführung des Chancen-Aufenthaltsrechts ist es Zeit für eine erste kritische Bestandsaufnahme.
Der Flüchtlingsrat Niedersachsen als Koordination des WIR-Netzwerkes "AZG - Arbeitsmarktzugang für Geflüchtete" lädt zu dieser Fachtagung ein, mit der wir den Austausch unter den Mitarbeiter:innen, die in Arbeitsmarktprojekten für Geflüchtete tätig sind, fortführen wollen. Einen Fokus wollen wir dabei auf die Erfahrungen mit dem Chancen-Aufenthaltsrecht legen, die die Lebensrealität vormals Geduldeter maßgeblich beeinflussen dürfte. Aber auch spezielle Angebote für Frauen, Schulungen, Bildungs- und Ausbildungsfragen sowie Fragen der beruflichen Teilhabe von Frauen sollen vorgestellt und diskutiert werden. Und nicht zuletzt wollen wir die Erfahrungen in der Aufnahme Geflüchteter aus der Ukraine reflektieren: Welche positiven Erfahrungen können wir festhalten? Welche Möglichkeiten eröffnen sie uns in Fragen der Teilhabe für Geflüchtete aus anderen Kriegs- und Krisensituationen? Abrunden wollen wir die Tagung mit einem Blick auf die neusten Entwicklungen in der Asyl- und Flüchtlingspolitik der EU, in der sich die fortgesetzte Tendenz zur Externalisierung des Flüchtlingsschutzes ablesen lässt.
-
21.09.2023
Bei der Betrachtung des Einzelfalls werden mögliche Erklärungen für eine Radikalisierung oftmals auf der individuellen Ebene verortet – dies ergibt jedoch ein nur unvollständiges Bild. Inwiefern kann Radikalisierung bzw. die Hinwendung zu extremistischen Ideologien und Gruppierungen auch als mögliche Bewältigungsstrategie angesichts struktureller gesamtgesellschaftlicher Problemlagen verstanden werden? Welche Implikationen ergeben sich aus dieser Perspektive für die Ausrichtung von Präventionsstrategien und -ansätzen? Und welchen Stellenwert sollte die Betrachtung radikalisierungsbegünstigender Aspekte gesellschaftlicher Strukturen in der Präventionsarbeit einnehmen?
Diesen und weiteren Fragen möchten wir uns gemeinsamen mit Ihnen bei unserem diesjährigen Fachtag „Radikalisierung als Bewältigungsstrategie? Prävention zwischen struktureller und individueller Ebene“ am 20. und 21. September 2023 in Frankfurt am Main annehmen.
-
19.09.2023
-
17.09.2023
Auf der Tagung wird das Verhältnis des Verschwörungsglaubens zu verschiedenen menschenfeindlichen Einstellungen und demokratiebedrohenden Narrativen thematisiert. Auch behandeln wir Handlungs- und Gesprächsstrategien für den Umgang mit Verschwörungsgläubigen. Dabei richtet sich die Veranstaltung insbesondere auch an Menschen mit entsprechenden Erfahrungen im Freund*innenkreis, in der Familie oder am Arbeitsplatz.
Sie haben Lust sich mit anderen Fachkräften zu den Themen Diskriminierung, Diversität, Rassismuskritik, Sexismuskritik und Intersektionalität auszutauschen? Sie fühlen sich vielleicht allein in Ihrer Institution oder Familien- und Freund*innenkreis und suchen einen Raum, in dem sie Gleichgesinnte treffen können? Sie möchten selbstreflexiv über Ihre eigene Praxis nachdenken und von Fallbeispielen der anderen lernen? Sie möchten einen Mini-Input hören und danach mit anderen Expert*innen ins Gespräch kommen?
Dann sind Sie herzlich eingeladen, an dem Runden Tisch teilzunehmen.
Es handelt sich bei dem Austauschforum um einen informellen Raum, der von den Trainerinnen von vielgestaltig* 2.0 moderiert wird. Sie haben darin die Möglichkeit, andere Fachkräfte zu treffen, miteinander zu diskutieren und mögliche Kooperationen auszuloten. Zudem ist es ein Forum, in dem verschiedene Soziale Projekte im Raum Niedersachsen (und darüber hinaus) kennengelernt werden können. Dadurch bekommen Sie einen besseren Überblick über die Projektlandschaft in den Bereichen Migration, Asyl, Gleichstellung, Jugendarbeit und politische Bildungsarbeit.
Wie kann ich in meiner pädagogischen Arbeit auf antimuslimischen Rassismus reagieren und diesem entgegenwirken? Die Fachstelle für Pädagogik zwischen Islam, antimuslimischem Rassismus und Islamismus in Berlin bietet hierzu im Juni und September zwei ganztägige Fortbildungen. Pädagogische Mitarbeitende aus Schule, Sozialarbeit und außerschulischer Bildungsarbeit sind herzlich eingeladen, daran teilzunehmen und Anregungen zum Umgang mit Religion, Resilienz und Rassismus für ihre Arbeit mitzunehmen.
Wie kann ich in meiner pädagogischen Arbeit auf antimuslimischen Rassismus reagieren und diesem entgegenwirken? Die „Fachstelle für Pädagogik zwischen Islam, antimuslimischem Rassismus und Islamismus in Berlin“ bietet hierzu im September eine ganztägige Fortbildung an. Pädagogische Fachkräfte aus Schule, Sozialarbeit und außerschulischer Bildungsarbeit, die in Berlin tätig sind, sind herzlich eingeladen, daran teilzunehmen und erhalten Anregungen für den Umgang mit Religion und Rassismus in ihrer Arbeit.
Als Alltagsphänomen berührt Rassismus jede*n von uns: Denn sowohl rassistische Strukturen als auch Denk- und Handlungsweisen sind historisch gewachsen und in unserer Gesellschaft verankert. Die Beschäftigung mit Rassismus bildet daher eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die sich nicht auf die NS-Vergangenheit oder Rechtsextremist*innen beschränkt.
In der Fortbildung wollen wir unaufgeregt für antimuslimischen Rassismus – auch in Verbindung mit anderen Diskriminierungsformen – sensibilisieren und eine Auseinandersetzung mit alternativen Handlungsmöglichkeiten anregen. Welche Vorurteile und Rassismen sind weit verbreitet, welche (unbewussten) Vorurteile habe ich selbst? Welche Rolle spielt meine persönliche Haltung zu Religion? Was verbirgt sich z.B. hinter dem Begriff „Islamkritik“?
Darüber hinaus soll das Verhältnis zwischen Alltags- und strukturellem Rassismus thematisiert werden. Wie kann ich als Multiplikator*in, z.B. in der Schule, Betroffene von diskriminierenden oder rassistischen Äußerungen unterstützen und stärken? Welche Strukturen und Institutionen können dabei mitgedacht werden?
-
13.09.2023
Vom 12. bis zum 13. September 2023 findet die kostenfreie Online-Tagung der Niedersächsischen Landeszentrale für politische Bildung zum Thema rassismuskritische politische Bildung statt. Eingeladen sind Praktiker_innen der politischen Bildung, der Sozialen Arbeit, der Jugendarbeit sowie aus Kunst und Kultur, die ein solides Grundwissen zum Thema mitbringen und sich mit weiterführenden Fragen auseinandersetzen wollen. Auch Menschen aus anderen Arbeitsfeldern, die sich in ihrer Arbeit mit Rassismus und Rassismuskritik befassen, sind herzlich zur Teilnahme eingeladen.
Im Rahmen der Tagung wird eine grundlegende rassismuskritische Haltung der politischen Bildner_innen und eine entsprechende Ausrichtung der Bildungseinrichtungen sowie ihrer Bildungsarbeit diskutiert. Die Tagung richtet sich an Menschen in Niedersachsen. Besonders ermutigen wir rassismuserfahrene Menschen zur Teilnahme.
Die Teilnehmenden erhalten die Möglichkeit zum fachlichen Austausch und zur Vernetzung. Die Online-Tagung strebt an, wissenschaftliche, außeruniversitäre sowie aktivistische Perspektiven zu dem Thema rassismuskritische politische Bildung miteinander zu verknüpfen. Wir freuen uns auf ein vielfältiges Programm aus einem Input, Workshops sowie Austausch und Vernetzungsräumen.
-
13.09.2023
Distanzierungsarbeit verstehen wir als gesamtgesellschaftlichen Auftrag. Multiperspektivische Ansätze sind die Grundlage für eine erfolgreiche Zusammenarbeit verschiedener Akteur*innen.
Herzlich eingeladen sind Fachkräfte aus der zivilgesellschaftlichen Praxis, Wissenschaftler*innen, Mitarbeitende aus Ministerien, Justizvollzugsanstalten, Sicherheitsbehörden, Bewährungs- und Jugendgerichtshilfe, Fachkoordinierungsstellen Extremismus sowie Landesdemokratiezentren.
In unterschiedlichen Formaten zum Austauschen und Nachdenken werden wir Perspektiven und Arbeitsansätze diskutieren, Erfahrungen und (Fach-)Wissen miteinander teilen, uns vernetzen und gegenseitig stärken.
Eröffnet wird die Veranstaltung durch eine Videobotschaft der Bundesfamilienministerin Lisa Paus. Im Anschluss nehmen die Gründer*innen und Geschäftsführer*innen Judy Korn und Thomas Mücke Sie mit auf eine Zeitreise: 22 Jahre Extremismusprävention und Arbeit in Strafvollzug und Bewährungshilfe. Außerdem wird das von Violence Prevention Network entwickelte Sozialpädagogische Diagnostikverfahren – essenzieller Bestandteil gelingender Distanzierungsarbeit – vorgestellt.
Wie dieses in die Praxis übertragen und im Arbeitsalltag umgesetzt werden kann und wie Beteiligte unterschiedlicher Berufsfelder zielführend agieren können, werden wir im Rahmen von vier Podiumsdiskussionen gemeinsam mit Ihnen erörtern.
August 2023
In dieser Fortbildung werden wir uns mit Vorurteilen und Fakten über Suizidalität im allgemeinen Kontext und im Zusammenhang mit Flucht und Asyl auseinandersetzen. Ein Schwerpunkt der Fortbildung ist die Identifikation von Risikofaktoren, die bei geflüchteten Menschen zu Suizidalität führen können. Wir werden auch darauf eingehen, wie wir Suizidalität bei geflüchteten Menschen erkennen und einschätzen können, welche Schutzfaktoren und Handlungsmöglichkeiten es gibt. Wir werden speziell auf die besonderen Herausforderungen eingehen, die sich bei der Suizidprävention in Unterkünften für geflüchtete Menschen ergeben. Dabei werden wir auch diskutieren, wie wir als Fachkraft angemessen und sensibel auf Suizidalität reagieren können, um Betroffenen Hilfe und Unterstützung zu bieten. Ziel der Fortbildung ist es, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein fundiertes Verständnis von Suizidalität im Kontext von Flucht und Asyl zu vermitteln und sie mit Handlungsmöglichkeiten auszustatten, um im Bedarfsfall angemessen zu reagieren. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.
Referenten sind M.Sc. Psychologen Len-Julian Liebelt, Severin Schultheiß
Jeder Mensch hat vor, während und nach der Geburt das Recht auf Hebammenhilfe – das gilt auch für Geflüchtete! Doch wie ist die Situation von geflüchteten, schwangeren Personen in den kommunalen Sammelunterkünften? Welche Versorgung und Unterstützung bekommen die werdenden Mütter und anschließend auch im Wochenbett? Wo gibt es unterstützende Strukturen? Wie gelingt Hebammenhilfe trotz möglicher Sprachbarrieren und welche Informationen brauchen Fachkräfte vor Ort?
Im Rahmen der Online-Fachtagung wollen wir gemeinsam mit Fachleuten die Lage beleuchten, vorhandenes Wissen vernetzen und voneinander lernen. Die Veranstaltung in Kooperation mit dem Flüchtlingsrat Niedersachsen und dem Aktionsbüro rund um die Geburt Niedersachsen richtet sich an Akteure rund um Schwangere und Geburt, der Sozialen Arbeit mit Geflüchteten, Behördenvertreter:innen, ehrenamtlich Engagierte sowie weitere interessierte Personen.
Eine Stärke der Gemeinwesenarbeit (GWA) ist die Vielfalt der Menschen, die sich in der Nachbarschaft begegnen. Doch das geht nicht immer ohne Reibung. Viele Konflikte entstehen im Quartier, im Stadtteil, im Dorf aufgrund von gruppenbezogenen Vorurteilen – seien sie auf die Herkunft, die kulturelle oder religiöse Zugehörigkeit, das Alter, das Geschlecht oder ein anderes Merkmal einer Gruppe bezogen. Manchmal ist es auch nur die eine oder andere Straßenseite…
Aus der Erfahrung und der Wissenschaft wissen wir, dass solche gruppenbezogenen Vorurteile mit Kontaktmaßnahmen reduziert oder sogar ausgeräumt werden können, wenn sie bestimmte Vorgaben und Rahmenbedingungen erfüllen. Genau das haben Partner*innen aus der GWA-Praxis ausprobiert, Modellmaßnahmen entwickelt und umgesetzt. Evaluiert und begleitet wurden sie dabei von dem Forschungsinstitut proVal und der LAG Soziale Brennpunkte Niedersachsen e.V., den Rahmen und die Mittel dafür stellte das Landesprogramm für Demokratie und Menschenrechte (LPR) bereit.
In dieser Veranstaltung stellen wir „Kontaktmaßnahmen zum Abbau von Vorurteilen in der GWA“ vor, zeigen Faktoren für deren Gelingen auf und beschreiben dazu auch die Wirkungsorientierung von Maßnahmen praktisch.
Rahmend ordnet Deniz Kurku, der Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe in Niedersachsen, für uns die Bedeutung von Vorurteilen in den größeren Kontext des gesellschaftlichen Zusammenhalts ein. proVal berichtet über die hilfreiche Wirkungszentrierung in den Kontaktmaßnahmen und Vertreter*innen aus dem LPR und der LAG SB stellen sie in den Praxiskontext von Prävention und GWA.
Juli 2023
Die letzte Veranstaltung der Vortragsreihe "Radikalisierung und Prävention: Soziale Arbeit bringt sich ein" diskutiert Herausforderungen und Möglichkeiten der politischen Bildung im Rahmen der Schulsozialarbeit.
Im Mittelpunkt der Vortragsreihe steht der interdisziplinäre Austausch in der Sozialen Arbeit zu aktuellen Radikalisierungsdynamiken in Deutschland. Die Beiträge bieten verschiedene Zugänge zum Thema Radikalisierung und Prävention – auch auf lokaler Ebene. Diskutiert werden vielfältige Perspektiven aus der Radikalisierungsforschung und Präventionspraxis.
Die Veranstaltung findet hybrid statt und richtet sich an Forscher:innen, Praktiker:innen, Lehrende, Studierende und alle interessierten Personen. Die Teilnahme ist sowohl in Präsenz als auch online via Zoom möglich.
Das Bundesamt lehnt Asylanträge von Schutzsuchenden ab, weil gemäß der Dublin-III-Verordnung ein anderer europäischer Staat für die Durchführung des Asylverfahrens zuständig sei.
Die Fortbildung bietet einen Überblick über die Grundlagen des Verfahrens:
- Nach welchen Kriterien bestimmt das BAMF den zuständigen Staat?
- Wie sieht ein Dublinbescheid aus und welche Rechtsbehelfe sind möglich?
- Welche Argumente gegen eine Überstellung können an welcher Stelle vorgetragen werden?
- Was hat es mit der Überstellungsfrist auf sich und wann hilft z.B. Kirchenasyl?
Die Fortbildung richtet sich an Teilnehmende, die keine oder geringe Vorkenntnisse im Hinblick auf Dublinverfahren haben. Es besteht die Möglichkeit, bis 30.06.2023 per Mail Fragen an die Referentin maria.bethke@diakonie-hessen.de zu richten, die nach Möglichkeit bei der Konzeption berücksichtigt werden.
Juni 2023
Zahlreiche Studien zeigen, dass Menschen, die als Muslim*innen wahrgenommen werden, vielfach pauschale Abwertung und Diskriminierung auf verschiedenen Ebenen erfahren. In unserem Workshop fragen wir, was antimuslimischer Rassismus ist und was er mit uns zu tun hat.
Die Online-Veranstaltung im Rahmen der Aktionswoche gegen antimuslimischen Rassismus bietet eine Einführung ins Thema.
Die Teilnehmenden sind eingeladen, Fremd- und Selbstbilder zu reflektieren und eigene Privilegien, Positionierungen und Handlungsmuster zu hinterfragen. Sie erfahren dadurch mehr über Islam- und Muslim*innenfeindlichkeit als eine Form von Rassismus, lernen, rassistische Strukturen unserer Gesellschaft zu erkennen und entwickeln gemeinsam Strategien im Umgang mit antimuslimischem Rassismus in der Kinder- und Jugendarbeit.
Diese Weiterbildung vermittelt einen Überblick über die Zusammenhänge zwischen Asyl- und Strafrecht. Es soll darum gehen, die notwendigen rechtlichen Grundlagen zu vermitteln und einen Austausch über die aktuellen Herausforderungen in den Themenfeldern bei der Beratung von Asylsuchenden zu ermöglichen.
- kurze Einführung in das Strafrecht, u.a. Umgang mit einer Vorladung und Hinweisen zu den Rechten eines*r Beschuldigten und Zeug*in
- Auswirkungen von Delikten auf die aufenthaltsrechtliche Situation sowie Handlungsmöglichkeiten
- Auswirkungen von Äußerungen über Straftaten im Rahmen des Asylverfahrens sowie Handlungsmöglichkeiten.
Es wird die Möglichkeit für Fragen und Diskussion geben. Konkrete Einzelfälle können im Rahmen der Veranstaltung ggf. im Detail besprochen werden.
In dieser Online-Schulung vermitteln wir Ihnen ein Grundverständnis der rechtlichen Situation von Asylsuchenden. Wie laufen die Aufnahme und das Asylverfahren in NRW ab? Welche Folgen hat die Entscheidung über den Asylantrag? Welche Rechte und Pflichten haben Asylsuchende?
Das ermöglicht es Ihnen, die Anliegen von Schutzsuchenden besser einzuordnen und einzuschätzen, wann Beratung oder rechtliche Vertretung notwendig werden. Es besteht die Gelegenheit für Fragen und Austausch.
Die Fortbildung „Grundlagen des Asylverfahrens: Materielles Flüchtlingsrecht und Rechte und Pflichten im Asylverfahren “ bietet als Basis Qualifizierung einen Überblick über die verschiedenen Aufenthaltstitel nach der Genfer Flüchtlingskonvention und Grundgesetz sowie Rechte und Pflichten im Asylverfahren. Die Fortbildung dient als Einführung in die Asylverfahrensberatung und für die tägliche Beratungspraxis mit geflüchteten Menschen im Asylverfahren.
-
13.06.2023
Der 28. Deutsche Präventionstag findet am 12. und 13. Juni 2023 als zweitägige Präsenzveranstaltung in Mannheim statt. Mit einem breiten Angebot an Vortragsformaten sowie einer großen Ausstellung wird dem fachspezifischen Informationsaustausch und den persönlichen Begegnungen der Fachpraxis umfassend Raum gegeben.
Das Schwerpunktthema des 28. Deutschen Präventionstages lautet „Krisen & Prävention“. Kurzgefasst umfasst dies Debatten über Wahrnehmungen, Auswirkungen, Umgangsweisen und präventive Lösungsansätze aktueller Krisen. Als krisenhaft werden mehrere Entwicklungen bezeichnet: u.a. die Klimakrise, die Pandemie, die weltweiten Flüchtlingsbewegungen oder sich verschärfende gesellschaftliche Konfliktlinien. Näheres zum Kongressgutachten, das zehn thematische Expertisen zum Schwerpunktthema umfassen wird, finden Sie hier. Neben dem Schwerpunkt „Krisen & Prävention“ werden auch alle anderen aktuellen Themenfelder der Gewalt- und Kriminalprävention bis hin zu dem erweiterten Spektrum von Suchtprävention, Public Health und Verkehrsprävention im Rahmen des Kongresses diskutiert.
Wie kann ich in meiner pädagogischen Arbeit auf antimuslimischen Rassismus reagieren und diesem entgegenwirken? Die Fachstelle für Pädagogik zwischen Islam, antimuslimischem Rassismus und Islamismus in Berlin bietet hierzu im Juni und September zwei ganztägige Fortbildungen. Pädagogische Mitarbeitende aus Schule, Sozialarbeit und außerschulischer Bildungsarbeit sind herzlich eingeladen, daran teilzunehmen und Anregungen zum Umgang mit Religion, Resilienz und Rassismus für ihre Arbeit mitzunehmen.
In den letzten Jahren ist das gesellschaftliche und politische Bewusstsein für die Verfolgung aufgrund von sexueller Orientierung und geschlechtlicher Identität gewachsen. Dennoch befinden sich viele LSBTIQ*-Flüchtlinge weiterhin in einer äußerst prekären Situation – oft werden sie mit Abwertung, Ausgrenzung und Diskriminierung konfrontiert.
Gerne möchten wir daher mit Ihnen über folgende Fragen reden: Wie können Begegnungen zwischen Ehrenamtlichen und Schutzsuchenden so gestaltet werden, dass Letztere sich mit diesen teils sehr intimen Themen auseinandersetzen können und bspw. keine Angst vor einem Coming-Out haben müssen? In welchen Bereichen brauchen LSBTIQ*-Flüchtlinge besondere Unterstützung? Werden in der kommunalen und der Landesunterbringung Gewaltschutzkonzepte für queere Personen umgesetzt?
-
09.06.2023
Nach drei Jahren pandemiebedingter Pause ist es 2023 endlich wieder so weit: Vom 5. bis 9. Juni lädt cultures interactive e.V. ein in die alte Nudelfabrik Zeitz in Sachsen-Anhalt zur Summer School! Summer School – das bedeutet fünf Tage Bildungsfestival mit Fachaustausch, Weiterbildung, Vernetzung und Perspektivwechsel.
2023 nimmt die Summer School die veränderten Anforderungen der Rechtsextremismusprävention im Feld der Jugend(sozial)arbeit in den Blick: Wie sieht eine zeitgemäße Prävention mit Blick auf den aktuellen Rechtsextremismus aus? Welchen Auftrag und welche Grenzen hat die Rechtsextremismusprävention und von welchen gelungenen Ansätzen können wir lernen? In Fachvorträgen, Workshops, Diskussionsrunden und Werkstätten möchten wir vom 5. bis 9. Juni 2023 mit Ihnen zu diesen Fragen in den Austausch kommen und dabei voneinander lernen, gemeinsam diskutieren, streiten und natürlich eine gute Zeit verbringen.
Jeder Tag der Summer School steht unter einem eigenen Thema und beginnt vormittags mit einem Fachvortrag zu dem jeweiligen Tagesschwerpunkt. Von Dienstag bis Donnerstag bieten dann im Anschluss stattfindende parallele Workshops vertiefende Einblicke in das Tagesthema. Nach einer gemeinsamen Mittagspause wird das Thema in den Workshops weiter erarbeitet, bevor das Gehörte und Erlebte in einer Teilnehmendenwerkstatt reflektiert und auf den eigenen Arbeitskontext übertragen werden kann.
In dieser Veranstaltung möchten wir uns gemeinsam mit Ihnen über die Menschenrechte im Zusammenhang mit der Sozialen Arbeit austauschen. In wie fern werden Menschenrechte in der Sozialen Arbeit berücksichtigt? In welchen Bereichen werden die Menschenrechte nicht berücksichtigt bzw. verletzt und wie kann die Soziale Arbeit unterstützen und intervenieren?
Weiterhin wird es eine Walking Gallery mit Menschenrechtsverletzungen und eine Podiumsdiskussion mit Akteuren aus verschiedenen Arbeitsbereichen der Sozialen Arbeit geben. Beiträge aus dem Publikum sind ebenfalls herzlich willkommen.
In einer durch Einwanderung geprägten Gesellschaft sind Schulklassen zunehmend divers, auch was die Religionszugehörigkeit der Schüler/-innen angeht. Dadurch stehen Lehrkräfte vor der Herausforderung, einerseits unterschiedliche Perspektiven einzubeziehen und andererseits darauf zu achten, dass Religionszugehörigkeit nicht pauschal als einzig prägendes Identitätsmerkmal und Erklärungsmuster für Verhalten herangezogen wird. Wie beeinflussen die aktuellen öffentlichen Diskussionen über den Islam unsere eigene Wahrnehmung und damit auch unsere pädagogische Praxis? Wie können Lehrerinnen und Lehrer dazu beitragen, dass Menschen nicht auf ihr "Muslimisch-sein" reduziert werden? Wie gelingt es, muslimischen Schülerinnen und Schülern zuzugestehen, dass ihre Religionszugehörigkeit nur einen einzelnen Aspekt ihrer vielseitigen Persönlichkeiten und Identitäten ausmacht?
Die Fortbildung greift Fragen von Lehrerinnen und Lehrern auf und beschäftigt sich damit, wie sie auf Positionen und Verhaltensformen, die ihnen problematisch erscheinen, reagieren können. Sie ermöglicht die Auseinandersetzung mit schulischen Konflikten und Aushandlungsprozessen in der Migrationsgesellschaft und regt durch ein abwechslungsreiches und praxisorientiertes Programm zu Austausch und Selbstreflexion an.
Mai 2023
Wie kann die historisch gewachsene koloniale Kontinuität in Museen besprochen und verändert werden? Inmitten der aktuellen Dekolonialisierungsprozesse ist eine kritische gesellschaftspolitische Reflexion über den Umgang mit unrechtmäßig erworbenen Kulturgütern unumgänglich. Was hat die Restitutionsdebatte im Kontext der Aufarbeitung kolonialer Sammlungen bisher erreicht und was muss in Zukunft noch passieren? Welche Aufgaben kommen auf Schulen zu? Diesen und weiteren Fragen geht der Webtalk mit Dagmawit Abebaw Hunz aus einer dekolonialen und afrodiasporischen Perspektive nach.
Die Fortbildung „Grundlagen des Asylverfahrens: Von der Ankunft in Deutschland bis zur Anhörung“ bietet als Basis- Qualifizierung einen Überblick über wichtige Aspekte sowie relevante Bereiche des Asylverfahrens von der Ankunft in Deutschland/Thüringen bis zur Anhörung. Sie dient als Einführung in die Asylverfahrensberatung und für die tägliche Beratungspraxis mit geflüchteten Menschen im Asylverfahren.
-
24.05.2023
Auf diesem Seminar nehmen wir die vielfach kritisierte Diskrepanz zwischen der Menschenrechtsrhetorik der EU und ihrer tatsächlichen Praxis unter die Lupe und diskutieren mit migrations- und menschenrechtspolitischen Expert:innen. Wie kann die EU ihrem Anspruch als Wertegemeinschaft und Menschenrechtsförderin gerecht werden, wenn sich angesichts bewaffneter Konflikte, den Auswirkungen des Klimawandels und verstärkter Hungerkrisen die weltweite Zahl an Flüchtenden erhöht?
-
28.05.2023
-
21.05.2023
In Zusammenarbeit mit dem Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart, dem Diakonischen Werk Württemberg und dem DGB-Bezirk Baden-Württemberg.
Im Rahmen des Verbundprojektes PrEval Zukunftswerkstätten (2022-2025) lädt das Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung , das Violence Prevention Network und das Institut i-unito herzlich zu einem digitalen offenen Forum „Evaluation und Qualitätssicherung in der kommunalen Präventionsarbeit, politischen Bildung und Demokratieförderung“ ein. Das offene Forum bietet eine Gelegenheit, sich im moderierten Gespräch mit Kolleg:innen bundesweit auszutauschen und gemeinsam aktuelle Bedarfe und mögliche neue Trends herauszuarbeiten.
Im Mittelpunkt des Offenen Forums am 16. Mai 2023 stehen kommunale Perspektiven. Wie zufrieden sind kommunale Akteure mit vorhandenen Unterstützungsangeboten und wo besteht Optimierungspotenzial?
Was sind kommunale Perspektiven auf Evaluation und Qualitätssicherung in der Extremismusprävention, politischen Bildung und Demokratieförderung? Wie zufrieden sind kommunale Akteure mit vorhandenen Unterstützungsangeboten und wo besteht Optimierungspotenzial?
Angebote der Jugendhilfe im Ausland haben in Deutschland eine lange Tradition. Immer wieder kam es in der Vergangenheit zu schwierigen Situationen, manchmal bis hin zu diplomatischen Verwerfungen. International gesehen, ist diese Hilfeform eher wenig bekannt und stößt im Ausland oft auf Skepsis. In der innerdeutschen Debatte wurde immer wieder die mangelhafte Aufsicht durch die erlaubniserteilenden Behörden beklagt.
In der Folge wurde zuletzt sowohl auf nationaler als auch auf EU-Ebene die Unterbringung von Minderjährigen im Ausland neu geregelt. Der Deutsche Verein hat im Jahr 2022 hierzu Eckpunkte herausgebracht.
Gegenstand der Veranstaltung sind die tatsächlichen und rechtlichen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Platzierung von Minderjährigen in intensivpädagogischen Maßnahmen. Die aktuellen gesetzlichen Regelungen werden vorgestellt, die Fragen der beteiligten Fachkräfte aufgegriffen, diskutiert und wenn möglich beantwortet.
-
12.05.2023
-
12.05.2023
„Gerechtigkeit Heilt –Psychosoziale Zentren für Geflüchtete als Menschenrechtsorganisationen und Versorgungsstruktur” - unter diesem Titel veranstaltet die BAfF gemeinsam mit der Medizinischen Flüchtlingshilfe Bochum (MFH) ihre diesjährige öffentliche Jahrestagung.
Ziel der Tagung ist es, die Arbeit mit Überlebenden von Folter und anderer grausamer und unmenschlicher Behandlung in den gesellschaftlichen Zusammenhängen der Herkunfts- und Ankunftskontexte sowie während der Flucht zu betrachten, in denen Gewalt stattfindet und Täter*innen häufig straflos bleiben. Hierbei liegt ein Fokus neben der sozialen, psychologischen und medizinischen Dimension auch auf der juristischen – als integraler Bestandteil einer ganzheitlichen Rehabilitation.
Die VHS bietet einen Workshop-Tag an, der genau an diesem Punkt ansetzt. Hier geht es darum, das Judentum als Religionsgemeinschaft mit einer langen Tradition in Deutschlands Geschichte und Gegenwart sichtbar zu machen. Und gleichzeitig geht es um eine Sensibilisierung dafür, wie wenig Antisemitismus mit tatsächlichen Jüdinnen*Juden zu tun hat, sondern mit zum Teil uralten Stereotypen arbeitet. Diese mitunter Jahrhunderte alten Stereotype haben sich gerade in den letzten zwei Jahren, im Zuge von Corona-Krise und verschärftem Nahost-Konflikt, zu neuen Codes geformt und bedeuten eine reale Gefahr für jüdische (und als jüdisch wahrgenommene) Menschen in Deutschland. Darum müssen wir sie erkennen und ihnen entgegentreten.
Teil der wöchentlichen Webtalk-Reihe: „Schule – Radikalisierung – Prävention: Dialog zwischen Praxis und Forschung“
Schule spielt für die Prävention von demokratie- und menschenfeindlichen Einstellungen eine wichtige Rolle. Als Lern- und Sozialisationsort bietet sie zahlreiche Ansatzpunkte, um Erfahrungen von Gleichwertigkeit, Zugehörigkeit und Teilhabe zu fördern und Jugendliche damit gegen extremistische Ansprachen zu stärken. Dies gilt gerade auch für die Prävention von islamistischen Einstellungen und Verhaltensmustern.
Dabei beschränken sich präventive Formate nicht auf den Unterricht. Ein ganzheitlicher Ansatz umfasst hier ebenso Angebote der schulischen und außerschulischen politischen Bildung, der Schulsozialarbeit und der Schulpsychologie, aber auch solche, die die Schulentwicklung und die Weiterentwicklung des Kollegiums begleiten.
Die Webtalk-Reihe beleuchtet diese Fragen aus unterschiedlichen Perspektiven: Aktuelle Ergebnisse der Islamismus- und Radikalisierungsforschung werden ebenso vorgestellt wie Ansätze aus der politischen Bildung oder konkrete Modellprojekte der Präventionsarbeit. Bei allen Veranstaltungen geht es darum, einen Raum für den Austausch zwischen Schulleitungen, Lehrkräften, Schulsozialarbeiter*innen, außerschulischen Bildungsakteuren sowie Fachwissenschaftler*innen und Präventionsexpert*innen zu schaffen, um gemeinsam erfolgversprechende Ansätze zu diskutieren.
Die Webtalk-Reihe findet im Rahmen einer Kooperation des RADIS-Forschungsverbundes, der Bundeszentrale für politische Bildung/Infodienst Radikalisierungsprävention, des Leibniz-Instituts für Bildungsmedien | Georg-Eckert-Institut (GEI) und ufuq.de statt.
April 2023
-
28.04.2023
Die türkische Community in Deutschland ist eine der größten Migrantengruppen des Landes. Schätzungen zufolge leben etwa drei Millionen Menschen türkischer Herkunft in Deutschland. Die meisten von ihnen sind in den 1960er und 1970er Jahren als Gastarbeitende nach Deutschland gekommen.
Insgesamt ist die türkische Community in Deutschland eine wichtige und vielfältige Gruppe, die einen bedeutenden Beitrag zur kulturellen und wirtschaftlichen Vielfalt des Landes leistet. Viele der in Deutschland lebenden türkeistämmigen Menschen haben bereits die deutsche Staatsbürgerschaft erworben, mit dem Leben in der Türkei sind sie aber weiterhin eng verbunden. Das gilt für die in Deutschland geborenen Generationen. Politische Ereignisse, wie die Präsidentschaftswahlen am 14. Mai 2023, nehmen daher auch in Deutschland einen hohen Stellenwert ein.
Teil der wöchentlichen Webtalk-Reihe: „Schule – Radikalisierung – Prävention: Dialog zwischen Praxis und Forschung“
Schule spielt für die Prävention von demokratie- und menschenfeindlichen Einstellungen eine wichtige Rolle. Als Lern- und Sozialisationsort bietet sie zahlreiche Ansatzpunkte, um Erfahrungen von Gleichwertigkeit, Zugehörigkeit und Teilhabe zu fördern und Jugendliche damit gegen extremistische Ansprachen zu stärken. Dies gilt gerade auch für die Prävention von islamistischen Einstellungen und Verhaltensmustern.
Dabei beschränken sich präventive Formate nicht auf den Unterricht. Ein ganzheitlicher Ansatz umfasst hier ebenso Angebote der schulischen und außerschulischen politischen Bildung, der Schulsozialarbeit und der Schulpsychologie, aber auch solche, die die Schulentwicklung und die Weiterentwicklung des Kollegiums begleiten.
Die Webtalk-Reihe beleuchtet diese Fragen aus unterschiedlichen Perspektiven: Aktuelle Ergebnisse der Islamismus- und Radikalisierungsforschung werden ebenso vorgestellt wie Ansätze aus der politischen Bildung oder konkrete Modellprojekte der Präventionsarbeit. Bei allen Veranstaltungen geht es darum, einen Raum für den Austausch zwischen Schulleitungen, Lehrkräften, Schulsozialarbeiter*innen, außerschulischen Bildungsakteuren sowie Fachwissenschaftler*innen und Präventionsexpert*innen zu schaffen, um gemeinsam erfolgversprechende Ansätze zu diskutieren.
Die Webtalk-Reihe findet im Rahmen einer Kooperation des RADIS-Forschungsverbundes, der Bundeszentrale für politische Bildung/Infodienst Radikalisierungsprävention, des Leibniz-Instituts für Bildungsmedien | Georg-Eckert-Institut (GEI) und ufuq.de statt.
Trotz aller im Opferschutz – insbesondere in den letzten Jahren – erreichten Verbesserungen bleibt es auch künftig wichtig, stets zu überlegen und zu prüfen, ob und gegebenenfalls in welchen Bereichen es noch Lücken bei den opferschutzrechtlichen Regelungen und bei ihrer Umsetzung in der täglichen Praxis gibt.
In Niedersachsen existiert bereits eine Vielzahl von Opferhilfeeinrichtungen und Unterstützungsangeboten, u. a. die Fachstelle Opferschutz (FOS).
In der Fachstelle Opferschutz im Landespräventionsrat Niedersachsen beim Niedersächsischen Justizministerium wird seit dem 01.01.2013 die Opferschutz-Konzeption der Niedersächsischen Landesregierung umgesetzt.
Anlässlich des 10-jährigen Bestehens der Fachstelle Opferschutz findet in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit dem Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport, dem Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung und dem Niedersächsischen Kultusministerium eine Veranstaltungsreihe rund um das Thema Opferschutz statt. Den Auftakt zu dieser Veranstaltungsreihe bildet diese Fachtagung.
-
25.04.2023
Perspektiven, Haltung, voneinander lernen!
Intersektionale Bestandsaufnahme in der Arbeit von, mit und für junge(n) geflüchtete(n) Menschen
Die Unterbringung junger (unbegleiteter) Geflüchteter gestaltet sich aktuell besonders prekär, Versorgungsstrukturen sind überlastet. Die Einbindung und Qualifizierung von vielen neu eingestiegenen Fachkräften erfordert Wissens- und Erfahrungsweitergabe. Zugleich ist der vertiefende fachliche Austausch in Präsenz wieder möglich und notwendig – etwa zu Neuerungen im Familiennachzug oder Übergängen in die Volljährigkeit.
Die Stimmen und Forderungen von selbstorganisierten Strukturen junger Geflüchteter geben notwendige Impulse für Politik und Soziale Arbeit. Insbesondere der Situation von geflüchteten Mädchen und jungen Frauen gebührt besondere Aufmerksamkeit – verstärkt durch zusätzliche Bedarfe im Kontext der Einwanderung aus der Ukraine. Gender- und Rassismussensible pädagogische Arbeit bildet die Voraussetzung von gelingenden Versorgungsstrukturen.
-
25.04.2023
Welche Rolle spielen die Themen Askese, Disziplin und Kampf in Radikalisierungsprozessen junger Menschen? Welchen Reiz können sie ausmachen? Und wie kann die Prävention sie aufgreifen? Die dreitägige Tagung widmet sich in Vorträgen, Workshops und Vernetzungsformaten den Themen Jugendmilieus, Enthaltsamkeit und Kampfsport.
Der erwachsene Blick auf junge Zielgruppen, ihre Interessen und Lebenswelten ist selten vorurteilsfrei oder ungefärbt. Gespeist aus der eigenen biographischen Erfahrung oder aus Ressentiments gegenüber der "Jugend von heute" dominiert das Bild materialistisch-hedonistischer Jugendlicher die öffentliche Wahrnehmung und lässt Milieus und Individuen, die eher spirituell oder asketisch eingestellt sind, in den Hintergrund treten. Anders ist es im Rahmen der Auseinandersetzung mit anti-pluralistischen Ideologien und Radikalisierungsprozessen: Hier ist ein Bewusstsein für die Bedeutung von "Askese, Disziplin und Kampf" in der Adoleszenzphase stärker verbreitet – häufig jedoch nicht ohne persönliche Verwunderung, wie es Aladin El-Mafaalani mit Blick auf den Salafismus gut auf den Punkt bringt: "Strenge Kleiderordnung, reglementierte Sexualität und Konsumverzicht – in unserer Vorstellung muss das reines Gift für eine Jugendbewegung sein."
Vor diesem Hintergrund widmet sich die dreitägige bpb-Tagung in Vorträgen, Workshops und Vernetzungsformaten den Themen Jugendmilieus, Askese und Kampfsport. Die Veranstaltung findet in Magdeburg statt und ist kostenfrei. Mit Blick auf Inklusivität, Diversität und Nachhaltigkeit wird es ein Awareness-Team und die Möglichkeit zur Nutzung einer kostenfreien Kinderbetreuung geben. Reisekosten werden nicht übernommen.
Schwerpunktmäßig wird die Veranstaltung die Identifizierung von behinderten Menschen mit Fluchthintergrund und die Weiterleitung in das Unterstützungssystem behandeln. Darüber hinaus werden Praxisprojekte aus Bremen und Bremerhaven vorgestellt, welche die Unterstützung geflüchteter Menschen mit Beeinträchtigung zum Ziel haben.
Noch nie haben so viele Menschen in Deutschland Schutz gesucht wie im vergangenen Jahr. Unter ihnen befinden sich viele Menschen mit besonderen Unterstützungsbedarfen. Unter anderem die Identifizierung von behinderten Menschen mit Fluchthintergrund und deren anschließende Weiterleitung in das jeweilige Unterstützungssystem stellt für die Institutionen eine große Herausforderung dar.
In Bremen und Bremerhaven sind in den letzten Jahren mit dem Sprachlernangebot für Geflüchtete mit kognitiven Einschränkungen sowie beispielsweise den unterschiedlichen Angeboten der Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe behinderter Menschen (LAGS) viele sehr gute Praxisprojekte zur Unterstützung geflüchteter Menschen mit Beeinträchtigung entstanden. In diesem Jahr dazu gekommen ist ein Angebot des bin+ Netzwerkes, das Geflüchteten mit und ohne Behinderung bei der Arbeitsmarktintegration unterstützt.
Mit der Veranstaltung möchten wir die genannten Praxisansätze auf Bundesebene sowie aus Bremen und Bremerhaven vorstellen. Es wird ausreichend Gelegenheit für Fragen und Diskussion geben.. Ein weiteres Anliegen ist uns die Vernetzung der Unterstützungssysteme für behinderte sowie für geflüchtete Menschen.
In Niedersachsen gibt es eine Vielzahl von Projekten, die auf die Belebung bzw. den Erhalt nachbarschaftlicher Kontakte zielen und Orte für Begegnung und Miteinander schaffen. Diese Projekte sind an den lokalen Bedarfen ausgerichtet und zeigen partizipativ entwickelte passgenaue Lösungen.
Die Fortbildung stellt verschiedene Ansätze vor: Eine Genossenschaft revitalisiert ein ortsbildprägendes Gebäude als neuen Treffpunkt mit einer Vielzahl von Angeboten und Vereine starten einen Dorferneuerungsprozess oder gründen eine verbindliche Nachbarschaftshilfe für Mitglieder und Angeboten für die Öffentlichkeit. Gemeinschaftliche Wohnprojekte sind in sich schon funktionierende Nachbarschaften, tragen aber oft zur Aktivierung der Nachbarschaft bei.
Die Amadeu Antonio Stiftung und das Netzwerk kurdischer AkademikerInnen (KURD-AKAD) veranstalten gemeinsam eine Fachtagung, die sich am Beispiel der türkischen Rechten mit Rassismus und Ausgrenzung unter Migrant*innen auseinandersetzt.
Gruppen wie Assyrer*innen, Aramäer*innen, Armenier*innen, Kurd*innen, Alevit*innen, Ezid*innen uvm. sind neben dem „biodeutschen“ Rassismus auch unterschiedlich von den Aktivitäten der türkischen Rechten betroffen. Sie erleben innermigrantischen Alltagsrassismus, organisierte Einschüchterung und Terror. Über diese Bedrohung sprechen Angehörige dieser Communities aus Wissenschaft, Journalismus und Aktivismus. Sie sind zugleich Betroffene und Expert*innen.
Die Erfahrungen sind doppelt unsichtbar: Die weiße Mehrheitsgesellschaft ist blind dafür und auch innerhalb und zwischen den betroffenen Communities gibt es kaum Raum und Ressourcen für eine gemeinsame Auseinandersetzung mit der türkischen Rechten.
Die Beiträge der Tagung zeigen die historische Entwicklung der türkischen Rechten über Ländergrenzen hinweg. Sie machen deutlich: die Akteure sind gut vernetzt und verfügen über ein starkes Mobilisierungspotential und das nicht zuletzt aufgrund deutscher politischer Präferenzen.
Ziel der Tagung ist es, die Bedrohungen sichtbar zu machen, ein solidarisches Netzwerk aufzubauen und die Kräfte im Kampf gegen die türkische Rechte in Deutschland zu bündeln.
März 2023
-
28.03.2023
Im Workshop werden sowohl der Begriff als auch der Anspruch von Empowerment thematisiert, Hindernisse erörtert, gute Beispiele gesammelt sowie die Arbeit der Flüchtlingshilfe Sprockhövel als Good Practice-Beispiel vorgestellt.
Im Rahmen des Workshops erhalten Sie außerdem Tipps und Anregungen, wie Sie Ihre Arbeit auch in Pandemie-Zeiten aufrechterhalten können.
Schließlich können eigene Vorhaben und Projekte mit Blick auf eine stärkere Beteiligung und das Empowerment von Geflüchteten konzipiert und optimiert werden.
Dieses Seminar richtet sich an ehren- und hauptamtliche Kräfte in der Arbeit mit Neuzugewanderten.
Teil der wöchentlichen Webtalk-Reihe: „Schule – Radikalisierung – Prävention: Dialog zwischen Praxis und Forschung“
Schule spielt für die Prävention von demokratie- und menschenfeindlichen Einstellungen eine wichtige Rolle. Als Lern- und Sozialisationsort bietet sie zahlreiche Ansatzpunkte, um Erfahrungen von Gleichwertigkeit, Zugehörigkeit und Teilhabe zu fördern und Jugendliche damit gegen extremistische Ansprachen zu stärken. Dies gilt gerade auch für die Prävention von islamistischen Einstellungen und Verhaltensmustern.
Dabei beschränken sich präventive Formate nicht auf den Unterricht. Ein ganzheitlicher Ansatz umfasst hier ebenso Angebote der schulischen und außerschulischen politischen Bildung, der Schulsozialarbeit und der Schulpsychologie, aber auch solche, die die Schulentwicklung und die Weiterentwicklung des Kollegiums begleiten.
Die Webtalk-Reihe beleuchtet diese Fragen aus unterschiedlichen Perspektiven: Aktuelle Ergebnisse der Islamismus- und Radikalisierungsforschung werden ebenso vorgestellt wie Ansätze aus der politischen Bildung oder konkrete Modellprojekte der Präventionsarbeit. Bei allen Veranstaltungen geht es darum, einen Raum für den Austausch zwischen Schulleitungen, Lehrkräften, Schulsozialarbeiter*innen, außerschulischen Bildungsakteuren sowie Fachwissenschaftler*innen und Präventionsexpert*innen zu schaffen, um gemeinsam erfolgversprechende Ansätze zu diskutieren.
Die Webtalk-Reihe findet im Rahmen einer Kooperation des RADIS-Forschungsverbundes, der Bundeszentrale für politische Bildung/Infodienst Radikalisierungsprävention, des Leibniz-Instituts für Bildungsmedien | Georg-Eckert-Institut (GEI) und ufuq.de statt.
-
11.03.2023
Wie hält es die Rechte mit der Religion? Ob Neonazismus, Rechtspopulismus oder „Neue“ Rechte – die verschiedenen Strömungen machen auch Sinnangebote. Bei Neonazis ist der Slogan „Odin statt Jesus“ populär, in Rechtsrocktexten werden germanische Götter besungen. Ideologieangebote der Neuen Rechten stellen mit der Parole von der „Rettung des christlichen Abendlandes“ hingegen einen positiven Bezug zur christlichen Religion dar. Für die Kirchen ist dies eine ernst zu nehmende Herausforderung: Sie müssen sich gegen falsche Vereinnahmungen wehren, aber auch die eigene Theologie kritisch auf mögliche Anknüpfungspunkte für die Ideologie der Neuen Rechten hin befragen. Und sie müssen verstehen, dass sie für Neonazis ein verhasstes Feindbild sind. In der Auseinandersetzung mit rechten Weltbildern ist es notwendig, religiöse Traditionen zu klären und zu bearbeiten, um Strategien der Überwindung von Menschenfeindlichkeit zu entwickeln.
-
11.03.2023
"Kampffeld politische Bildung" – unter diesem Titel findet im März die dreitägige Tagung des Forums kritische politische Bildung (FkpB) statt. In verschiedenen Vorträgen und Workshops nähern sich die Teilnehmenden Fragen nach aktuellen Aufgaben, Konstellationen, Paradigmen und Konzepten politischer Bildungsarbeit. Im Fokus stehen dabei aktuelle Herausforderungen politischer Bildung im Spannungsfeld von gesellschaftlicher Verantwortung und diskursiven Kämpfen um Deutungsmacht. Auch Extremismusprävention und (De-) Radikalisierung werden bei der Veranstaltung thematisiert.
Die Tagung richtet sich an alle Interessierten der außerschulischen politischen Bildung, sowie Personen aus Verbänden, Vereinen, Jugendarbeit, Schulen, Hochschulen und weiteren Feldern, für die das Thema relevant ist.
-
08.03.2023
Herzlich möchten wir Sie zu unserer Tagung im März 2023 nach Erfurt einladen. Dort stellen wir die Frage, wie Demokratie in Jugendwelten gestärkt werden kann. Was sind erfolgreiche Handlungsstrategien gegen rechts? Welche Phänomene gilt es zu verstehen und zu analysieren? Wie muss sich Jugendsozialarbeit, politische Jugendbildung und Jugendarbeit aufstellen, um angesichts der aktuellen Herausforderungen handlungssicher agieren zu können?
Bei der Tagung werden die aktuellen Entwicklungen im Rechtsextremismus beleuchtet und in Workshops einzelne jugendrelevante Einflussbereiche rechter Akteur*innen untersucht, z.B. Naturschutz, Kampfsport, Musik und Social Media.
Bei einer Gesprächsrunde diskutieren verschiedene lokale und regionale Akteur*innen aus der Beratungs-, Bildungs- und Jugendarbeit die Herausforderungen in Thüringen.
Den internationalen Frauentag am 8.3. nehmen wir zum Anlass, die Verknüpfung von Antifeminismus und rechtem Gedankengut zu thematisieren. Der Umgang mit antifeministischen Positionen, nicht nur in Kirche, wird in einem Workshop vertieft.
Weitere Workshops beschäftigen sich mit kritischer Medienkompetenz, christlicher Antisemitismuskritik sowie mit Gegenstrategien migrantisch-gelesener junger Menschen in Ostdeutschland.
Ziele der Tagung sind der bundesweite Austausch zwischen Fachkräften aus unterschiedlichen Projekten und Arbeitsfeldern, die Vernetzung unter den Teilnehmenden und die Entwicklung von Handlungsstrategien.
Am 23. März beginnt in diesem Jahr der 30-tägige Fastenmonat. Eine Zeit, die viele Muslim*innen mit Freude erwarten. So ist der Ramadan nicht nur ein Monat der inneren Einkehr, sondern steht auch für ein Erleben von Familie, Gemeinschaft und Zugehörigkeit. Viele Kinder und Jugendliche möchten Teil der Gemeinschaft sein und fasten – auch in der Schule – und z. T. sogar gegen den Willen der Eltern. Das kann zu spezifischen Fragen und Herausforderungen im schulischen Alltag führen. Wie können beispielsweise reguläre Abläufe gewährleistet werden und gleichzeitig religiöse Bedarfe Beachtung finden? Wie können pädagogische Fachkräfte Jugendliche unterstützen, die fasten wollen? Wie kann Konflikten unter Jugendlichen begegnet oder ungesunden ‚Fastenwettbewerben‘ vorgebeugt werden? Wie können die Eltern eingebunden werden?
In diesem Webtalk besprechen die Mitarbeiter*innen der Fachstelle für Pädagogik zwischen Islam, antimuslimischem Rassismus und Islamismus in Berlin, Alioune Niang und Jenny Omar gemeinsam mit Ihnen diese Fragen und wollen darüber ins Gespräch kommen, wie es Schulen und Jugendeinrichtung gelingen kann, einen guten Umgang mit dem Fastenmonat Ramadan zu finden.
Februar 2023
-
01.03.2023
"Multiple Krisen ... multiple Radikalisierung?" Unter diesem Titel findet die 4. MOTRA-Jahreskonferenz statt. MOTRA (Monitoringsystem und Transferplattform Radikalisierung) ist ein Forschungsverbund im Kontext der zivilen Sicherheitsforschung.
Das erklärte Ziel der jährlich stattfindenden MOTRA-Konferenzen ist es, den Wissenstransfer und Erfahrungsaustausch zwischen Wissenschaft, Politik und Praxis zu befördern. Die MOTRA-K versteht sich hierbei als offenes Forum, um Beiträge aus der Radikalisierungsforschung und -prävention vorzustellen, Ideen auszutauschen und Personen sowie Institutionen miteinander zu vernetzen. Das Programm umfasst vielfältige Beiträge, die über aktuelle Entwicklungen zum prognostizierten ‚heißen Herbst‘ und ‚Wut-Winter‘ sowie den anhaltend relevanten Herausforderungen im Feld des Islamismus und Rechtsextremismus hinausgehend das thematische Gesamtspektrum des Radikalisierungsgeschehens in jüngerer Zeit ausmisst: Neben religiös motivierter Radikalisierung rücken gleichfalls die Spielarten politisch motivierter Radikalisierung in Betrachtungsfokus – und zwar sowohl in Gestalt von On- als auch Offline-Radikalisierungsprozessen sowie aus Sicht der Forschung als auch Praxis.
-
30.03.2023
Sprache ist ein mächtiges Instrument – sie kann verwirren, verletzen, empören, sie kann verstummen. Und sie kann empowern! Und diese Kraft möchten wir nutzen.
In der Workshop-Reihe „Fight for your rights, write for your fights“ wird die Spoken Word-Poetin und Künstlerin Mariam Rasheed gemeinsam mit den Teilnehmer*innen die Macht der Sprache erforschen und nutzen.
„Bei der Workshop-Reihe „Fight for your rights, write for your fights” wird Spoken-Word Poesie vorgestellt und durch verschiedene Übungen den Teilnehmer*innen nähergebracht. Dann werden durch kreatives Brainstorming und Mindmapping Themen gefunden, über die die Teilnehmer*innen in 10- bis 20-minütigen Runden kurze Gedichte schreiben werden. Am Ende werden die Teilnehmer*innen Zeit haben, über selbst gewählte Themen zu schreiben und in Feedback-Runden sowohl von der Workshop-Leiterin als auch von den anderen Teilnehmer*innen Unterstützung und konstruktive Kritik kriegen. Als Vorbereitung für die Abschlussveranstaltung wird geübt, wie man Spoken-Word Poesie vor einem Publikum vorträgt und die Konzepte von Rhythmus und Fluss kennengelernt.
Bei der Abschlussveranstaltung werden die Teilnehmer*innen die Möglichkeit haben, ihre während des Workshops geschriebenen Texte einem Publikum zu präsentieren.“
-
12.05.2023
Viele Kinder, die nach Deutschland geflohen sind, sind psychisch stark belastet. Sie leiden etwa unter Alpträumen, können sich nicht konzentrieren oder haben Kopf- und Bauchschmerzen. Auch Eltern und anderen Bezugspersonen geht es mitunter ähnlich.
In Deutschland engagieren sich viele Haupt- und Ehrenamtliche, um geflüchteten Menschen ein gutes und sicheres Ankommen zu ermöglichen. Sie sind häufig erste Kontaktpersonen und nehmen eine wichtige Rolle für die geflüchteten Kinder und Familien ein. Doch viele sind sich unsicher, wie sie mit psychisch belasteten Menschen umgehen sollen.
Um ihre Handlungskompetenzen und -sicherheit zu stärken und sie vor Überlastung zu schützen, bietet Save the Children daher zweitägige Trainings zur psychosozialen Unterstützung geflüchteter Kinder und Familien an.
In demokratischen Gesellschaften gehört der Streit um unterschiedliche Standpunkte zum Alltag. Nicht umsonst hat das Grundgesetz als unser aller Wertefundament hohe Hürden für die Einschränkung der Meinungsfreiheit vorgesehen. Demokratie lebt vom politischen Streit, der auch dann verbindet, wenn er nicht zu einem Konsens führt. Denn nur auf der Grundlage des Austausches unterschiedlicher Perspektiven können Entwicklungen angestoßen und Kompromisse gefunden werden.
Einer pluralistischen, freiheitlichen Gesellschaft sind Konflikte also immanent. Trotzdem bedarf es Grenzen und Regeln für die Auseinandersetzung und den Meinungsaustausch. Was darf gesagt werden und vor wem? Es gibt Gesetze, die den Rahmen definieren, aber häufig geht es in Debatten nicht um juristische Grenzen, sondern um das Meinungsklima, in dem ein produktiver Streit überhaupt möglich ist.
Im Themenfeld Rassismus und Antisemitismus ist das oftmals eine Gratwanderung. Aber auch diese Themen müssen besprechbar sein, um als Gesellschaft nicht in eine Dialogunfähigkeit zu geraten.
Die Veranstaltung wird auch auf dem YouTube-Kanal der Bildungsstätte Anne Frank übertragen:
-
22.02.2023
Wie gewinne ich Unterstützer:innen und Reichweite für meinen Verein, mein Projekt oder meine Idee?
Um diese Fragen dreht sich in der Arbeit von Vereinen und ehrenamtlichen Organisationen (fast) alles.
Nicht zuletzt die Corona-Krise stellt viele Engagierte und Non-Profits in der Mittelbeschaffung, Aufrechterhaltung und Erreichung ihrer Zielgruppen und Projektumsetzung vor besondere Herausforderungen.
Inhaltliche Kernpunkte der Veranstaltung sind die Bereiche Mittelbeschaffung, Projektmanagement und Öffentlichkeitsarbeit.
Um Kriege in einen Friedensprozess zu überführen ist eine zivile Konfliktbearbeitung eine zentrale Strategie. Wie dies aussehen kann, stellt die Referentin Verena Sauer, Politikwissenschaftlerin mit mehrjähriger Erfahrung im Feld vor. Wir loten aus, wie die Chancen dafür in der Ukraine stehen und welche Akteure was dazu beitragen könnten.
Im Anschluss kommentieren zwei Kolleg/-innen aus der Erwachsenenbildung mit ihren Erfahrungen das Themenfeld. Danach gehen wir gemeinsam in den Dialog, wie diese Erfahrungen weiter in die Erwachsenenbildung getragen werden können.
Im Februar 2022 begann Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Zu Beginn der Kämpfe wurde auch von sexualisierter Gewalt durch russische Soldaten gegen die ukrainische Zivilbevölkerung berichtet. Diese Form der Gewalt ist immer Teil kriegerischer Auseinandersetzungen. Dennoch wird sie viel zu selten als das erkannt, was sie ist: eine Menschenrechtsverletzung!
Anlässlich des ersten Jahrestages des Krieges in der Ukraine greift das IPA dies im Rahmen des bevorstehenden Kamingesprächs auf. Gäste sind:
- Dr. Monika Hauser (Gründerin der Frauenrechtsorganisation Medica Mondale)
- Dr. Regina Mühlhäuser (International Research Group 'Sexual Violence in Armed Conflict', Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur)
- Moderation: Nadia Kailouli (Journalistin, Podcasterin)
Sie ordnen das Phänomen der sexualisierten Gewalt im Krieg ein, stellen Bezüge zur aktuellen Situation in der Ukraine her und sprechen über Möglichkeiten und Grenzen von Unterstützung, Prävention und Aufarbeitung.
-
05.02.2023
Das Seminar richtet sich an haupt- und ehrenamtliche Aktive der für Demokratie engagierten Zivilgesellschaft (Vereinen, NGOs, MSOs, Initiativen, Bündnisse etc.) aus Niedersachsen und Bremen. Eine Teilnahme ist nur in Kombination mit den Modulen II (13.-15.03.2023) und III (14.-16.04.2023) der gleichen Fortbildungsreihe möglich. Die Zahl der Teilnehmenden ist begrenzt. Bitte melden Sie sich bis spätestens 15.12.2022 an inkl. einer kurzen Angabe wo und wie Sie zivilgesellschaftlich aktiv sind.
Getreu dem Leitspruch besser miteinander statt übereinander reden, bringt das Modellprojekt „Haltung zeigen. Zum Dialog zwischen Polizei und Zivilgesellschaft“ eine Gruppe von Vertreter*innen beider Seiten aus der Region im Rahmen einer Fortbildung in 3 Modulen in einen Dialog. Angeregt durch Inputs von ausgesuchten Expert*innen setzen sich die Teilnehmenden multiperspektivisch u.a. mit Themen wie gegenseitige Vorurteile, Rassismus und racial profiling, Protestformen und Gewalt auseinander. Teilnehmende erhalten durch einen angeleiteten Perspektivwechsel einen direkten Einblick in die handlungsleitenden Prinzipien und Motivationen der jeweils anderen Seite. Sie erweitern ihre Handlungskompetenzen, indem sie ihr Wissen und ihr persönliches und berufliches Netzwerk ausbauen.
Ausgehend von einer rassismuskritischen Perspektive legen die Verantwortlichen explizit Wert auf die Beteiligung von direkt von Rassismus und Diskriminierung betroffenen Menschen. Eine speziell in Diskriminierungssensibilität geschulte Awareness Person wird die Fortbildungsreihe mit ihrer fachlichen Expertise durchweg begleiten und Teilnehmenden nach Bedarf ihre Unterstützung anbieten.
Januar 2023
-
14.02.2023
Erfahrungsaustausch geben.
"Egal, ob beim Engagement im Ehrenamt, bei Diskussionen im Freundes- und Familienkreis oder beim kurzen Smalltalk - überall können sich hitzige Diskussionen entwickeln. Vor allem, wenn dabei die Begriffe "Gender" oder "Migration" fallen, werden Gespräche oft intensiv, denn viele haben sich eine Meinung gebildet, können oder wollen diese aber oft nicht erklären - denn beide Themen emotionalisieren stark und sind gleichzeitig sehr komplex.
In unserem Online-Seminar werfen wir daher einen Blick auf den Begriff Gender, die Entstehung von geschlechtsspezifischen Stereotypen und setzen uns mit Macht und Strukturen auseinander. Wir sensibilisieren uns für unsere (eigenen) Rollen, Rollenbilder und Rollenerwartungen und reflektieren diese kritisch. Außerdem beleuchten wir geschlechts- und migrationsspezifischen Stereotypen näher und entwickeln schließlich Wege, gender- und migrationsspezifische Aspekte praktisch in den (beruflichen) Alltag zu integrieren.
Zielgruppe: Das Online-Seminar richtet sich an alle ehrenamtlich, bürgerschaftlich und politisch engagierte Menschen sowie an alle Interessierten, die sich näher mit dem Zusammenhang von Gender und Migration befassen möchten und die sich für eine erhöhte Sensibilisierung für gender- und migrationsspezifische Aspekte in ihrem Alltag und ihrer beruflichen Praxis einsetzen wollen."
Der aktuell starke Zuzug von Flüchtlingen hat einen großen Bedarf an Schul- und Kitaplätzen zur Folge. Inwieweit gelingt den Kommunen die kurzfristige Integration von jungen Flüchtlingen in Schulen bzw. Kitas? Mit welchen Kompensationsangeboten versucht man vor Ort Wartezeiten auf Schul- oder Kitaplätze abzumildern? Über diese und weitere Fragen möchten wir uns gerne mit Ihnen austauschen.
In vielen Städten sind die Unterkünfte für Geflüchtete aktuell voll belegt. In Deutschland sind bis September 2022 mehr Flüchtlinge angekommen als im gesamten Jahr 2015. Dies sind Geflüchtete aus der Ukraine, aber auch viele aus anderen Ländern, die über die Türkei und die Balkanroute kommen. Die Kommunen rechnen im Herbst und Winter 2022/2023 mit weiter steigenden Flüchtlingszahlen. Bund, Länder und Kommunen versuchen jetzt die notwendigen Rahmenbedingungen zu klären. Eine faire Verteilung und eine angemessene Kostenerstattung für die Kommunen sind dabei wichtige Punkte.
Auch Fragen des Umgangs mit unbegleiteten Minderjährigen und einer „selektiven“ Willkommenskultur stellen sich neu. Welche Erfahrungen machen Kommunen, welche Maßnahmen ergreifen sie, um Lösungen zu finden und Aufnahme und Zusammenleben zu ermöglichen, zu gestalten und sozialen Zusammenhalt mit Inhalten zu füllen?
-
31.01.2023
Es entstehen keine Kosten.
Termine: 17./19./24./26. und 31.01.2023 jeweils 16:00 bis 18:00 Uhr auf der Plattform Zoom.
ich einen Schwerbehinderten-Antrag? Wo soll mein Kind zu Schule gehen? Welche Rechte habe ich? Was bedeutet dieses Formular? Diese und weitere Fragen kann uns der Verein MINA-Leben in Vielfalt e.V. aus Berlin beantworten.
Dezember 2022
Aus vielen Ländern flüchten lesbische, schwule, bisexuelle, transgeschlechtliche und intersexuelle – kurz: queere – Menschen, weil sie wegen ihrer sexuellen und geschlechtlichen Identität Gewalt und Repressionen erfahren. Oft drohen ihnen in den Herkunftsländern Gefängnis, Folter und Tod. Über die Rechte und die speziellen Schutzbedürfnisse dieser Gruppe Geflüchteter möchten wir an diesem Abend ins Gespräch kommen.
Allein in Deutschland leben etwa acht Millionen queere Menschen, deren Lebensweise von einer heteronormativen – also von heterosexuellen Normvorstellungen geprägten – Erwartungshaltung abweicht. Von einer Million geflüchteter Menschen dürften sich nach einer Schätzung des AWO Bundesverbands rund 50.000 bis 100.000 als queer verorten. Zudem sind queere Menschen, die flüchten müssen, besonders vulnerabel, denn ihre Probleme enden nicht mit der Flucht. Auch wenn sich besonders in Europa die rechtliche Situation für queere Geflüchtete verbessert hat, sind sie selbst in vermeintlich sicheren Aufnahmeländern mit Diskriminierung konfrontiert. Denn auch dort werden nicht-heteronormative Lebenskonzepte gesellschaftlich oft nicht anerkannt.
Ob unzureichender Schutz in Unterkünften, fehlende Sensibilität bei Behörden, schlechte Bedingungen der Gesundheitsversorgung oder strukturelle Diskriminierung: Weil Heterosexualität oft als gesellschaftlicher Standard vorausgesetzt wird, machen Menschen mit anderer sexueller oder geschlechtlicher Identität auch auf der Flucht immer wieder negative Erfahrungen und zeigen ihre Lebensweise nicht.
Bei der Gestaltung von diskriminierungskritischer Öffentlichkeitsarbeit geht es darum, wie Bild- und Schriftsprache so genutzt werden können, dass dadurch möglichst viele Menschen erreicht werden und sich angesprochen fühlen. Das Ziel ist es dabei, inklusive und gerechte Räume der Teilhabe zu schaffen und Angebote zu bewerben, ohne in stereotypisierende oder kulturalisierende Muster zu verfallen. Dafür ist es notwendig, einen genaueren Blick darauf zu werfen, wo Diskriminierung in Sprache und Schrift überhaupt stattfindet und was Möglichkeiten zur Veränderung sind.
In einem ersten Teil wird es daher einen offenen Input zum Thema Diskriminierung, Machtdynamiken, Sprache und Bilder geben. In zweiten Teil des Seminars bekommen die Teilnehmenden die Möglichkeit zum Austausch und zur Reflexion der eigenen Praxis.
Bei dieser zweitägigen Online-Fachtagung geht es um eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Thema der rassistischen Ungleichbehandlung von Geflüchteten sowie um eine juristische Weiterbildung.
"Am 12. Dezember schauen wir auf den größeren Kontext – EU-Abschottungspolitik, Verschärfungen im Asylrecht, die gesellschaftliche Wahrnehmung von Geflüchteten und die Kontrastfolie der Massenzustroms-Richtlinie. Am 16. Dezember liegt der Fokus auf der rechtlichen Ebene der Ungleichbehandlung von Geflüchteten in den Bereichen Arbeitsmarktzugang, Sozial- und Gesundheitsleistungen vor dem Hintergrund, dass diese in der alltäglichen Beratungsarbeit umgesetzt werden muss.
Die Veranstaltung richtet sich primär an alle, die im Kontext Migrationsarbeit, insbesondere in der Beratung sowie der Projekt- und Bildungsarbeit tätig sind. Sie ist jedoch geöffnet für die interessierte Öffentlichkeit."
TikTok liegt – nach WhatsApp und Instagram – auf Platz drei der von Zwölf- bis 19-jährigen regelmäßig genutzten Plattformen. Je jünger die Jugendlichen sind, desto häufiger verbringen sie Zeit auf der Plattform. Dabei nutzen sie die Plattform meist zur Unterhaltung. Gleichzeitig weisen neue Untersuchungen darauf hin, dass TikTok von Jugendlichen vermehrt als Suchmaschine genutzt wird. Welche Fragen stellen sie sich, wer gibt die Antworten und mit welchem Content vertreiben sie sich die Langeweile?
In diesem Webtalk wollen wir uns mit der Wirkungsweise sowie Attraktivität von TikTok auseinandersetzen und uns mit der Frage beschäftigen, ob und in welcher Weise die Plattform zu Radikalisierungen führen kann und welche Rolle kollektive Emotionen dabei spielen.
Nader Hotait forscht zu dem Thema „Potenziale der Radikalisierung auf TikTok“. In seinem Impulsvortrag wird er anhand von Beispielen die Wirkungsweise von TikTok beschreiben und auf die damit verbundenen Gefahren eingehen.
Anschließend wird Sebastian Oschwald die Bedeutung von kollektiven Emotionen in Radikalisierungsprozessen darlegen, die Erkenntnisse auf TikTok übertragen und pädagogische Ansätze in der Präventionsarbeit und der politischen Bildung zur Diskussion stellen.
LSBTI-geflüchtete Menschen zählen zu den besonders schutzbedürftigen Personen im und nach dem Asylverfahren. Vielfach erleben sie auch in Unterkünften Diskriminierung und Gewalt, die meistens auf Homo- und Transfeindlichkeit zurückzuführen ist. Aufgrund ihrer Gefährdungslage, die mit negativen Erfahrungen in der Heimat oder hier in Deutschland verbunden ist, vermeiden LSBTI-geflüchtete Menschen sicherheitshalber, ihre Geschlechtsidentität auszuleben, bevorzugen dieIsolation und leiden somit unter psychischer Belastung. Infolge der negativen Erfahrung ist es oft für die Personengruppe schwer, Vertrauen zu den Behörden, Mitarbeiten in den Unterkünften und zu Beratungsstellen zu finden.
Das Onlineseminar wird ein Grundwissen über die besondere Situation von LSBTI-geflüchteten Menschen im Asylverfahren vermitteln und für deren Bedarfe sensibilisieren.
Welche Rolle spielen Soziale Medien bei der Identitätsbildung von Jugendlichen? Mit welcher Haltung kann ich den Meinungsbildungsprozess von Jugendlichen begegnen? Wie kann ich ganz praktisch mit einem IPad und ein paar Klicks mit Jugendlichen Memes erstellen? Wie sind die rechtlichen Rahmenbedingungen bzgl. sexualisierter Selbstdarstellung im Netz und was waren nochmal "Loverboys"?
Diesen und weiteren Fragen soll im Dezember beim Fachtag Medienpädagogik am 07.12.2022 von 09:00-15:00 Uhr in der KVHS Gifhorn nachgegangen werden. Schwerpunktmäßig geht es um Meinungs- und Identitätsbildungsprozesse von Jugendlichen und Handlungsoptionen für die pädagogische Praxis und die Präventionsarbeit. Zur Vernetzung der Fachkräfte ist zudem ein Markt der Möglichkeiten eingerichtet, bei dem sich Träger aus Niedersachsen und Gifhorn vorstellen und es Zeit für Austausch und Vernetzung geben soll.
Den inhaltlichen Hauptvortrag wird Dr. Georg Materna vom JFF - Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis halten. Er spricht darüber, wie soziale Medien die politische Meinungsbildung von Kindern und Jugendlichen verändern und welche Konsequenzen daraus für (Medien-)Pädagogik und Präventionsarbeit abgeleitet werden können.
Unsere Gesellschaft hat sich in den vergangenen Jahren zunehmend polarisiert. Religiös begründete und extremistische Strömungen spielen dabei eine wichtige Rolle und sind im öffentlichen Raum und auch in Bildungseinrichtungen sichtbarer geworden. Wenn Jugendliche sich plötzlich anders verhalten oder mit demokratiefeindlichen Sprüchen auffallen, dann ist es gut, wenn pädagogische Fachkräfte darauf souverän reagieren. Gerade wenn religiöse Aspekte berührt sind, ist Fingerspitzengefühl gefragt. Wie lässt sich erkennen, ob jemand nur blufft oder tatsäch-
lich eine extremistische Haltung entwickelt hat? Warum entwickeln Jugendliche überhaupt eine Neigung zu religiösem Extremismus? Und welche Schritte sind möglich, falls sich der Verdacht erhärtet?
Das Kontaktstudium „Extremismus und Radikalisierung: Handlungskompetenz für die Bildungsarbeit mit Jugendlichen“ befähigt Sie, verschiedene Formen von Extremismus und Radikalisierung zu erkennen, Jugendliche für die Thematik zu sensibilisieren sowie in begründeten Verdachtsmomenten die Gefahrenlage abzuschätzen und gemeinsam mit geeigneten Akteuren konkrete Schritte für ein angemessenes Vorgehen einzuleiten.
Das Angebot richtet sich an alle, die mit Jugendlichen arbeiten und ist ebenso praxisorientiert wie theoretisch fundiert.
Die Weiterbildung ist in drei thematische Blöcke unterteilt, die jeweils 1,5 Online-Seminartage und durch E-Learning Kurse unterstützte Selbstlernphasen von 4-6 Wochen umfassen. Jeder dieser Blöcke kombiniert forschungsbasierten Input, Fallbeispiele, konkrete Anwendungsaufgaben für den Arbeitskontext sowie den Austausch in der Gruppe.
Geflüchtete Kinder und ihre Familien haben Anspruch auf die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe. In der Praxis ist der Zugang zum Kinder- und Jugendhilfesystem besonders für Familien in Unterkünften für geflüchtete Menschen jedoch erschwert. Neben Hürden auf Seiten der (Erst-) Aufnahmeeinrichtungen steht auch die Kinder- und Jugendhilfe vor vielfachen Herausforderungen, um ihrem Schutzauftrag nachzukommen und auf die Bedarfe der Zielgruppe einzugehen.
Gemeinsam mit Ihnen möchten wir uns im Rahmen eines digitalen Fachgesprächs zu aktuellen Problemlagen und Lösungen in der Gewährung und Inanspruchnahme von Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe für geflüchtete Kinder, Jugendliche und Eltern in Unterkünften austauschen. Die Veranstaltung richtet sich an Mitarbeitende in Unterkünften, Vertreter*innen zuständiger Behörden, Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe und zivilgesellschaftliche Organisationen.
Das Fachgespräch findet im Rahmen des Modellprojekts „Gemeinsam für mehr Teilhabe geflüchteter Kinder und Familien am Kinder- und Jugendhilfesystem. Zugänge schaffen und Kooperationen fördern!“ statt. Das Projekt ist eine Kooperation von Save the Children Deutschland e.V. und Plan International Deutschland e.V. und wird durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) gefördert.
November 2022
-
02.12.2022
Die fünf Module umfassende GFK-Ausbildung startet im November 2022 und endet im September 2023. Sie richtet sich an Interessierte aus den unterschiedlichsten Bereichen, die bereits erste Berührungspunkte mit dem Ansatz hatten. Die Ausbildung umfasst mindestens 150 Seminarstunden und schließt mit dem Zertifikat als "Anwender*in der Gewaltfreien Kommunikation" ab, welches zur selbstständigen Einführung von Gruppen in die GFK befähigt. Der Erwerb des Zertifikats ist ein Baustein der Ausbildung zur*m GFK-Trainer*in (anerkannt durch das Center for Nonviolent Communication, CNVC).
In Modul I lernen Sie das Modell der Gewaltfreien GFK mit seinen Differenzierungen zu verstehen und auf verschiedene Gesprächssituationen anzuwenden. Sie üben Gefühle und Bedürfnisse auszudrücken und Bitten so zu formulieren, dass sie eine große Chance haben, erfüllt zu werden. Gearbeitet wird anhand von Beispielen der Teilnehmenden. Weitere Elemente sind Kurzvorträge und Gesprächsübungen. Bewegungs- und Entspannungsübungen unterstützen den Lernprozess.
Eine Teilnahme an der GFK-Ausbildung ist verbunden mit einer verbindlichen Anmeldung für alle fünf Module. Eine Teilnahme an einzelnen Modulen ist nur in Ausnahmefällen auf Nachfrage möglich. Weitere Infos und die Daten der zertifizierten GFK-Ausbildung finden Sie im Flyer rechter Hand.
In diesem Workshop möchten wir gemeinsam über die Themen Diversity, Antirassismus und Integration reflektieren. Was versteht die Öffentlichkeit unter diesen Begriffen? Was verbinde ich damit? Die Erkenntnisse, die wir gemeinsam erzielen, werden wir mittels Kunst zum Ausdruck bringen. Danach folgt ein interaktiver Austausch zwischen den TeilnehmerInnen. Malkenntnisse sind nicht notwendig, nur Motivation und Neugier zum Mitwirken sind wichtig. Material wird zur Verfügung gestellt.
Der Verein frau-kunst-politik e. V. setzt sich für die Förderung von Gleichberechtigung, Kunst und Kultur sowie für die Förderung des Völkerverständigungsgedankens ein.
Referentinnen:
Marie-Jules Mimbang (Kamerun-Deutschland) Dottore Magistrale in Politikwissenschaft, Trainerin in der polit. Jugend- und Erwachsenenbildung.
Dr. Corina Toledo (Chile-Deutschland) Leiterin des fraukunst-politik e.V., Referentin in der polit. Jugend- und Erwachsenenbildung für Ökofeminismus, Antirassismus, Matriarchatsforschung.
-
25.11.2022
Was muss ich im Umgang mit radikalisierten Jugendlichen beachten? Wie lässt sich einer Radikalisierung vorbeugen? Welche Rolle spielen die sozialen Medien? Verschwörungsideologische Strömungen, rechter und religiös begründeter Extremismus – was unterscheidet sie und was haben sie gemeinsam?
Die Fortbildungsreihe für pädagogische Fachkräfte und Interessierte informiert über Formen des Extremismus und stärkt Handlungskompetenzen. Bei dieser Auftaktveranstaltung mit der Extremismus-Forscherin und Spiegel-Bestseller-Autorin Julia Ebner ("Radikaliserungsmaschinen") von der University of Oxford geht es um Radikalisierungsprozesse im Rechtsextremismus.
23.02.2023 – Prof. Matthias Quent (Rechtsextremismus-Forscher) zum Thema: Wie die extreme Rechte gesellschaftliche Spannungen nutzt und verschärft.
29.06.2023 – Hande Abay Gaspar und Manjana Sold (Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung) zum Thema: Online- und Offline-Radikalisierungen sowie Radikalisierung junger Frauen
Die Veranstaltung wird am 23. November 2022 in der Zentrale des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge in Nürnberg stattfinden. Außerdem wird es möglich sein, die Veranstaltung online über einen Livestream zu verfolgen.
Das Kooperationsnetzwerk – Sicher Zusammenleben (KoSiZu) fördert verschiedene Modellprojekte, die sich der Initiierung, Verstärkung und Förderung des Dialogs zwischen der Polizei und muslimischen Akteuren in Deutschland widmen.
Das Projekt „Aktives Begegnen“ ist beim Senator für Inneres der Freien Hansestadt Bremen angesiedelt und richtete sich speziell an Menschen mit Fluchterfahrung sowie an Studierende im Studiengang Polizeivollzugsdienst aus Bremen. Im Rahmen von niedrigschwelligen Begegnungsprojekten wurde der Austausch und das wechselseitige Kennenlernen der beiden Zielgruppen ermöglicht, wodurch der Abbau potenzieller gruppenbezogener Vorurteile gefördert werden sollte. Das Projekt wurde – beginnend mit dem Start im April 2020 – umfassend wissenschaftlich und videografisch begleitet. Die Ergebnisse des Projekts möchten wir Ihnen nunmehr im Rahmen der vorliegenden Veranstaltung präsentieren und mit Ihnen gemeinsam reflektieren.
Zielgruppe:
Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an alle Personen, die im Bereich Aus- und Fortbildung bei der Polizei tätig sind, an Mitarbeitende der Polizei, von Polizeihochschulen, Innenbehörden und anderen Ministerien, Polizeibeauftragte, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie an Personen, die im Bereich der Vermittlung interkultureller Kompetenzen aktiv sind, an zivilgesellschaftliche Akteure aus den Bereichen Integrationsförderung, Flucht und Antidiskriminierung und alle weiteren Interessierten.
Das DVV-Projekt Prävention und Gesellschaftlicher Zusammenhalt präsentiert das Online-Angebot „Forum Radikalisierungsprävention“. Unter dem „Dach“ des Forums werden Online-Kursangebote aus dem Bereich Radikalisierungsprävention für die Umsetzung im Kursgeschehen (mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen) zur Verfügung gestellt. Das Forum richtet sich an vhs-Mitarbeiter*innen, vhs-Kursleitende, Respekt Coaches und weitere Fachkräfte der Kinder- und Jugendarbeit.
Insgesamt gibt es aktuell drei Online-Kursangebote:
Als erstes ist der Kurs „Digitale Lebenswelten“ mit dem Schwerpunkt Medienkompetenzförderung veröffentlicht worden: Er umfasst ein integriertes Konferenz-Tool für das virtuelle Zusammenkommen sowie Vorlagen und die technische Ausstattung für Einzel- und Gruppenarbeiten.
Der Kurs „Fokus Radikalisierung“ ist als zweiter an den Start gegangen: In der Wissen- und Kompetenzvermittlung im Themenfeld Extremismus und Radikalisierung geht es unter Anderem darum, mit Jugendlichen Wünsche für unsere Gesellschaft zu formulieren und persönliche Ziele in der Abgrenzung zu extremistischer Ansprache zu setzen.
Der dritte Kurs „Fokus Gender“ mit dem Schwerpunkt genderreflektierter Arbeit hat die folgenden Ziele: Mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen ins Gespräch kommen zu den Themen Gender und Vielfalt – ihnen Wissen dazu vermitteln – sie in ihrem Sein bestärken – Abgrenzung zu extremistischer Ansprache fördern.
-
25.11.2022
Der respektvolle Umgang mit Minderheiten, die Entwicklung eines Zugehörigkeitsgefühls für alle und das konsequente Eintreten gegen Ausgrenzung erfordern neue Handlungskompetenzen. Hier setzt das Trainingsprogramm "Eine Welt der Vielfalt" an. Dabei bezieht sich Vielfalt nicht nur auf die "multikulturelle Gesellschaft", sondern ebenso auf Differenzen in Geschlecht, Religionszugehörigkeit und Lebensstil. Das Programm stammt ursprünglich aus den USA, wo es unter dem Titel "A World of Difference" von der Anti-Defamation-League konzipiert wurde. In der Bundesrepublik ist es inzwischen so überarbeitet worden, dass es in Bildungseinrichtungen, Einrichtungen der (Jugend-)Sozialarbeit und Berufshilfe, Verwaltungen und privatwirtschaftlichen Unternehmen Anwendung finden kann.
Diese Ausbildung wendet sich an Interessierte aus verschiedensten Einrichtungen, die mit Blick auf die Erweiterung der Handlungsmöglichkeiten in ihren Arbeitsfeldern qualifiziert werden wollen/sollen.
Die gemeinsame interdisziplinäre Ausbildung bietet Ihnen auch die Möglichkeit zur Vernetzung und wechselseitigen Unterstützung.
Nach wie vor steht die Unterbringung von Geflüchteten in den Ländern und Kommunen unter dem Zeichen eines erhöhten Belegungsdrucks. Durch das Zusammenspiel aus der Zuwanderung aus der Ukraine und den erhöhten allgemeinen Zuwanderungszahlen stoßen viele Unterkünfte an die Grenzen Ihrer Unterbringungskapazität.
Kommunen stehen unter diesen Gegebenheiten vor großen Herausforderungen bei der Versorgung und Unterbringung von Geflüchteten. Nicht aus dem Blick geraten darf dabei der Schutz vor Gewalt sowie die Schaffung und Aufrechterhaltung sicherer (kindgerechter) Orte als Daueraufgabe der für die Unterbringung zuständigen Behörden.
Einen wichtigen Beitrag zur Gewährleistung sicherer Unterbringungsbedingungen wie auch bei der Bewältigung von Herausforderungen bieten kommunale Schutzkonzepte. Diese bieten allen lokalen Akteur:innen Orientierung, indem Unterbringungsstandards festgehalten, die Rollen und das Zusammenwirken der relevanten Akteur:innen benannt und konkrete Maßnahmen zum Schutz von Geflüchteten definiert werden.
Der Fachtag „Kommunale Schutzkonzepte für die Unterbringung von Geflüchteten“ beleuchtet anhand von Beispielen aus der Praxis, wie Schutzkonzepte in der kommunalen Unterbringung strukturell verankert und effektiv umgesetzt werden können und bietet Gelegenheit zum Austausch über die Frage, wie Maßnahmen zum Gewaltschutz auch in Zeiten besonderer Herausforderungen berücksichtigt werden können.
Der Fachtag findet im Rahmen der Bundesinitiative „Schutz von geflüchteten Menschen in Flüchtlingsunterkünften“ statt und wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert.
-
18.11.2022
Im Bereich der Alltagskriminalität, insbesondere im Diebstahl- und Einbruchsbereich, ist die Aufklärungsrate relativ gering. Auch bei der Ahndung von Ordnungswidrigkeiten kommen die Kommunen kaum noch hinter her. Während der Corona-Pandemie sind Polizei und kommunale Ordnungsdienste mit der Umsetzung und Einhaltung der Hygienemaßnahmen im öffentlichen und privaten Raum sowie dem Umgang mit Corona-Protesten schließlich an ihre Belastungsgrenze gekommen.
Dadurch ist bei vielen Bürgerinnen und Bürgern der Eindruck entstanden, dass der Staat kapituliert hätte und tatenlos dem Treiben der Täter zusähe. Die Corona bedingte Aussetzung von Haftbefehlen bei Erschleichungsdelikten und die Überlastung der Justiz bei der Strafverfolgung verstärkten dieses Gefühl.
Aber weder in der Sicherheitspolitik auf Bundes-, Länder- und kommunaler Ebene noch in der europäischen und deutschen Sicherheitsforschung wird der Zusammenhang von Alltagskriminalität und Unsicherheitsgefühl diskutiert und mit adäquaten Strafverfolgungs- und Präventionsmaßnahmen bzw. Forschungsprojekten adressiert. Auch in der Präventionspraxis ist festzustellen, dass Themen wie Extremismus, Gewalt und Sucht einen deutlich höheren Stellenwert einnehmen als die Prävention von Kleinkriminalität und Ordnungswidrigkeiten.
Die Fachtagung will der Frage nachgehen, wie Polizei und Kommunen das Sicherheitsgefühl der Bürger*innen stärken und das Vertrauen der Bürger*innen zurückgewinnen können. Praktiker*innen aus Polizei und Kommunen sowie Wissenschaftler*innen diskutieren auf der zweitägigen Veranstaltung folgende Kernfragen:
- Braucht es für den Umgang mit Alltagskriminalität im öffentlichen Raum und Ordnungswidrigkeiten neue Präventions- und Sicherheitsstrategien?
- Wie können Kommunen und Polizei gemeinsam aktiv das Sicherheitsgefühl der Bürger*innen verbessern?
- Welche bürgernahen Ansätze in der Polizeiarbeit, der kommunalen Prävention und der kommunalen Sicherheit- und Ordnung sind vielversprechend?
Zusammenfassend sollen sich daraus Forderungen für einen innovativen Sicherheitsdiskurs der Politik auf Landes-, Bundes- und der europäischen Ebene ableiten lassen.
Ziel der Tagung ist, Impulse für die wirkungsvolle Umsetzung von Maßnahmen zur Prävention von Femiziden in Deutschland zu geben.
-
11.11.2022
Auf der interdisziplinären Fachtagung „Antifeminismus und Hasskriminalität“ am FGZ Standort Jena werden ideologische und strukturelle Wurzeln des Antifeminismus in den Blick genommen und in Bezug auf geschlechtsspezifische Gewalt kontextualisiert.
Antifeminismus wird als Brückenideologie verstanden, die der Gleichstellungs- und Emanzipationspolitik von Frauen und LGBTIQ+ entgegenwirkt und dabei unterschiedliche politische Milieus miteinander vereint. Die reale Bedrohung antifeministischer Bestrebungen zeigt sich in politischen und gesellschaftlichen Strukturen und Praktiken der Ausbeutung, Unterdrückung und Diskriminierung aufgrund der Zuschreibung von Geschlechtsidentität, aber auch direkt in Hassrede und Gewalttaten.
Ziel der Tagung ist, Überschneidungen und Schnittmengen von Antifeminismus und Hasskriminalität sowohl aus wissenschaftlich-theoretischen als auch aus praxisbezogenen Perspektiven zu analysieren und zu diskutieren.
Seit acht Monaten tobt der Krieg in der Ukraine, über eine Million Flüchtlinge sind mittlerweile in Deutschland registriert. Durch die Aktivierung der Massenzustrom-Richtlinie hat die EU einen besonderen Status als Kriegsvertriebene für die Menschen aus der Ukraine geschaffen. Im krassen Gegensatz zu den auf Abwehr ausgerichteten Maßnahmen, die das Europäische Grenzregime ansonsten kennzeichnet, herrscht bei den Geflüchteten aus der Ukraine innerhalb der EU große Einigkeit: Sie sollen schnell und unbürokratisch aufgenommen werden, und gerade die Nachbarstaaten der Ukraine beherbergen sehr viele Menschen.
Hierzu möchten wir einen Einblick in die Lebensrealitäten ukrainischer Geflüchteter in den osteuropäischen Staaten und die Debatten auf europäischer Ebene geben. Berichten wird Marc Speer von Bordermonitoring EU, der die Situation in den vergangenen Monaten intensiv beobachtet hat.
Mittlerweile versuchen seit der Teilmobilmachung in Russland am 21. September auch vermehrt russische Staatsangehörige Schutz in Deutschland zu beantragen, um sich dem Kriegsdienst zu entziehen. Gleichzeitig dürfen ukrainische Männer im wehrfähigen Alter das Land nicht ohne weiteres verlassen. Rudi Friedrich von Connection e.V. wird den Fokus auf die Situation der Deserteure und Kriegsdienstverweigerer richten.
In einem letzten Teil soll es um die Drittstaatsangehörigen aus der Ukraine gehen. Im Rahmen des Konflikts kamen auch einige Tausend Menschen nach Hessen, die zwar keine ukrainische Staatsangehörigkeit haben, aber bei Kriegsausbruch in der Ukraine gelebt haben und hier ebenfalls Schutz vor dem Krieg suchten. Einige sind in ihre Heimatländer weitergereist, für andere ist dies aus unterschiedlichen Gründen keine Option. Drittstaatsangehörige können zwar ebenso wie ukrainische Staatangehörige einen Schutzstatus bekommen, allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen, und in der Praxis bereiten diese Fälle oft Probleme bei den Ausländer- und Sozialbehörden. Zwar haben diese Menschen mittlerweile meist Fiktionsbescheinigungen bekommen, doch ob sie schließlich eine Aufenthaltserlaubnis bekommen, ist oftmals noch offen.
Der Krieg in der Ukraine hat seit Anfang des Jahres weitgehende Auswirkungen auf das Leben in Deutschland. In den ersten Monaten nach Kriegsbeginn wurden bereits 870.000 Geflüchtete aus der Ukraine in Deutschland registriert. Binnen kürzester Zeit mussten in Kommunen bundesweit zusätzliche Unterstützungsstrukturen geschaffen werden, um Zugänge zu Sprach- und Integrationsangeboten, Wohnraum oder Kita- und Schulplätzen zu schaffen. Große Hilfsbereitschaft und privates Engagement helfen, diese Krise zu bewältigen. Die Bereitstellung dieser Notfallstrukturen brachte dennoch kommunale Strukturen an ihre Grenzen und ging nicht selten auf Kosten bereits in Deutschland lebender geflüchteter Menschen. Gleichzeitig haben sich seit der Einstellung der Gaslieferungen aus Russland die Energiepreise vervielfacht. Die allgemeine Preisinflation führt zu steigenden Lebenshaltungskosten für alle Menschen. Die soziale Schere und marginalisierte Gruppen drohen weiter ins Abseits zu geraten, während sich Unmut in Protesten abzeichnet, die auch von rechtsextremen Gruppierungen für ihre Mobilisierung genutzt werden.
Auf dem 3. Fachtag des K3B – Kompetenzzentrum Kommunale Konfliktberatung am 09. November zu „Krieg in der Ukraine und lokale Konflikte: Auswirkungen auf Kommunales Zusammenleben in Deutschland“ möchten wir mit Wissenschaftler*innen, Praktiker*innen und kommunalen Akteur*innen darüber sprechen, wie sich der Krieg in der Ukraine auf das Zusammenleben in Städten und Gemeinden in Deutschland auswirkt. Wir möchten über die Herausforderungen der vergangenen Monate in Austausch kommen und diskutieren, wie sich Kommunen vorbereiten und präventiv arbeiten können, aber auch, welche Möglichkeiten es gibt, bereits existierende Konflikte zu bearbeiten.
In diesem kurzen Vortrag stellt der Verein „Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland“ das Moderationstool „STOP-OK!“ vor. Das Tool eignet sich sehr gut, um in Gruppen authentische Radikalisierungsfallbeispiele von Jugendlichen zu analysieren und gemeinsam präventive Handlungsoptionen zu diskutieren.
Die Veranstaltung findet im Rahmen des DPT-TV des 27. Deutschen Präventionstages statt und wird auf englisch und deutsch zu hören sein. Eine Anmeldung zum 27. DPT ist über folgenden Link möglich: https://www.praeventionstag.de/nano.cms/onlineanmeldung
Etwa 15 Prozent der Menschen, die fliehen, haben laut Schätzungen eine Behinderung. Im Asylverfahren und der Versorgung von Asylsuchenden bleiben Behinderungen und daran gebundene besondere Bedarfe jedoch oft unentdeckt. Zwar gibt es Rechtsnormen wie die UN-Behindertenrechtskonvention oder die EU-Aufnahmerichtlinie, die Situation gestaltet sich dennoch oft schwierig und Geflüchtete mit Behinderung erhalten häufig nur einen minimalen Zugang zu Leistungen. Ohne professionelle oder ehrenamtliche Beratung bleibt der Zugang zu erforderlichen Leistungen oft verwehrt. Doch für eine adäquate Beratung und Unterstützung von Geflüchteten mit Behinderung ist Wissen an der Schnittstelle von Behindertenhilfe und Geflüchtetenhilfe von Nöten.
Die Fortbildung „Sozialleistungen und medizinische Versorgung für Personen mit Behinderung im Asylverfahren“ am 08. November gibt einen Überblick für Berater:innen über gesetzliche Regelungen bezüglich des Zugangs zu Sozialleistungen für Geflüchtete Menschen mit einer Behinderung. Welche Leistungen können erhalten werden? Wie ist der rechtliche Zugang zu diesen und wie werden sie beantragt?
- Inhaltliche Schwerpunkte der Fortbildung sind der rechtliche Zugang und Anspruch auf:
- Medizinische Versorgung und Hilfsmittel
- Alltagsunterstützung und Pflegeleistungen
- Bedarfsgerechten Wohnraum
- Schwerbehindertenausweis
Konkrete Einblicke in die pädagogische Praxis der Antisemitismussensibilisierung, Empowerment für Betroffene oder die Rolle von Migrantenselbstorganisationen und muslimischer Zivilgesellschaft – die Veranstaltung bringt gezielt verschiedene Perspektiven zu dem Thema zusammen. So soll ein Austausch über Problemstellungen, Spannungsfelder und Handlungsoptionen ermöglicht werden. Ziel der Tagung ist es, eine Plattform zu schaffen, auf der das Thema Antisemitismus aus muslimischer Perspektive moderiert wird und zugleich ein gesamtgesellschaftliches Verständnis für Antisemitismus unter Einbezug pluraler Perspektiven entwickelt werden kann.
Die Veranstaltung richtet sich an ein Fachpublikum und an alle interessierten Akteur:innen und Praktiker:innen im Themenfeld – pädagogische Fachkräfte, Multiplikator:innen in der Geflüchteten-Arbeit, Bildungsträger sowie die (postmigrantische) Zivilgesellschaft.
Auslöser für Traumata bei Kindern und Jugendlichen sind divers: Gewalterfahrungen in der Familie, der Verlust einer Bezugsperson oder etwa grundlegende Veränderungen von Lebensbedingungen bei nationalen und internationalen Krisensituationen. Die Tagesschulung gibt eine Einführung in das Thema und gemeinsam erarbeiten die Teilnehmenden Antworten auf Fragen rund um das Thema Trauma. Eingeladen sind alle Interessierte sowie Berufsgruppen mit Bezug zur Thematik. Die Veranstaltung ist kostenfrei.
Die Workshops finden am 13.10.2022 in der Zeit von 16:00 Uhr – 20:00 Uhr und am 05.11.2022 in der Zeit von 09:00 Uhr – 13:00 Uhr online statt. Die beiden Workshops sind im Thema identisch.
Oktober 2022
Rassismus betrifft auch Lehrer*innen mit Migrationsgeschichte. Prof. Dr. Karim Fereidooni hat selbst in seiner Zeit als Referendar Rassismus erlebt und sich damit unter anderem in seiner Dissertation auseinandergesetzt. Er wird aus seiner Forschung zu Ungleichheitspraxen im Schulkontext berichten und Anregungen für eine diversitätssensible Lehrer*innenausbildung geben.
Zu Gast: Prof. Dr. Karim Fereidooni (Ruhr-Universität Bochum)
Die Veranstaltung ist Teil der Ufuq-Webtalk-Reihe zu rassismuskritischer Bildung in der Schule:
Die Fachstelle für Pädagogik zwischen Islam, antimuslimischem Rassismus und Islamismus in Berlin bietet im Oktober und November 2022 kostenfreie Webtalks rund um das Thema „rassismuskritische Bildung in der Schule“ an. Nach einem Gespräch mit den eingeladenen Expert*innen geht es vor allem um einen Austausch mit den Teilnehmer*innen. Zu den Webtalks sind vor allem Pädagog*innen, (angehende) Lehrkräfte und Multiplikator*innen eingeladen. Die Webtalks finden auf der Plattform Zoom statt.
- Wie können Pädagog*innen auf Verschwörungserzählungen reagieren, die im Jugendzentrum verbreitet werden?
- Was, wenn eine Klientin plötzlich von der großen Weltverschwörung berichtet, nachdem sie darüber ein fesselndes Video gesehen hat?
- Was tun, wenn die Eltern eines Schülers Unterrichtsinhalte als „von oben gelenkt“ diffamieren?
- Und was passiert da eigentlich, wenn Menschen scheinbar von jetzt auf gleich zu der Überzeugung gelangen, die Welt werde von geheimen Mächten gesteuert?
Die Erkenntnisse, die wir gemeinsam erzielen, werden wir mittels Kunst zum Ausdruck bringen. Danach folgt ein interaktiver Austausch zwischen den TeilnehmerInnen.
Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind, wie z.B. geflüchtete Menschen mit Behinderung sind in unserem System oft einer „Entweder-Oder-Sicht“ ausgesetzt. Die Zuschreibung zu einem Vielfaltsmerkmal wird komplexen menschlichen Identitäten nicht gerecht. In dieser Online-Fortbildung lernen Fachkräfte transkulturelle Erklärungsmodelle von Behinderung. Durch das Verstehen von Wechselwirkungen von Flucht, Migration und Behinderung können so bessere Zugänge in Begleitung und Beratung gefunden werden.
Ihr Profit:
- Sensibilisierung für multiple Identitäten
- Das Konzept der Intersektionalität im Kontext von Behinderung und Flucht
- Das Verständnis für Wechselwirkungen von Migration und Behinderung
- Kennenlernen transkultureller Erklärungsmodelle von Behinderung
Zielgruppe: Fachkräfte, die mit zugewanderten und geflüchteten Menschen arbeiten
Wie werden öffentliche Räume in vielfältigen, städtischen Quartieren durch unterschiedliche Bewohnergruppen wahrgenommen und genutzt? Welche Räume und Infrastrukturen wirken gemeinschaftsfördernd und an welchen Orten werden sozialräumliche Konflikte erkennbar? Was sind geeignete Strategien zur Förderung des nachbarschaftlichen Zusammenlebens und dem Abbau von Diskriminierung?
Das Forschungsprojekt StraInQ – „Strategien und Instrumente des sozialen Zusammenlebens im Quartier zur Integration besonders benachteiligter Bevölkerungsgruppen“ geht diesen Fragen am Fallbeispiel des Märkischen Viertels in Berlin und einem Wohnprojekt für ehemals obdachlose Rom:nja-Familien nach.
Im Rahmen der Fachtagung „Soziales Zusammenleben im Quartier stärken - Kultursensible Räume, Teilhabe und Antidiskriminierung“ werden die aus dem Forschungsprojekt gewonnenen Empfehlungen vorgestellt und gemeinsam mit Teilnehmer:innen aus Wissenschaft und Praxis diskutiert. Dabei liegt der Fokus zum einen auf der Frage nach den Möglichkeiten städtischer Planung zur Förderung sozialen Zusammenlebens im Quartier. Zum anderen widmet sich die Fachtagung explizit der Gruppe der Rom:nja und ihrer gesellschaftlichen Teilhabechancen.
Antimuslimischer Rassismus und Antisemitismus sind beides menschenfeindliche Ideologien. Daher wurde in den vergangenen Jahren vermehrt über die Verbindung beider Phänomene diskutiert, häufig jedoch darüber, welche Betroffenengruppe ›mehr‹ zu leiden hätte und wo die Gefahr von rechts größer sei. Obwohl die Phänomene nicht gleichzusetzen sind, sollte sich eine an demokratischen Werten orientierte Bildungsarbeit nicht spalten lassen – insbesondere in Zeiten, in denen rechte Parteien und Organisationen immer mehr Zuspruch erhalten und antisemitische und antimuslimisch-rassistische Angriffe zunehmen.
Im Rahmen des Fachvortrags geht es um die Frage, wie Bildungsarbeit gelingen kann, die antimuslimischen Rassismus und Antisemitismus verbindend thematisiert, um letztlich beiden Phänomenen entgegenzuwirken. In der Veranstaltung setzen wir uns daher
mit folgenden Fragen auseinander: Wie unterscheiden sich die Phänomene und was haben sie gemeinsam? Weshalb kann es sinnvoll sein, sie zusammenhängend zu thematisieren? Und wann ist es notwendig, sich differenziert mit den Phänomenen zu befassen?
-
05.10.2022
In den Räumlichkeiten des Hannover Congress Centrums (HCC) findet am 4. & 5. Oktober die große Kongressausstellung des 27. deutschen Präventionstages statt. In mehreren Hallen präsentieren sich die Akteure der Prävention mit ihren Angeboten. Dazu wird es Bühnenangebote und Aktionen geben. Keynote-Vorträge (Panels) sowie eine Abendveranstaltung runden das Programm ab. Im Vordergrund der Vor-Ort-Veranstaltung stehen Begegnung und Interaktion.
Im DPT-Foyer findet sich die Übersicht der angemeldeten Infostände, der Vorträge, der Workshops sowie der Posterpräsentationen. Ausserdem gibt es einen Überblick über das Open-Space- und des Bühnen-Programms.
Übersicht der Panels, welche im Rahmen des 27. Deutschen Präventionstages vor Ort in Hannover stattfinden:
Dienstag
4.10.2022
- 10:00-11:30 Uhr Panel I:
Prävention in Zeiten der Cannabislegalisierung: Worthülse, mehr vom Üblichen oder Neuorientierung? - 12:00-13:30 Uhr Panel II:
Kinder im Fokus der Prävention - 14:00-15:30 Uhr Panel III:
Cybercrime (Arbeitstitel) - 16:00-17:30 Uhr Panel IV:
Brauchen wir neue Strategien für urbane Sicherheit und kommunale Prävention?
Mittwoch
5.10.2022
- 09:00-10:30 Uhr Panel V:
Neue Ansätze zur Prävention von Hass, Hetze und Bedrohung - 11:00-12:30 Uhr Panel VI:
Was Schulen aus der Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs für Prävention heute lernen können - 13:00-14:30 Uhr Panel VII:
Jetzt erst recht! Prävention in Zeiten von Krisen und Katastrophen
Eine Übersicht des gesamten Programms gibt es zudem online als PDF:
September 2022
Kinder, die angesichts von Kriegen ihre Heimat verlassen mussten und sich auf die Suche nach Schutz begeben haben, sind besonders verletzlich. Sie brauchen Zufluchtsorte, an denen sie sicher sind und einfach wieder Kinder sein können.
Unterkünfte für geflüchtete Menschen erfüllen diese Anforderung nicht immer. Insbesondere in Situationen, in denen aufgrund eines erhöhten Zuzugs Unterbringungskapazitäten schnell aufgebaut werden, dürfen die Bedarfe von Kindern nicht aus dem Blick geraten. Ungeachtet der Unterkunftsform, des Herkunftslandes, der Verweildauer oder des elterlichen Aufenthaltsstatus sollte jedes Kind, das in einer Unterkunft lebt, zur Ruhe kommen und das Erlebte verarbeiten können.
Die eintägige UNICEF Online Schulung "Auf Kinder achten! Kinderschutz und Kinderfreundliche Orte und Angebote in Unterkünften für geflüchtete Menschen" legt den Fokus auf die Bedarfe von Kindern und zeigt Wege auf, wie diese im Unterbringungskontext berücksichtigt werden können.
Die Schulung hat zum Ziel,
- für die Schutzbedarfe von Kindern im Unterbringungskontext zu sensibilisieren,
- praxisrelevante Grundkenntnisse zum Thema Kinderschutz zu vermitteln und
- den Aufbau von Kinderfreundlichen Orten und Angeboten anzuregen.
Inhalte der Schulung sind:
- Einführung in die „Mindeststandards zum Schutz von geflüchteten Menschen in Flüchtlingsunterkünften“ mit dem Schwerpunkt auf Gewaltschutz von Kindern und Jugendlichen
- Konzept und Umsetzung der Kinderfreundlichen Orte und Angebote
- Umgang mit Verdacht auf und akuter Kindeswohlgefährdung
- Kinderschutz und Kooperation in der Umsetzung des Schutzauftrags
Weitere Termine, an denen der Workshop besucht werden kann:
- Freitag, 02.09.2022, 9:00 - 17:00 Uhr
- Freitag, 09.09.2022, 9:00 - 17:00 Uhr
- Donnerstag 15.09.2022, 9:00 - 17:00 Uhr
"Kinderrechte gelten für alle Kinder und Jugendlichen, unabhängig von ihrer Nationalität oder ihrem Aufenthaltsstatus. Dennoch fristet ihre Umsetzung im Kontext des Asyl- und Aufenthaltsrechts oftmals ein Schattendasein.
Wir möchten einen Fachaustausch zwischen Akteur*innen der Asyl – und Migrationsberatung, der Kinder- und Jugendhilfe sowie Rechtsanwält*innen über aktuelle Herausforderungen in der Praxis initiieren und uns gemeinsam über Strategien und Handlungsoptionen verständigen."
-
23.09.2022
In der aktuellen Debatte über rechtsextreme Attentäter wird der Hass auf Frauen als zentrales Motiv offensichtlich. Obwohl Misogynie sowohl bei rechtsextremen als auch bei islamistischen Radikalen augenscheinlich ist, wird bisher wenig über den Zusammenhang zwischen der Dehumanisierung von Frauen und Radikalisierung geforscht. Dieser Vortrag soll eine Übersicht über den Forschungsstand in Bezug auf Frauenverachtung als Faktor von Radikalisierung geben.
Während sich die Rekrutierungsmethoden online gleichen, sind die soziologischen Voraussetzungen der anvisierten Zielgruppen unterschiedlich. Die Rekrutierung im islamistischen Milieu verläuft überwiegend Peer-to-Peer. Internetforen und gezielte Online-Propaganda einschlägiger Organisationen verstärken dann die islamistischen Narrative. Der Verlauf der Radikalisierung kann nach neuerer Forschung (vergl. Tydecks 2021) als normenbasiertes Radikalisierungsschema dargestellt werden. Die „Incel-Bewegung“ mobilisiert dagegen zunächst meist online. Dabei ist in den von Rechtsextremisten besuchten Foren ein Wandel in der Instrumentalisierung von Rollenbildern zu beobachten.
Dieser Vortrag soll Parallelen und Unterschiede bei den Radikalisierungsverläufen besser erfassbar machen und die unterschiedlichen Funktionen von Frauenverachtung als Instrument der Radikalisierung verdeutlichen.
Die Veranstaltung findet im Rahmen des DPT-TV des 27. Deutschen Präventionstages statt und wird auf englisch und deutsch zu hören sein. Eine Anmeldung zum 27. DPT ist über folgenden Link möglich: https://www.praeventionstag.de/nano.cms/onlineanmeldung
Die Unterbringung geflüchteter Menschen stellt alle damit betrauten Akteurinnen und Akteure aus Behörden, Sozialer Arbeit und Zivilgesellschaft immer wieder vor viele gleichzeitig zu bewerkstelligende Herausforderungen. Der Fachtag "Gewaltschutz in Geflüchtetenunterkünften" bietet zum dritten Mal ein Forum für Fachkräfte aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, sich dazu auszutauschen und voneinander zu lernen. Neben einer Reflektion der aktuellen Unterbringungs-Situation im Kontext des Ukraine-Kriegs setzt der Fachtag in diesem Jahr seine Schwerpunkte auf die bedarfsorientierte Unterbringung geflüchteter Männer sowie Angebote psychosozialer Versorgung. Leitfragen sind:
- Welche präventiven Ansätze gibt es, die psychosoziale Versorgung von geflüchteten Männern zu verbessern? Welche Wege führen aus einer möglicherweise vorhandenen Delinquenzschleife?
- Was können Fachkräfte tun, um die psychosoziale Versorgungslage geflüchteter Menschen insgesamt zu verbessern?
Besonders bei der Frage nach einer bedarfsorientierten Unterbringung geflüchteter Männer signalisieren Fachkräfte immer wieder Gesprächs- und Handlungsbedarf. Geflüchtete Männer
werden bislang zu wenig von der Angebotslandschaft berücksichtigt und ihre psychosozialen Unterstützungsbedarfe, etwa auf Grund traumatisierender Erlebnisse und seelischer Verletzungen, folglich zu wenig erkannt und umgesetzt. Stattdessen weisen geflüchtete Männer durch unsichere Bleibe- und mangelnde berufliche Perspektiven sowie der fehlenden Erfahrung von Selbstwirksamkeit oft viele Risikofaktoren für delinquente Verhaltensweisen wie Suchtmittelmissbrauch, selbst- und fremdgefährdendes Verhalten oder Aggressionen gegen Dinge auf.
-
20.09.2022
Die Tagung unternimmt eine Bestandsaufnahme der derzeitigen Vorgaben zum Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit und reflektiert problematische Fragen wie etwa die Identitätsklärung oder die Einordnung in die inländischen Lebensverhältnisse. Neuere Entwicklungen in der Rechtsprechung werden ebenso aufgezeigt wie die Erwartungen an die Einbürgerungsoffensive und die Auswirkungen des Online-Zugangsgesetzes auf die Arbeit der Ausländerbehörden.
Eine Anerkennung als Fortbildungsveranstaltung i.S.v. § 15 FAO ist möglich.
Zum Auftakt dieses neuen Projektes freuen wir uns, Sie bei unserer digitalen Diskussionsveranstaltung anlässlich unserer neuen Veröffentlichung "Militanter Akzelerationismus - Urspung und Aktivitäten in Deutschland" zu begrüßen.
Nach Vorstellung des neuen Reports und einer kurzen Einführung in die Schwerpunkte des Projektes "Digital Seismograph: Monitoring Terrorism" werden wir die Inhalte des Berichts, aber auch offene Fragen und Herausforderungen im Forschungsfeld Rechtsextremismus diskutieren. Wir freuen uns daher sehr, dass wir neben Miro Dittrich für die sich anschließende Paneldiskussion Karolin Schwarz, Autorin und Expertin für digitale Ausprägungen von Rechtsextremismus und Desinformation und Irene Mihalic, ehemalige Polizeibeamtin und Grünen-Abgeordnete im Bundestag gewinnen konnten.
Moderiert wird die Diskussion von Ann-Katrin Müller, Spiegelredakteurin im Hauptstadtbüro mit schwerpunktmäßiger Recherche zu den Themen Neue Rechte und AfD."
-
15.09.2022
Krieg, Pandemie, Klimakrise und Fragen der Gerechtigkeit: In atemberaubender Geschwindigkeit haben sich die gesellschaftlichen Koordinaten verändert. Die Welt ist heute eine grundlegend andere als im Herbst 2019, als sich die Akteure des Courage-Netzwerks zum letzten bundesweiten Kongress trafen.
Vieles, was vertraut war, scheint keine Gültigkeit mehr zu haben, vermeintliche Gewissheiten sind in Bewegung geraten und müssen neu überprüft werden. Mit dem Krieg in der Ukraine stellen sich uns Fragen von Krieg und Frieden neu. Die Klimakrise stellt unsere Art des Wirtschaftens und Zusammenlebens grundlegend in Frage. Dank „Black Lives Matter“ wird auch in Deutschland anders über Rassismus und das Verhältnis von Minderheiten und Mehrheit gesprochen. Und die erzwungene Distanz seit Beginn der Pandemie hat insbesondere jugendliche Lebenswelten grundlegend verändert. Die Veränderungen führen viele an Belastungsgrenzen: in der Schule, in der Jugendarbeit und in der politischen Bildungsarbeit. Über all das soll sich auf dem Bundeskongress 2022 mit zentralen Akteuren des Courage-Netzwerks ausgetauscht werden – analog und mit viel Zeit für persönliche Begegnungen und produktive Gespräche.
-
15.09.2022
Wie steht es um Chancengleichheit in Bereichen wie Bildung, Justiz, Polizei und dem Gesundheitswesen? Welche Risiken von Diskriminierung gibt es – und was kann dagegen getan werden? Um diese und andere Fragen geht es auf einer zweitägigen Veranstaltung der Mercator-Stiftung in Essen.
Diversität und Vielfalt machen Gesellschaften in zahlreichen Hinsichten aus, ebenso zahlreich stehen ihrer Entfaltung aber auch Hemmnisse entgegen. Die Bundesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag verankert: Deutschland ist ein Einwanderungsland. Das setzt ein wichtiges Signal für Diversität. Auch die Gesellschaft nimmt Vielfalt heute mehrheitlich als Bereicherung wahr. Das allein aber verschafft noch nicht allen Menschen gleiche Chancen und Möglichkeiten zur Teilhabe. Marginalisierte Gruppen erleben weiter Benachteiligungen, zum Beispiel aufgrund ihrer kulturellen Herkunft oder ihres sozioökonomischen Hintergrunds.
Eine Gesellschaft wird nur dann gut zusammenhalten, wenn sie allen die Aussicht bietet, sich ihr zugehörig zu fühlen. Dazu muss jede Person unabhängig von Herkunft und sozioökonomischem Hintergrund gleichberechtigt an unserer Gesellschaft teilhaben können. Der Einsatz für Chancengleichheit, Teilhabe und gegen Diskriminierung geht uns alle an.
Im Impulsvortrag stellen die Referierenden die Projektkampagne „Starke Frauen - sichtbar machen“ vor, die im Rahmen des Projektes „Frauen stärken Frauen - Gegen Radikalisierung“ entstanden ist. In diesem Zusammenhang werden auch die Maßnahmen des Projektes präsentiert. Mit Hilfe der Kampagne ist es gelungen, die starken Frauen aus dem Projekt und deren Familien, die in die Maßnahmen mit einbezogen wurden, sichtbar zu machen und zu zeigen, dass sie ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft sind. Während des ersten Projektzeitraumes, zeigten die Projektbeteiligten große Bereitschaft sich für ihre Mitmenschen einzusetzen. Ihr Engagement hat Vorbilder geschaffen und diese hatten einen großen Einfluss auf die Identitätsbildung der jungen Frauen. Das Gefühl der Zugehörigkeit, das sowohl durch die Maßnahmen als auch durch die Kampagne entstanden ist, stellt eine bedeutende präventive Maßnahme dar und bietet Schutz davor, sich radikalen Gruppen oder anderen negativen Einflüssen zuzuwenden. Im Projekt „Frauen stärken Frauen gegen Radikalisierung“ (FsF) wurden junge Frauen und Mädchen muslimischen Glaubens stark gemacht, wodurch diese lernten, sich selbst zu behaupten, um damit unempfänglich für die radikale Propaganda von extremistischen Gruppen zu sein. FsF wird gefördert durch die Bundesbeauftragte für Migration, Flüchtlinge und Integration und Antirassismusbeauftragte.
Die Veranstaltung findet im Rahmen des DPT-TV des 27. Deutschen Präventionstages statt und wird auf englisch und deutsch zu hören sein. Eine Anmeldung zum 27. DPT ist über folgenden Link möglich: https://www.praeventionstag.de/nano.cms/onlineanmeldung
-
14.09.2022
Erleben wir die unruhigsten Zeiten der letzten Jahre? Noch hält die Pandemie die Welt in Atem und ein Krieg, eine humanitäre Krise jagt die nächste. Unter Druck müssen Lösungen gefunden werden – in der Bundes- und Landespolitik, in der Verwaltung, in Beratungsgesprächen. Schon blickt die (mediale) Öffentlichkeit auf die nächste Katastrophe. Einige Schauplätze geraten ganz aus der Aufmerksamkeit, wie der Krieg in Syrien seit nunmehr elf Jahren. Durch die Arbeit im Bereich Asyl und Flucht erfahren wir von den vielen Bedrohungen – durch die Geschichten der schutzsuchenden Menschen – gleichzeitig und hautnah. Fachkunde, Übersicht und Zeit für den Einzelfall sind mehr denn je gefragt.
Bei der Dialogtagung 2022 stehen drei Länder im Fokus: Afghanistan – ein Jahr nach dem Umsturz durch die Taliban mit Blick auf die Lage vor Ort und die Entscheidungspraxis beim Bundesamt, Guinea als unser diesjährigen Länderschwerpunkt und die Ukraine im Kriegszustand und mit den Folgen für das Asyl- und Aufnahmeverfahren in Deutschland.
Die Aufnahme von Schutzsuchenden aus der Ukraine ist eindrucksvoll und wirft gleichzeitig Fragen für Asylsuchende aus anderen Ländern auf. Und wie gestaltet sich die asylpolitische Ausrichtung der Bundesregierung ein Jahr nach der Wahl?
Wir wollen uns auch mit ganz grundsätzlichen Themen auseinandersetzen wie dem Recht auf Familie im Asylverfahren oder Digitalisierungsprozesse und Datenmanagement im Bereich Asyl.
"Das Werkstattgespräch „Herausforderungen und Lösungsansätze in der Arbeit mit geflüchteten Männern“ ist eine Folgeveranstaltung der Fachtagung „Sexualisierte Gewalt gegen Männer im Kontext der Arbeit mit geflüchteten Menschen. Ein Tabuthema?“, die in 2021 stattfand.
Im diesjährigen Werkstattgespräch werden wir uns auf den Aspekt der unterschiedlicheren Geschlechternormen konzentrieren. Mit welchen Herausforderungen sind Männer aus unterschiedlichen Herkunftsregionen/Sozialisationskontexten konfrontiert, wenn sie sich an die neuen Geschlechternormen und -erwartungen in Deutschland anpassen sollen? Zudem nehmen wir die Strategien der Anpassung und des Widerstands (z.B., wenn sie sich zur Anpassung gezwungen fühlen) dieser Männer in den Blick.
Wir möchten eine Diskussion darüber eröffnen, wie diese Veränderungen das Leben von männlichen Geflüchteten in Unterkünften für Geflüchtete beeinflussen. Welche Selbstdefinitionen entwickeln geflüchtete Männer? Wir versuchen zusammen zu verstehen, wie diese Männer wahrnehmen, wie sie von anderen wahrgenommen werden und wie sie wahrgenommen werden wollen. Was passiert mit Männern und ihren Familien, wenn „klassische“ Möglichkeiten des Mannseins wegfallen?"
-
11.09.2022
Mobbing und Hass im Netz sind seit vielen Jahren eine permanente Herausforderung für die Präventionsarbeit mit Kindern und Jugendlichen. Mobbing geschieht heute in den meisten Fällen nicht mehr nur im direkten persönlichen Kontakt in der Klasse, im Schulhof, auf dem Schulweg oder dem Sportplatz, sondern parallel im Internet. Ebenso sind Kinder und Jugendliche im Netz mit menschenfeindlichen Äußerungen, Hassbotschaften und extrem en politischen Ansichten konfrontiert. Analoge und digitale Welt von Kindern und Jugendlichen überschneiden sich nahtlos. Nicht nur sie, sondern auch Erwachsene stehen im konkreten Fall vor der Frage, welche Handlungsoptionen zur Verfügung stehen und wie Hass und Mobbing wirksam entgegengetreten werden kann.
Mit der Aktions- und Trainingsplatt-form Love-Storm steht ein gut erprobtes Handwerkszeug zur Verfügung, um zu den Themen Cyber-Mobbing und Hassrede im Internet zielgerichtet präventiv zu arbeiten. Die internetgestützte Plattform stellt hierfür ein Online-Trainingstool zur Verfügung, das es ermöglicht, Formen der Gegenrede direkt am Laptop oder am Tablet zu trainieren.
Inhalt des Seminars ist es, die Grundstruktur der Plattform sowie die Anwendung und den Einsatz des Lerntools für das eigene Arbeitsfeld kennenzulernen. Die Teilnehmenden werden mit diesem Angebot in die Lage versetzt, selbst Trainings zur Entwicklung von Strategien der Gegenrede mit ihren eigenen Zielgruppen anzuleiten und durchzuführen. Sie können das Online-Tool im Anschluss an die Veranstaltung in ihrem eigenen Arbeitsfeld nutzen.
Das Seminar richtet sich an Fachkräfte, die mit Schulklassen und Jugendgruppen zum Thema Cyber-Mobbing und Hass im Netz arbeiten wollen.
Während sich in den vergangenen Jahren der Fokus der Unterstützungsarbeit verstärkt auf migrantische Frauen* gerichtet hat, wird in letzter Zeit die Frage präsenter, wie geschlechterreflektiert und zugewandt mit migrantischen Männern* gearbeitet werden kann. Wie kann dabei ein offener und nachhaltiger Dialog über Männlichkeits-Thematiken mit Männern* gestaltet werden? Der Online-Workshop bietet einen ersten Einblick in das Themenfeld der genderreflektierten Männerarbeit und legt dabei einen besonderen Fokus auf die Lebenswirklichkeiten geflüchteter Männer*.
Die Veranstaltung richtet sich an Engagierte und Interessierte im Themenfeld.
Der Onlineworkshop findet über die Plattform zoom statt – vor der Veranstaltung bekommen Sie einen Link zur Teilnahme zugeschickt. Alles was Sie brauchen ist ein internetfähiges Gerät (möglichst nicht Tablet oder Smartphone), ein Headset und eine Webcam.
Fachaustausch und Online-Workshops im Projekt „Let's go digi – Servicestelle für digitale Arbeit mit Geflüchteten“
"Zum Abschluss des Projekts werden wir nicht nur unsere Toolbar vorstellen, uns an einem Praxisbeispiel mit der Frage auseinandersetzten, wie man digitale Kompetenzen niederschwellig sowie bedarfsgereicht vermitteln kann oder diskutieren, was die Flüchtlingsarbeit im Kontext der Digitalisierung nun braucht, sondern haben auch drei spannende, parallel stattfindende Workshops vorbereitet.
Zielgruppe:
- Menschen, die mit Geflüchteten haupt- oder ehrenamtlich arbeiten
- Menschen, die selbst Fluchterfahrung haben
- Interessierte
Die Veranstaltung findet auf Deutsch statt. Eine unterstützende Sprachmittlung ist punktuell möglich.
Es handelt sich um die Abschlussveranstaltung im Projekt „Let’s go digi – Servicestelle für digitale Arbeit mit Geflüchteten“. Dieses wird in Kooperation mit der Ev. Versöhnungs-Kirchengemeinde umgesetzt und gefördert durch die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW."
Der Beitrag beleuchtet praktische (digitale) Salafismusprävention am Beispiel des Projektes "contraXclusion. Mit Digitalisierung gegen Radikalisierung" (cxc), gefördert vom MKFFI NRW. Das Projekt zielt darauf ab, ein digitales Gegengewicht zur salafistischen Szene in der deutschsprachigen Social-Media-Welt aufzubauen. Auf Instagram, TikTok und Youtube werden verschiedene Formen von Narrative entwickelt und erprobt, die das Zugehörigkeitsgefühl, Anerkennung, Akzeptanz von in Deutschland sozialisierten jungen Muslim:innen fördert . Wir versuchen Online-Radikalisierungsprozesse zu verhindern, junge Muslime im Bereich politische Bildung, Teilhabe, Vielfalt, Demokratieverständnis und Zusammenleben zu stärken und die Ambiguitätstoleranz zu fördern. Mit Podcasts, Beiträgen, Kurz-Clips werden auf Problem- und Fragestellungen aus dem Alltag von jungen Muslimen rund um das Thema Islam eingegangen - auch werden kritische Tabu-Themen behandelt. Hierbei setzt man sich mit einer Bandbreite an Themen auseinander: Von Homosexualität im Islam, islamischer Feminismus, zeitgemäße Koranauslegung über Vielfalt, Akzeptanz, Zusammenleben mit anderen Religionen und Kulturen aus islamischer Perspektive bis hin zu Klimaschutz im Islam und Gemeinsamkeiten der Religionen. Allein der Instagram-Kanal von cxc konnte bisher bis zu 4.300 Abonnent:innen gewinnen, schwerpunktmäßig muslimisch Markierte.
Die Veranstaltung findet im Rahmen des DPT-TV des 27. Deutschen Präventionstages statt und wird auf englisch und deutsch zu hören sein. Eine Anmeldung zum 27. DPT ist über folgenden Link möglich: https://www.praeventionstag.de/nano.cms/onlineanmeldung
-
06.09.2022
Rechte Radikalisierung und Rechtsextremismus wird von vielen Menschen in unserer Gesellschaft nicht nur als Gefährdung des Gemeinwesens, sondern auch als individuelle Bedrohung von Freiheit, Leib und Leben angese-hen. Wer allerdings sind die „Rechten“? Wodurch zeichnen sie sich aus und wie kann man rechten Extremismus und daraus hervorgehende Straftaten effektiv verhindern und verfolgen?
Das vom Bundesministerium des Innern und für Heimat initiierte Projekt „Connect“ befasst sich mit Möglichkeiten und der Verbesserung der Zusammenarbeit und Kooperation von Sicherheitsbehörden, insbesondere der Poli-zeien mit zivilgesellschaftlichen Organisationen in der Prävention und Strafverfolgung des Rechtsextremismus.
Im Rahmen der Tagung werden unterschiedliche Gruppen und Akteure der rechtsextremen Szene Deutschlands, Europas und weiterer G7-Staaten identifiziert sowie ein Überblick über deren jeweilige Merkmale verschafft. Dar-über hinaus werden die Handlungsmöglichkeiten staatlicher und zivilgesellschaftlicher Stellen gegen Rechtsextre-mismus erarbeitet, um so Hindernisse und Möglichkeiten in der Kooperation zwischen den verschiedenen im Prä-ventions- und Strafverfolgungsbereich Agierenden zu ermitteln. Dies soll letztlich den Grundstein für die Konzep-tualisierung neuer konkreter und konstruktiver Kooperationsansätze legen, um eine Zusammenarbeit in Zukunft fruchtbarer gestalten können.
-
02.09.2022
"Unser erklärtes Ziel der jährlich stattfindenden MOTRA-Konferenzen ist es, ein vielfältiges und lebendiges Forum zu bieten, um einen engen Wissenstransfer und Erfahrungsaustausch zwischen Wissenschaft, Politik und Praxis zu befördern. Die MOTRA-K versteht sich hierbei als offenes Forum, um Beiträge aus der Radikalisierungsforschung und -prävention vorzustellen, Ideen auszutauschen und Personen sowie Institutionen miteinander zu vernetzen und damit zu einem vitalen Wissenstransfer und Erfahrungsaustausch beizutragen.
Wir freuen uns, unter den derzeit geltenden Corona-Bedingungen bis zu 150 Teilnehmer.innen vor Ort begrüßen zu dürfen.* Über verschiedene Panels können Sie, verteilt über zwei Tage, an unterschiedlichen Vorträgen, Diskussionen und Podiumsdiskussionen teilnehmen. Zudem erhalten Sie die Möglichkeit, die Vorträge im Hauptsaal per Live-Stream zu verfolgen. Der Link zum Stream wird unmittelbar vor der Konferenz versendet und auf der MOTRA-Website zur Verfügung gestellt."
August 2022
-
30.08.2022
Oft sind auch die engen Bezugspersonen in der Familie selbst betroffen und haben mit dem Erlebten zu kämpfen. Aufgrund dessen kommen den hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeitenden mit geflüchteten Menschen eine wichtige Rolle bei der Unterstützung von geflüchteten Kindern und deren Familien zu.
Die Kontaktstelle für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland des Projekts „Dezentrale Beratungs- und Unterstützungsstruktur in Flüchtlingsunterkünften (DeBUG)“ in Kooperation mit Save the Children Deutschland e.V. bieten für den Themenkomplex „Psychosoziale Unterstützung von geflüchteten Kindern und Familien“ ein zweitägiges, vertiefendes Training an.
Das Training hat das Ziel, die Kompetenzen der Mitarbeitenden in der Arbeit mit geflüchteten Menschen zu stärken, ihnen konkrete Handlungsempfehlungen und Hilfestellungen zu geben und ihre Selbstfürsorgefähigkeiten zu stärken. Das kostenfreie Training greift u.a. Grundlagen der traumasensbilen Arbeit, den Umgang mit schwierigen Situationen und die Handlungsprinzipien und Kommunikationsstrategien in der Psychosozialen Erste Hilfe für Kinder auf.
Das Training richtet sich an Mitarbeitende in der stationären Arbeit mit geflüchteten Menschen aus allen anderen Wohlfahrtsverbänden, Trägern oder Behörden in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland.
In diesem Workshop möchten wir nach einem Rückblick in die Geschichte den gegenwärtigen Antiziganismus anhand konkreter Beispielen reflektieren. Ein weiterer Schwerpunkt des Workshops liegt auf der Auseinandersetzung mit Stereotypen und abwertenden Äußerungen. Dabei soll auch die Frage von Mehrfachdiskriminierungen bzw. intersektionaler Diskriminierung eine Rolle spielen. Unter Berücksichtigung der eigenen beruflichen Praxis der Teilnehmenden entwickeln wir so gemeinsam erste Schritte in Richtung eines antiziganismussensiblen Handelns.
"Das Landes Demokratiezentrum und der Landespräventionsrat im Niedersächsischen Justizministerium möchten Sie herzlich zum Symposium „Die rechtsextreme Szene im Kontext des Ukraine Krieges“ einladen.
Das Kriegsgeschehen in der Ukraine hat tiefgreifende Auswirkungen für unsere Sicherheit, Wirtschaft und Gesellschaft. Für die Radikalisierungsprävention drängt sich die zentrale Frage auf, wie durch den Krieg extremistische und populistische Kräfte beeinflusst werden, sich möglicherweise neue Radikalisierungspotenziale herausbilden. Auf dem Symposium am 22. August 2022 richten wir den Blick auf die rechtsextreme Szene, ihren Erscheinungsformen und Entwicklungen im Kontext des Ukrainekrieges. Dazu wollen wir uns gemeinsam mit Fachleuten aus unterschiedlichen Perspektiven intensiv und angeregt austauschen.
Auf dem Symposium am 22. August 2022 richten wir den Blick auf die rechtsextreme Szene, ihren Erscheinungsformen und Entwicklungen im Kontext des Ukraine Krieges.
Dazu wollen wir uns gemeinsam mit Fachleuten aus unterschiedlichen Perspektiven intensiv und angeregt austauschen."
-
03.08.2022
Hierbei wird sich dem Thema aus unterschiedlichen Perspektiven angenähert und Wissenstransfer ermöglicht. Am ersten Tag behandeln Fachinputs unterschiedliche Aspekte der Thematik. Am zweiten Tag werden Teilaspekte des Phänomens in Workshops vertiefend bearbeitet.
Die kostenfreie Fachveranstaltung richtet sich am ersten Veranstaltungstag an alle Personen, die mit geflüchteten Menschen direkt oder indirekt zusammenarbeiten sowie an die interessierte Öffentlichkeit. Zielgruppe der Workshops des zweiten Veranstaltungstags sind Mitarbeitende der Flüchtlingssozialarbeit, die mit geflüchteten Menschen arbeiten.
-
15.11.2022
Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine hat viele Menschen gezwungen, aus der Ukraine zu flüchten. Mehrere Millionen Menschen haben das Land verlassen, hunderttausende Einreisen von Geflüchteten aus der Ukraine nach Deutschland wurden mittlerweile dokumentiert.
In ihrer gemeinsamen Verantwortung gegenüber schutzsuchenden Menschen haben Landes- und kommunale Behörden, wohlfahrtsverbandliche Betreiberorganisationen und zivilgesellschaftliche Organisationen in Zeiten des erhöhten Zuzugs schnell pragmatische Lösungen gefunden, um allen Schutzsuchenden zunächst ‚ein Dach über dem Kopf‘ bieten zu können. Hierfür wurden Notunterkünfte aufgebaut sowie durch Verdichtung der Belegung Unterbringungskapazitäten in bestehenden Unterkünften erhöht.
Die Online Workshops haben zum Ziel, für die Bedarfe von besonders schutzbedürftigen Geflüchteten zu sensibilisieren und anwendungsorientiertes Wissen für den Umgang zu vermitteln.
Sie richten sich insbesondere an ehren- und hauptamtliche Praktiker:innen, die in Unterkünften für Geflüchtete tätig sind, aber auch an Leitungspersonen und Multiplikator:innen. Die Online Workshops sind kostenfrei und einzeln buchbar. Um einen Eindruck des Zusammenspiels der vielfältigen Schutzbedarfe zu bekommen und keine Lebensrealitäten aus dem Blick zu verlieren, empfiehlt es sich, an mehreren Workshops teilzunehmen.
Die Online Workshop Reihe „Geflüchtete Menschen mit besonderen Schutzbedarfen unterstützen“ wird im Rahmen der Bundesinitiative „Schutz von geflüchteten Menschen in Flüchtlingsunterkünften“ vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert.
Juli 2022
Zunehmend wird vor Rekrutierungs- und Radikalisierungsbemühungen durch Rechtsextremisten auf online Gamingplattformen gewarnt. Verschiedenste extremistische AkteurInnen sind dort aktiv, unter anderem um gezielt Jugendliche und Minderjährige anzusprechen und für ihre eigenen Ideologien zu gewinnen und für die eigenen Reihen ein stärkeres Gemeinschaftsgefühl zu schaffen. Bisher gibt es allerdings kaum Einblicke in tatsächliche (rechts-)extremistische Radikalisierungsprozesse von Minderjährigen auf Gamingplattformen. Der Vortrag präsentiert den aktuellen Forschungsstand im Hinblick auf die Nutzung von Videospielplattformen und Instrumentalisierung der sogenannten „Gamingszene“ durch extremistische und terroristische Akteure, sowie die Ergebnisse aus einem Forschungsprojekt zu diesem Thema aus Baden-Württemberg. Dafür wurden drei rechtsextreme Radikalisierungs- und Rekrutierungsprozesse bei Minderjährigen im Videospielkontext anhand von Ermittlungsverfahren explorativ beleuchtet. Hier zeigt sich, dass mehr zielgerichtete Auswertung und ganzheitliche Betrachtungen notwendig sind. Minderjährige bekommen schnell direkten Kontakt zu offen auftretenden Rechtsextremisten, was ggf. zu einem gegenseitigen Austausch und sehr schnellen Radikalisierungsprozessen führen kann.
Die Veranstaltung findet im Rahmen des DPT-TV des 27. Deutschen Präventionstages statt und wird auf englisch und deutsch zu hören sein. Eine Anmeldung zum 27. DPT ist über folgenden Link möglich: https://www.praeventionstag.de/nano.cms/onlineanmeldung
Geflüchtete und Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, die psychisch erkrankt sind, werden in unserem Gesundheitssystem zumeist nicht adäquat versorgt. Die Barrieren für eine gute Versorgung im ambulanten psychiatrischen und psychotherapeutischen Bereich ebenso wie in der stationären Versorgung sind für die Betroffenen hoch und die Schwierigkeiten für die Behandler*innen vielfältig. Besonders betroffen sind psychisch kranke Menschen, deren Gesundheitsversorgung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz geregelt wird, und Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, deren Kenntnisse der deutschen Sprache für eine Behandlung auf Deutsch nicht ausreichend sind.
Über die verschiedenen Aspekte der aktuellen gesundheitlichen Versorgung von psychisch erkrankten Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in Hessen wollen wir auf diesem Fachtag informieren, gemeinsam in Workshops diskutieren und in einer abschließenden Podiumsdiskussion über Lösungs- und Verbesserungsideen sprechen.
Dieser Fachtag ist Teil der Kampagne, die mit einem Positionspapier im vergangenen Herbst gestartet wurde . Er richtet sich an haupt- und ehrenamtlich Arbeitende im sozialen und gesundheitlichen Bereich sowie an eine interessierte Öffentlichkeit, die sich für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte einsetzt.
Die Flucht von Menschen und die Unterbringung in Einrichtungen stellt insbesondere für Frauen ein erhöhtes Risiko dar, Gewalt zu erleiden. Eine besonders häufige Form der Ausübung von Macht und Kontrolle gegenüber Frauen ist sexualisierte Gewalt in all ihren unterschiedlichen Facetten. Auch wenn Frauen und Kinder hauptsächlich von sexualisierter Gewalt betroffen sind, so kann dennoch jede:r betroffen sein, unabhängig von Alter, sexueller Orientierung oder Geschlechtsidentität. Sexualisierte Gewalt ist nach wie vor ein tabuisiertes und mit Scham- und Schuldgefühlen besetztes Thema. Betroffenen fällt es daher oftmals schwer, sich zu offenbaren und Hilfe- und Unterstützung einzufordern.
Die Kontaktstelle für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland des DeBUG-Projekts „Dezentrale Beratungs- und Unterstützungsstruktur in Flüchtlingsunterkünften (DeBUG)“ in Kooperation mit Henrike Krüsman (BIG Koordinierung) möchten für den Themakomplex sexualisierte Gewalt gegen erwachsene Personen im Kontext Flucht und Unterbringung sensibilisieren und lädt zum oben genannten Zeitpunkt zum Onlineseminar ein.
Im Rahmen der Veranstaltung soll die Thematik der aus der Ukraine geflohenen Drittstaatsangehörigen umfassend beleuchtet werden. Das Ziel ist es dabei, mögliche Wege in ein längerfristiges Aufenthaltsrecht für Drittstaatsangehörige aufzuzeigen. Hierfür wird zum einen Prof. Dr. Dorothee Frings die rechtliche Lage der Drittstaatsangehörigen skizzieren und auf Vor- und Nachteile möglicher Aufenthaltsoptionen eingehen. Zum anderen soll die Veranstaltung aber auch den Raum für einen Austausch zur Frage bieten, wie ein passender Studien-/ Ausbildungsplatz gefunden werden kann, der den längerfristigen Aufenthalt sichert. Zum Ende der Veranstaltung hin wird es ausreichend Zeit geben, um Einzelfälle zu diskutieren.
Dorothee Frings war Professorin für Verfassungs-, Verwaltungs- und Sozialrecht an der Hochschule Niederrhein, Fachbereich Sozialwesen. Vorher war sie bereits als selbstständige Rechtsanwältin mit dem Schwerpunkt Migrationsrecht tätig. Ihre wissenschaftlichen Schwerpunkte und Publikationen liegen im Bereich des deutschen und Europäischen Sozialrechts für Migrant:innen.
In diesem Online-Workshop werden aus pädagogischer Perspektive Grundlagen zur Rechtsextremismusprävention vorgestellt und diskutiert. Der Workshop beschäftigt sich mit folgenden Fragen und Themen:
- Hinwendungsfaktoren: Welche persönlichen, familiären, genderspezifischen sowie sozialräumlichen Faktoren spielen bei der Hinwendung zu Rechtsextremismus eine Rolle?
- Verschiedene Ansatzpunkte und Methoden der Prävention: Welche Ansätze und Netzwerke der Prävention gibt es bundesweit und international für unterschiedliche Zielgruppen? Anhand des von Cultures Interactive e.V. entwickelten Gefährdungsbarometers sprechen wir über Möglichkeiten und Grenzen der pädagogischen Arbeit mit rechtsextrem gefährdeten Jugendlichen.
- Handlungsempfehlungen: Auf Grundlage international entwickelter Leitlinien für eine gute Praxis der Prävention und Distanzierungsarbeit besprechen wir, welche Voraussetzungen der Präventionsarbeit zum Beispiel in Bezug auf die personellen, zeitlichen, finanziellen und (sicherheits-)politischen Rahmenbedingungen notwendig sind. Auch die Frage, welche persönlichen und fachlichen Kompetenzen Menschen mitbringen sollten, um in diesem Arbeitsfeld tätig zu werden, können wir diskutieren.
Schon Kinder erleben früh, dass ihr Äußeres oder ihr Name mit Vorurteilen verknüpft wird und erfahren Ausgrenzung und Ablehnung. Rassismus ist tief in unserer Gesellschaft verankert und lässt sich nur bekämpfen, wenn wir dahinterliegende Strukturen und Muster erkennen und ändern. Doch was muss konkret getan werden, damit alle Menschen in unserer vielfältigen Gesellschaft sicher und frei leben können? Wie gelingt es, Partizipation und Teilhabe so zu stärken, dass alle in gleichem Maße Zugriff auf Ressourcen haben, sozial abgesichert sind, gleiche Zugangschancen zu Bildung und Arbeit haben und gleichberechtigt an Entscheidungsprozessen mitwirken? Was muss sich ändern auf dem Arbeitsmarkt, im Bildungssystem, bei staatlichen Institutionen wie der Polizei? Um diese und weitere Fragen soll es auf der Konferenz gehen.
Die Digitalisierung hat in vielen Bereichen der Gesellschaft schon längst Einzug gehalten und durch die Pandemie einen zusätzlichen Schub erhalten.
Doch wie steht es um die Digitalisierung in den Bereichen Engagement und Ehrenamt? Kann dieser gesellschaftliche Teil der Freiwilligkeit Schritt halten und wenn ja, wie? Wie kann man in zunehmend digitalisierten Zeiten Engagement neu denken? Wie hat sich durch die Pandemie Vernetzung und Engagement verändert? Welche Kanäle werden genutzt? Wie läuft das Freiwilligenmanagement?
Spielfeld Gesellschaft und die Landeszentrale für politische Bildung wollen im Rahmen des Barcamps, am 07. Juli 2022 von 10 - 16 Uhr im Ökozentrum Verden, diesen Fragen auf den Grund gehen.
Ob wir es wollen oder nicht, Machtverhältnisse spielen auch in der Bildungsarbeit eine tragende Rolle. Die Gestaltung von Lernräumen, die Anwendung von Methoden, die Aufbereitung von Wissen, die Auswahl von Arbeitsmaterialien, all das trägt nachhaltig dazu bei, wer in diesen Räumen gut lernen kann und wer sich von Methodik und Didaktik nicht angesprochen fühlt.
Häufig bekommen Personen, die von (mehrfacher) Diskriminierung betroffen sind, auch im Bildungsbereich weniger Lernchancen und werden bei der Konzeption von Bildungsformaten vergessen. Deshalb wollen wir auf dem Fachtag Wer hat Macht? gemeinsam diskriminierungskritische Perspektiven auf Bildungsarbeit erarbeiten und der Frage nachgehen, wie unsere eigene Bildungsarbeit diversitätssensibel und inklusiver gestaltet werden kann.
Der Fachtag richtet sich an Fachkräfte aus den Bereichen der Erwachsenen- und Jugendbildung, der politischen Bildungen oder der Arbeitsbereiche Migration und Gleichstellung sowie an Lehrkräfte von Schulen und Volkshochschulen. Andere Interessierte sind ebenfalls herzlich willkommen.
Public spaces in cities are highly frequented places of exchange, culture, commerce and leisure that need to be accessible, inclusive, and safe. Their density and the diversity of uses and users give rise to a number of challenges, from terrorism and crime to natural disasters and large crowd gatherings. Ensuring that public spaces retain their open and inviting character is a complex task – one that largely needs to be addressed at the local level. Local and regional authorities are ideally positioned to co-produce safe public spaces with a wide range of local stakeholders from the public and private sectors (urban planners, first responders, mobility services, local businesses etc.), but they require the right skills and tools to do so effectively. This Focus Session explores how the Secu4All project can provide these skills and tools.
Die Veranstaltung findet im Rahmen des DPT-TV des 27. Deutschen Präventionstages statt und wird auf englisch und deutsch zu hören sein. Eine Anmeldung zum 27. DPT ist über folgenden Link möglich: https://www.praeventionstag.de/nano.cms/onlineanmeldung
Die Dublin-III-Verordnung regelt, welcher Mitgliedstaat für die Durchführung eines Asylverfahrens zuständig ist. Sie spielt damit in der alltäglichen Beratungspraxis eine wichtige Rolle. Berater:innen bedürfen daher fachlicher Kenntnisse.
Die Grundlagen-Schulung „Geflüchtete im Dublin Verfahren: Was ist zu tun? Einführung in die Dublin-III-Verordnung“ “ richtet sich an Flüchtlingsberater:innen und Multiplikator:innen in der Arbeit mit Geflüchteten. Inhalte sind der Ablauf des Dublin-Verfahrens, die Zuständigkeitsprüfung, wichtige Fristen und der Umgang mit dem Dublin-Bescheid des BAMF. In einem zweiten Teil wird der Schwerpunkt auf den Grundlagen der Familienzusammenführung im Rahmen der Dublin-III-Verordnung liegen.
Inhaltliche Schwerpunkte der Fortbildung sind:
- Wie läuft ein Dublin-Verfahren ab und wie bestimmt sich die Zuständigkeit eines Mitglied-Staates?
- Welche Fristen sind zu beachten?
- Was steht im Dublin-Bescheid und was ist zu tun (Klage, Eilantrag, Rechtsbeistand) ?
- Was sind die Grundlagen der Familienzusammenführung im Rahmen der Dublin-III-Verordnung?
Juni 2022
Das Team von Queer Refugees Deutschland lädt Sie am 30.6.22 von 9 bis 15:30 Uhr zum digitalen Kompetenznetzwerktreffen zur Situation von LSBTI* Geflüchteten in Deutschland ein. Wir haben über Zoom ein Programm mit unterschiedlichen Workshops, Vorträgen und Diskussionsforen geplant. Mit der freundlichen Unterstützung unserer Kolleginnen Tatevik Dallakyan und Veronika Lechner, Gewaltschutzmultiplikator*innen von DeBUG, findet bereits am Vormittag mit einer Podiumsdiskussion einer der zentralen Punkte der Veranstaltung statt:
„Laut Asylgesetz sind Länder und Kommunen dazu angehalten, im Rahmen der Unterbringung Asylbegehrender „geeignete Maßnahmen“ zum Schutz besonders schutzbedürftiger Personengruppen umzusetzen (Vgl. AsylG §44 Absatz 2a, sowie AslyG §53 Absatz 3). Dazu werden auch LSBTI-Geflüchtete gezählt. Ein Blick in die Praxis zeigt jedoch, dass LSBTI-Geflüchtete bei weitem nicht überall ausreichend geschützt sind. Wie ist diese Situation zu verändern und welche Handlungsansätze haben sich bewährt? Es diskutieren Vertreter*innen aus Unterkünften, Beratungsstellen und von Queer Refugees Deutschland. Die Podiumsdiskussion ist eine Kooperation zwischen der DeBUG-Kontaktstelle Berlin – Brandenburg – Mecklenburg-Vorpommern sowie der Kontaktstelle Sachsen – Sachsen-Anhalt – Thüringen. Das Projekt DeBUG (Dezentrale Beratungs- und Unterstützungsstruktur für Gewaltschutz in Flüchtlingsunterkünften) wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert.
Die deutsche Gesellschaft ist von Einwanderung geprägt. Auch wenn Zuwanderung und kulturelle Vielfalt in Deutschland größtenteils gewünscht sind, spiegelt sich dies nach wie vor nicht in allen gesellschaftlichen Bereichen wider. Insbesondere Institutionen stellen sich häufig nur sehr zögerlich auf diese Veränderungen ein. Es zeigt sich immer deutlicher, dass deren Strukturen und Handlungsmuster sich der gesellschaftlichen Realität bisher ungenügend angepasst haben.
Rassismus ist in allen gesellschaftlichen Bereichen wirksam. Darüber herrscht mittlerweile weitestgehend Konsens. Das Phänomen offenbart sich aber nicht nur in persönlichen Begegnungen und Auseinandersetzungen, sondern durchsetzt auch die Institutionen unserer Gesellschaft und verschärft dadurch soziale Ungleichheiten. In Abgrenzung zum Alltagsrassismus spricht man daher auch von institutionellem Rassismus. Damit sind diskriminierende Handlungen in und von Organisationen, die von ihrem Grundsatz her unabhängig von persönlichen Einstellungen sind, gemeint. Institutioneller Rassismus erzeugt eigene Ausschlussmechanismen und zementiert auf diese Weise gesellschaftliche Ungleichheiten. Diese Mechanismen sind jedoch häufig nicht auf den ersten Blick zu erkennen.
Hier setzt der Fachtag Institutionelle Realitäten – Rassismus bei der Polizei und in der Schule an. Anhand zweier zentraler gesellschaftlicher Institutionen – der Polizei und der Schule – setzen wir uns mit rassistischer institutioneller Diskriminierung auseinander und entwickeln gemeinsam Ansatzpunkte und Forderungen für eine rassismuskritische Weiterentwicklung dieser Institutionen. Das Ziel der Fachtagung besteht darin, die Teilnehmenden für rassistische Praktiken in diesen Institutionen zu sensibilisieren und gemeinsam Forderungen an die neue Landesregierung zu entwickeln.
In der Radikalisierungs- bzw. Primärprävention kann Schule eine bedeutende Rolle spielen, da sie als Lern- und Sozialisationsort verschiedene Möglichkeiten für die politische und präventive Bildungsarbeit bietet – nicht zuletzt im Umgang mit Islamismus. Neben der Schulsozialarbeit und kollegialer Konzepte zur Förderung des Austausches und der Beziehungen zwischen Lehrkräften und/oder Schüler*innen kann auch der Schulunterricht hierfür Ansatzpunkte bieten. Doch welche Unterrichtskonzepte und Maßnahmen für Kollegium wie Schülerschaft erscheinen für welche Art von Ansprache, Austausch und Anerkennung geeignet? Was lässt sich überhaupt im Rahmen von Lehrplänen umsetzen? Wie kann und sollte eine präventive Bildungsarbeit inhaltlich gestaltet sein, ohne ihrerseits zu Stigmatisierung beizutragen oder extremistische Narrative zu verbreiten? Dazu werden drei kurze Inputs aus der aktuellen Forschung präsentiert, anhand derer die zugrundeliegenden Fragestellungen exemplarisch ausgelotet und diskutiert werden sollen. Der Workshop beleuchtet und diskutiert damit Ansätze zur Radikalisierungsprävention, die in drei laufenden Forschungsprojekten (Wechselwirkungen, UWIT sowie RIRA) der Förderlinie „Radikaler Islam“ bearbeitet werden und sich im Spannungsfeld der politischen Bildung und Prävention bewegen.
Die Veranstaltung findet im Rahmen des DPT-TV des 27. Deutschen Präventionstages statt. Eine Anmeldung zum 27. DPT ist über folgenden Link möglich: https://www.praeventionstag.de/nano.cms/onlineanmeldung
Um Allen, die mit LSBTI-Geflüchteten zu tun haben eine Hilfestellung zu geben, bieten wir kostenfreie Sonderschulungen zum Thema „Traumasensibilität“ mit der Dozentin Leonie Teigler vom BAfF via Zoom an.
Rassismus ist fest im gesellschaftlichen Alltag integriert. Er hat viele Gesichter. Das macht ihn nicht immer leicht erkennbar. Nicht alle Menschen sind gleichermaßen betroffen, aber Rassismus geht in einer strukturell rassistischen Gesellschaft alle etwas an.
Neben unterschiedlichen Formen von Rassismus existieren auch unterschiedliche Auffassungen darüber, was Rassismus ist und welche Möglichkeiten der kritischen Reflexion sowie des solidarischen Handelns vorhanden sind. Damit ein Zusammenleben in Vielfalt keine Abstrakte Utopie bleibt, müssen rassistische Wahrnehmungsmuster, Strukturen und Praktiken überwunden werden. Um Rassismus zu überwinden, muss er sichtbar gemacht werden.
In dieser Tagung soll mit einem vielfältigen Programm einige Facetten des Themas beleuchtet werden und zur vertieften Auseinandersetzung anregen.
-
21.06.2022
Das ethnografische Forschungsprojekt „Bildungsteilhabe Geflüchteter im Kontext digitalisierter Bildungsarrangements“ (BiGeDiB), gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), hat untersucht, welche Bedeutung digitale Medien für die Bildungsteilhabe geflüchteter junger Menschen haben.
Zum Abschluss des Projekts stellt das Verbundprojekt der Universität zu Köln und der Leuphana Universität Lüneburg die Ergebnisse vor und lädt zu einer Diskussion der Implikationen für Praxis, Politik und Forschung ein. Gemeinsam mit verschiedenen Akteur*innen aus Praxis, Politik, Verwaltung und Wissenschaft geht es dabei darum zu diskutieren, welche Folgen sich aus den Projektbefunden für die Gestaltung politischer Rahmenbedingungen, der Praxis vor Ort in der Kinder- und Jugendhilfe und in Schule sowie für weitere Forschung ergeben.
Dabei stehen folgende Fragen im Mittelpunkt:
- Welche Bedeutung haben digitale Medien bei der Ermöglichung von Bildungsteilhabe für junge Geflüchtete?
- Welche Bedingungen sind dafür relevant?
- Welche Konsequenzen für die Gestaltung pädagogischer Angebote und institutioneller Strukturen ergeben sich daraus für Praxis und Politik?
Die Tagung richtet sich an Interessierte aus Praxis, Politik und Wissenschaft. Die Teilnahme ist kostenfrei.
-
21.06.2022
-
17.06.2022
Die Koordinierungsstelle des Landesprogramms für Demokratie und Menschenrechte im Landespräventionsrat lädt ein zur jährlichen Fachkräftetagung! Sie findet in diesem Jahr als Präventionswoche vom 13.-17. Juni 2022 mit einem Streamingangebot und einer Arbeitsphase in Präsenz statt.
Sie können sich für halbe oder ganze Tage anmelden und Ihr Angebot selbst zusammenstellen.
Zum Auftakt wird am Montag, 13.6.2022 ein Youtube-Livestream gesendet. Lageberichte, Vorträge und Gesprächsrunden geben hier thematische Impulse und Diskussionsstoff für die Woche. In einer Arbeitsphase in Präsenz vom 14. bis 17.6.2022 werden darüber hinaus Vorträge und Workshops zu vier Themenschwerpunkten in den Räumen des Landespräventionsrats in Hannover angeboten:
- Demokratieräume in Kita und Schule (14.6.)
- Jugendliche Kompetenzen (15.6.)
- Perspektiven im Sozialraum (16.6.)
- Diversität (er)leben (17.6.)
Auf der Tagungswebseite https://kostlp.lprnds.de finden Sie ab sofort eine Übersicht über Vorträge, Gesprächsrunden, Workshops, das Online-Angebot, einige organisatorischen Hinweise und natürlich die Anmeldeformulare. Anmeldefrist ist der 25.5.2022
Menschenhandel, auch mit Kindern, spielt eine nicht zu unterschätzende Rolle im Migrations- und Asylkontext. Kinder und Jugendliche, die von Menschenhandel und sexueller Ausbeutung betroffen sind, geben sich aus verschiedenen Gründen selten von sich aus als Betroffene zu erkennen. Das Online-Seminar vermittelt grundlegendes Wissen zu Handel mit Kindern und den Betroffenen. Sie lernen, welche Anzeichen es für Handel mit und Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen gibt und wie Sie Betroffene erkennen können. Außerdem werden spezielle Phänomene des Menschenhandels und besondere Vulnerabilitäten im Migrations- und Asylkontext sowie die aufenthalts- und asylrechtliche Relevanz von Menschenhandel beleuchtet.
Montag, 19.05.2022 & Donnerstag, 09.06.2022
-
10.06.2022
Rassismus äußert sich in historischen Narrativen, in aktuellen Diskursen sowie in sozialen Normen. Im Alltag manifestiert sich Rassismus in alltäglichen Grenzverletzungen bis hin zu verschiedenen Formen von Gewalt.
Das DeZIM wurde im Jahr 2020 damit beauftragt, einen Rassismusmonitor aufzubauen. Zur Vorbereitung hat es im Jahr 2020 verschiedene Kurzstudien durchgeführt.
Eine Auswahl dieser Kurzstudien wird nun im Rahmen der ersten Fachtagung zum Nationale Diskriminierungs- und Rassismusmonitor (NaDiRa) präsentiert und diskutiert. Ergänzende Panels thematisieren neue methodische und ethische Fragestellungen aus der aktuellen Forschungspraxis.
Diese Panels widmen sich
- der Messung von Rassismus,
- institutionellem Rassismus,
- multimethodischen Perspektiven auf Rassismus in Mediendiskursen, und
- antirassistischem Widerstand und Utopien.
Antisemitismus entwickelt sich zunehmend zu einem größer werdenden gesellschaftlichen Problem - sowohl in der analogen als auch in der digitalen Welt. Alleine im Jahr 2019 ist die Anzahl der antisemitischen Straftaten um 13% zum Vorjahr gestiegen. Im digitalen Raum sind Jüd:innen und diejenigen, die sich mit Jüd:innen solidarisieren, täglich antisemitischen Anfeindungen ausgesetzt.
Im Rahmen des Hackathon suchen die Teams Ideen für eine bessere Aufklärung über Antisemitismus und erarbeiten Lösungen für eine bessere Ahndung von antisemitischen Äußerungen und Handlungen.
INSIDE OUT e.V. (IO) sensibilisiert mit dem Projekt R³ Kinder schon im frühen Alter für Themen wie Resilienzförderung, Rassismusprävention und Respekttraining und leistet damit einen Beitrag zu einer toleranten, demokratischen und reflektierten Gesellschaft, in der sich mit Respekt begegnet wird.
Die Veranstaltung findet im Rahmen des DPT-TV des 27. Deutschen Präventionstages statt. Eine Anmeldung zum 27. DPT ist über folgenden Link möglich: https://www.praeventionstag.de/nano.cms/onlineanmeldung
LSBTI-geflüchtete Menschen zählen zu den besonders schutzbedürftigen Personen im und nach dem Asylverfahren. Vielfach erleben sie auch in Unterkünften Diskriminierung und Gewalt, die meistens auf Homo- und Transfeindlichkeit zurückzuführen ist. Aufgrund ihrer Gefährdungslage, die mit negativen Erfahrungen in der Heimat oder hier in Deutschland verbunden ist, vermeiden LSBTI-geflüchtete Menschen sicherheitshalber, ihre Geschlechtsidentität auszuleben, bevorzugen dieIsolation und leiden somit unter psychischer Belastung. Infolge der negativen Erfahrung ist es oft für die Personengruppe schwer, Vertrauen zu den Behörden, Mitarbeiten in den Unterkünften und zu Beratungsstellen zu finden.
Das Onlineseminar wird ein Grundwissen über die besondere Situation von LSBTI-geflüchteten Menschen im Asylverfahren vermitteln und für deren Bedarfe sensibilisieren. Dabei wird derFokus auf folgende Schwerpunkte gelegt:
- Vermittlung von Basiswissen zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt
- Einführung in die rechtliche, politische und soziale Situation von LSBTI-geflüchteten MenscheninDeutschland und in den Herkunftsländern
- Stärkung von Handlungs- und Verweisungskompetenz im Umgang mit LSBTI-geflüchteten Menschen
Das Seminar richtet sich an Mitarbeitende in der ambulanten und stationären Arbeit mit geflüchteten Menschen sowie an zuständige Mitarbeitende in Kommunalen- und Landesbehörden in Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland. Teilnehmende aus den anderen Bundesländern und Tätigkeitsbereichen, die in ihrer Arbeit Berührungspunkte mit geflüchteten Menschen haben, sind ebenso willkommen.
Mai 2022
Du planst ein Angebot oder arbeitest in einem Projekt und benötigst dafür einen Text für Flyer, Website oder Projektbeschreibung:
Welche Benennungen und Bilder benutzt Du, welche Wirkungen können diese entwickeln?
In unserem Praxisworkshop setzen wir uns mit dem Thema Framing in der Migrationsgesellschaft auseinander. Im Fokus stehen dabei Angebote und Projekte der Sozialen Arbeit. Wir werden Textbeispiele aus der Praxis gemeinsam diskutieren und Erfahrungen austauschen. Dabei möchten wir uns mit folgenden Fragen beschäftigen:
Was ist Framing und wie beeinflusst es unsere Arbeit? Welche Bilder werden in Ausschreibungstexten vermittelt? Wo kann ich mich über Beispiele diskriminierungssensibler Sprache informieren?
Jedes vierte niedersächsische Kind im KiTa-Alter hat eine Migrationsgeschichte. Viele von ihnen sprechen in der Familie eine andere Sprache als Deutsch oder wachsen mit zwei Familiensprachen auf. Für die Kinder kann das ein großer Vorteil sein, zum Beispiel im späteren Erwerb weiterer Sprachen. Gleichzeitig stärkt es die Verantwortung der KiTas, die Sprachentwicklung aller Kinder kompetent zu begleiten. Nach gut zwei Jahren pandemiebedingter Ausnahmesituation in den KiTas fühlt sich jedoch nur rund ein Drittel der Fachkräfte dazu befähigt, dieser Verantwortung gerecht zu werden. Haben niedersächsische KiTas also ein grundlegendes, strukturelles Problem mit der Förderung von Mehrsprachigkeit? Welche Rahmenbedingungen braucht es, damit mehrsprachige Kinder ihre Stärken ausbauen können und selbstbewusst in die Schulzeit starten? Welche Qualifikationen benötigen Fachkräfte für einen gelungenen Umgang im Kita-Alltag? Welche Vorteile bietet Mehrsprachigkeit überhaupt und wie lässt sie sich in das niedersächsische System frühkindlicher Bildung integrieren?
Ausstellung & Informationsstände zu sozialen Projekten in München.
Du interessierst dich für soziale Projekte in München und willst vielleicht selbst ehrenamtlich aktiv sein? Oder hilfst du bereits Menschen, haupt- oder ehrenamtlich, und möchtest Gleichgesinnte kennenlernen? Dann komm‘ vorbei und stoß‘ mit uns an: Es gibt Getränke, Panini, verschiedene Infostände zu sozialen Projekten und ein Konzert der Münchner Band Vue Belle ab 19 Uhr.
Denkt man an Natur- und Umweltschutz, denkt man meist an demokratische und emanzipatorische Bewegungen und Initiativen. Schaut man sich die historische Entstehung des deutschen Umweltschutzes an, wird jedoch schnell deutlich, dass dieser von Beginn an auch rechtsextremen Einflüssen unterlag. Der deutsche Naturschutz war in seiner Geschichte an vielen Stellen eng mit völkischen Ideologien und Akteur*innen verknüpft. Mit dem Schutz der Natur ging und geht bis heute häufig ein Schutz der Heimat und des Volkes einher.
Der Vortrag von Pascal Specht (Pufii) zeigt zunächst die historischen Kontinuitäten und Entwicklungen sowie aktuelle Fallbeispiele der Einflussnahme der extremen Rechten auf das Themenfeld Natur- und Umweltschutz auf. Dabei wird verdeutlicht, dass es sich bei diesem Engagement rechtsextremer Personen und Organisationen nicht um ein zufälliges Handeln oder persönliche Präferenzen handelt, sondern dieses Handeln in ihrer Weltanschauung und ihrer Ideologie verankert ist. Der Natur- und Umweltschutz befindet sich in einem ständigen Spannungsfeld zwischen demokratischem Naturschutz und rechtem Heimatschutz. Der Einsatz für ein demokratisches Handeln und damit auch der Prävention rechtsextremer Einflussnahmen im Naturschutz bedarf einer aktiven Positionierung und Auseinandersetzung der demokratischen Akteur*innen.
Wie Rechtsextremismusprävention im Natur- und Umweltschutz aussehen kann, beschreibt anschließend Yannick Passeick in der Vorstellung der Fachstelle Radikalisierungsprävention und Engagement im Naturschutz – kurz FARN. FARN ist ein gemeinsames Projekt der NaturFreunde und der Naturfreundejugend Deutschlands und bietet Information, Qualifikation und Beratung im Themenfeld Naturschutz, Umweltschutz und Rechtsextremismus an. Dabei setzt die Arbeit bei der Ausbildung von Multiplikator*innen an, die bundesweit Bildungsveranstaltungen durchführen, um über die Schnittmengen und Anknüpfungspunkte von rechten Ideologien im Naturschutz zu informieren.
Referenten
Yannick Passeick (M.A. Politikwissenschaften) ist Bildungsreferent bei FARN. Hier ist er seit 2017 zuständig für die Konzeption von Bildungsmaterialien und die Durchführung von Bildungsveranstaltungen im Themenfeld Naturschutz und Rechtsextremismus. Seit 2019 arbeitet er gezielt an der Fortbildung von Multiplikator*innen aus dem Natur- und Umweltschutz, der Kinder- und Jugendhilfe, sowie der antirassistischen Bildungsarbeit.
www.nf-farn.de
Pascal Specht (B.A. Politikwissenschaften) ist Werkstudent beim Deutschen Präventionstag und betreut dort unter anderem das Informationsportal Pufii. Er hat sich im Rahmen seines Studiums mit dem Natur- und Umweltschutz von rechts auseinandergesetzt und seine Bachelorarbeit zum Thema „Natur und Umweltschutz der Neuen Rechten und ihre ideengeschichtlichen Bezugspunkte“ verfasst.
www.pufii.de
Kostenlose Anmeldung zum Webinar per Mail an team@pufii.de.
Den Zugangslink erhalten die angemeldeten Personen einen Tag vor der Veranstaltung.
17. Mai 2022, 10:00 - 11:00 Uhr
In der Zusammenarbeit mit Menschen mit Flucht- und Migrationsgeschichte entstehen häufig Situationen, in denen für Sozialarbeiter*innen auf den ersten Blick nicht klar ist, ob kulturelle Prägungen eine Rolle spielen und wie sie auf vermeintliche kulturelle Unterschiede angemessen reagieren können. Gleichzeitig existieren verschiedenste Definitionen und Konzepte davon, was „Kultur“ eigentlich ist und wie „Kultur“ in einer globalisierten Welt verstanden werden kann.
Die Fortbildung beschäftigt sich daher einerseits mit theoretischen Modellen von Kultur und kultureller Identität und will dazu anregen, diese kritisch zu reflektieren und zu hinterfragen. In diesem Zusammenhang stellt sie außerdem das Konzept der Kulturellen Intelligenz (CQ) vor und fragt nach dessen Beitrag zu einer gelingenden Kommunikation.
Ein weiterer Schwerpunkt der Veranstaltung bezieht sich auf die Gefahr der Kulturalisierung sozialer Probleme und der Depersonalisierung des Gegenübers. Ziel ist es, kompetent zwischen kultureller Prägung und anderen Differenzlinien zu unterscheiden bzw. deren Gleichzeitigkeit zu erkennen.
Zu diesen Differenzlinien gehören beispielsweise Gender, sozioökonomische Situation, religiöse Zugehörigkeit, psychische Gesundheit und Herkunft. In diesem Zusammenhang werden u. a. Beispiele aus den Bereichen Kinderschutz, witchcraft branding und Zwangsheirat herangezogen.
-
16.05.2022
Krisen erschüttern das Leben von Menschen und bergen zugleich das Potenzial, gesellschaftliche Transformationen in Gang zu setzen. Klimawandel, Pandemie und Kriege konfrontieren uns auf unterschiedliche Weise mit Schrecken und neuen Herausforderungen. COVID-19, Afghanistan, Ukraine, aber auch die langfristigen Auswirkungen der deutschen Einheit sind sehr unterschiedliche, aber auf Individuen und Gesellschaften einwirkende Krisen, die Menschen bewegen und Potenziale entfalten, wie zerstören können. Menschen fliehen – und transformieren so auch die Gesellschaften, bei denen sie Schutz suchen.
Wie gehen Gesellschaften und Individuen mit Krisen um? Wie können wir uns selbst schützen und stärken? Wie können wir uns selbst unterstützen, die wir Menschen in Krisen begleiten wollen? Diesen Fragen wollen wir gemeinsam auf der Jahrestagung der BAfF in Leipzig mit Akteur*innen aus Politik, Wissenschaft und Praxis, mit Menschenrechtsaktivist*innen und Gesundheitsexpert*innen nachgehen. Im Zentrum stehen die Wechselwirkungen zwischen Individuum und Gesellschaft, zwischen Verdrängung, Trotz und Hoffnung.
Über allem steht die Frage, wie psychisch belastete Geflüchtete durch diese Krisen begleitet werden können, in einer Umgebung, die selbst Krisen erfahren hat.
Im BMBF-Verbundprojekt „Migration und Sicherheit in der Stadt“ untersuchte die Stiftungsprofessur für Kriminalprävention und Risikomanagement Konflikte und Konfliktpotenziale im Zusammenleben von verschiedenen sozialen und ethnischen Gruppen in vier deutschen Großstädten mit jeweils zwei Quartieren. Die Ergebnisse bildeten die Grundlage für eine Broschüre mit Präventionsimpulsen, die eine kleine Auswahl aus vielen sinnvollen und mitunter evidenzbasierten Maßnahmen darstellt.
Die Veranstaltung findet im Rahmen des DPT-TV des 27. Deutschen Präventionstages statt. Eine Anmeldung zum 27. DPT ist über folgenden Link möglich: https://www.praeventionstag.de/nano.cms/onlineanmeldung
Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die im Rahmen der Verwandtenpflege untergebracht sind, haben je nach Aufenthaltstitel Anspruch auf Sozialleistungen nach dem AslyblG oder dem SGB. Häufig liegt hierbei die Vormundschaft bei ehrenamtlichen oder Amtsvormünder*innen. Wie unterscheidet sich die Verwandtenpflege von der Vollzeitpflege und welche Konsequenzen leiten sich daraus ab?
Inhalt dieser Fortbildung:
- Welche Sozialleistungen sind wo zu beantragen?
- Was ist mit dem Krankenversicherungsschutz?
- Wann gibt es Anspruch auf Kindergeld?
- Wer gehört zur Bedarfsgemeinschaft?
- Welche Leistungen sind über das Jugendamt auch in dieser Variante möglich und zu beantragen?
Gute Nachbarschaft gelingt, wenn alle gesellschaftlichen Akteur*innen des Zusammenlebens – von den Menschen vor Ort bis hin zur Politik – zusammenarbeiten und sich gemeinsam einsetzen.
In dieser Veranstaltung schauen wir direkt in Nachbarschaften vor Ort und erleben, wie aktive Nachbarschaft gelebt und was damit bewirkt werden kann:
- Wir besuchen live Beispiele von guten Nachbarschaften
- Wir erleben Möglichkeiten für die Aktivierung von Nachbarschaften
Dabei wollen wir es genau wissen: Was sind die aktuellen Probleme vor Ort? Und wie werden sie angegangen?
Gemeinsam beantworten wir, was gute Nachbarschaften brauchen, um Lösungen zu finden und wie das Bündnis dazu beitragen kann.
Die aktuelle Ukraine-Krise verdeutlicht, wie wichtig ein koordinierter Austausch zum Thema Flucht und Unterbringung ist. Der Gewaltschutz in Geflüchtetenunterkünften ist ein zentraler Aspekt der Debatte und bundesweit eine wichtige Aufgabe von Betreibern und Trägern der Einrichtungen. Trotz teils unterschiedlicher sozialer, rechtlicher und institutioneller Bedingungen bedarf die Umsetzung des Gewaltschutzes in jeder Einrichtung eines beständigen Monitorings, kombiniert mit gezielten Evaluierungen seiner Wirksamkeit. Monitoring und Evaluation des Schutzkonzepts sind Teil der von der Bundesinitiative "Schutz von geflüchteten Menschen in Flüchtlingsunterkünften" entwickelten „Mindeststandards zum Schutz von geflüchteten Menschen in Flüchtlingsunterkünften“ (Mindeststandard 6).
Das DeZIM-Institut hat, zusammen mit der Bundesinitiative sowie zwei Pilotstandorten, ein modulares System zum Monitoring der Mindeststandards entwickelt. Es baut auf bisherigen Vorarbeiten einer Indikatorenentwicklung von UNICEF auf. Das einfach zu bedienende Tool (App) dient dem kontinuierlichen Monitoring sowie der Visualisierung der Umsetzung von Gewaltschutz in Flüchtlingsunterkünften. Unterkunftsleitung, Gewaltkoordinator:innen, Sozialarbeiter:innen, Bewohner:innen und weiterer Stakeholder werden dabei beteiligt.
Seit 2021 bereitet das DeZIM-Institut eine Anpassung und Implementierung des Gewaltschutz-Monitors für acht Bundesländer vor. Es berücksichtigt hierbei die landesspezifischen Schutzkonzepte und regionalen Bedarfe. Das DeZIM-Institut begleitet den Implementierungsprozess des Tools in den teilnehmenden Bundesländern außerdem durch Schulungen und Handreichungen, um eine verantwortungsvolle Auswertung und Analyse der Daten vorzubereiten. Zudem wurde der Gewaltschutz in zwei ausgewählten Unterkünften evaluiert. Um die Nachhaltigkeit des Monitorings zu unterstützen ist angestrebt, ein bundesweites Netzwerk der Zielgruppen und Bundesländer zu etablieren.
Das Online Werkstattgespräch dient dem offenen Fachaustausch zwischen den Bundesländern und Zielgruppen sowie einer bundeslandübergreifenden Vernetzung. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie sich das entwickelte Gewaltschutzmonitoring bundesweit in Geflüchtetenunterkünften skalieren lässt, wie es an lokale Bedarfe angepasst werden und wie eine verantwortungsvolle Auswertung und Analyse der Daten vorbereitet werden kann. Zunächst wird das DeZIM-Institut einen wissenschaftlichen Fachimpuls geben und Einblicke auf die technische Umsetzung werfen. Darauf folgen ein Kommentar aus behördlicher Sicht und ein Fachimpuls zu Erfahrungen aus der Praxis. Im Anschluss werden Einblicke in die technische Umsetzung des Gewaltschutzmonitoring gegeben und das Werkstattgespräch endet mit offener Zeit, um Fragen der Anpassung und Umsetzung des Monitorings und der Evaluierung zu diskutieren, Erfahrungen auszutauschen sowie sich bundeslandübergreifend zu vernetzen.
April 2022
-
01.05.2022
Für Mädchen und junge Frauen mit Fluchthintergrund kann das Leben in Deutschland zur besonderen Herausforderung werden, wenn es um schulische und berufliche Perspektiven geht. Sie befinden sich oft in mehrfacher Hinsicht auf der Suche: in einer Phase der Neuorientierung und Selbstfindung, im Übergang vom Kind zur Frau, im Einfluss zweier Gesellschaften und Kulturen. Wie können sie darin gestärkt werden, eigene Wege zu gehen? Wie können sie Gleichberechtigung in ihrem Leben realisieren?
Wer bin ich und was macht mich aus? Was erwarten andere von mir? Was will ich selbst? Was wünsche ich mir für meine Zukunft? Welche konkreten Schritte kann ich gehen in Richtung Schulabschluss, Beruf, Partnerschaft?
Mädchen und junge Frauen mit Flucht- und Migrationsbiografie befinden sich oftmals in mehrfacher Hinsicht auf der Suche: in einer Phase der Neuorientierung und Selbstfindung, im Übergang vom Kind zur Frau, im Einflussbereich von zwei Gesellschaften und Kulturen.
Der Alltag bietet oft nicht genügend Zeit, diese Fragen der Neuorientierung aufzugreifen.
Wir laden Mädchen und junge Frauen ab 16 Jahren zu einem Workshop nach Loccum ein, der Ressourcen sichtbar machen und stärken soll.
Er wird angeleitet von interkulturell erfahrenen Trainerinnen und einer Künstlerin, die mit kreativen Methoden zur Auseinandersetzung über den eigenen Lebensweg anregen. Spaß und Freude werden garantiert nicht zu kurz kommen!
Auch Sprachanfängerinnen sind ausdrücklich eingeladen!
Angesichts vermehrter Fluchtbewegungen in die Bundesrepublik rückten in den letzten Jahren auch Asylsuchende mit Behinderungen mehr und mehr in den Fokus Sozialer Arbeit. Die EU gesteht dieser Personengruppe als „besonders Schutzbedürftige“ spezielle Versorgungsgarantien zu. Gleichzeitig stellt die Versorgung und Unterbringung dieser Menschen alle Beteiligten regelmäßig vor große Her-ausforderungen. Fehlende Identifizierung in den Erstaufnahmeeinrichtungen, eine mangelhafte Aus-stattung vieler Kommunen sowie Unsicherheiten seitens der Fachkräfte in Fragen des Leistungsrechts tragen dazu bei, dass viele Betroffene durch die Lücken im System fallen.
Wie aber können Fachkräfte diesen Problemen in ihrem Alltag begegnen? Welche Handlungsspiel-räume bieten sich, um Betroffenen ein Höchstmaß an Teilhabe zukommen zu lassen?
-
29.04.2022
Es ist kompliziert – so ähnlich könnte die Beziehung zwischen Polizei und Zivilgesellschaft in einem kurzen Satz beschrieben werden. Demonstrationsgeschehen sowie alltägliche Polizeieinsätze bieten wiederholt Anlass für Auseinandersetzungen, die die Gesellschaft polarisieren. Das angespannte Verhältnis zwischen den beiden ungleichen Akteurinnen spiegelt sich auch in öffentlichen Debatten wider, wie z.B. um die Notwendigkeit einer Studie zu Rassismus oder zum Umgang mit bekanntgewordenen Fällen rechter Gesinnung in den Behörden. Nicht zuletzt entzünden sich Diskussionen an der Frage der Legitimität und Angemessenheit staatlicher Gewaltanwendung.
Getreu dem Leitspruch besser miteinander statt übereinander reden, bringt das Modellprojekt „Haltung zeigen. Zum Dialog zwischen Polizei und Zivilgesellschaft“ daher eine Gruppe von Vertreter*innen beider Seiten aus der Region im Rahmen einer Fortbildung in 3 Modulen in einen Dialog.
Migration als Einschnitt in der Lebensgeschichte erfordert das Hinterfragen von Selbstverständlichkeiten. Der rote Faden, der sich durch die Begleitung von Geflüchteten zieht, ist das wiederholte Bewusstmachen eigener Aufgaben und Rollen, die vor der Migration im Herkunftsland funktioniert haben. Unter den neuen Lebensbedingungen muss die Wirksamkeit dieses mitgebrachten Repertoires überprüft werden. Bisher nicht Hinterfragtes, das Orientierung gab, gerät ins Wanken und neue Orientierung muss geschaffen werden.
Ehrenamtliche Helfer*innen können Geflüchtete dabei unterstützen, Verhaltensweisen und Wertvorstellungen aus dem eigenen soziokulturellen Hintergrund über- und umzudenken und jene zu bewahren, die für sie immer noch hilfreich sind. Und sie können die Erweiterung des mitgebrachten Werte- und Verhaltensrepertoires fördern. Gleichzeitig können Ehrenamtliche durch den*die Geflüchtete selbst neue Einblicke auf eigene Vorstellungen und Verhaltensweisen erhalten und diese um- oder überdenken, was in der Konsequenz die gegenseitige Verständigung fördert.
Asylantragszahlen seit 2015 zeigen: Flucht ist jung und männlich. Die bundesweite Präventionslandschaft ist jedoch kaum auf die spezifischen Bedarfe von jungen geflüchteten Männern ausgerichtet. Perspektivlosigkeit, eingeschränkte Autonomie, Stigmatisierung, gepaart mit hohen Erwartungen aus den Herkunftsländern, erschweren die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben erheblich. Tradierte, gewaltlegitimierende Männlichkeitsnormen können herkunftsunabhängig besonders in konservativen und ehrkulturellen Familienstrukturen während der Adoleszenzphase unreflektiert in ein toxisches Männlichkeitsbild und Gewaltschleifen münden.
Seit einem Jahr begleitet das DFK das Projekt „BROTHERS“ – Gewaltprävention bei (geflüchteten) Jugendlichen powered by HEROES (Gewinner Niedersächsischer Sozialpreis 2021). Zwei Teamleiter bilden vier Jugendliche – vorrangig mit Fluchthintergrund – im Alter von 14 bis 25 Jahren zu „BROTHERS“ aus. Diese geben ihr Wissen zu Selbstreflexion, Ehre, Wahrnehmung von Grenzen und Gewalt sowie Entwicklung von Handlungsalternativen und Rhetorik dann Peer-to-Peer in Workshops an Schulen und Jugendgruppen auch an die sonst schwer erreichbare Zielgruppe innerhalb der Flüchtlingscommunity weiter. Das DFK fördert die Projektevaluation und möchte zusammen mit dem Projektträger Bonveno Herausforderungen aus dem Projektalltag sowie erste Erfahrungen aus den Workshops vorstellen.
Die Veranstaltung findet im Rahmen des DPT-TV des 27. Deutschen Präventionstages statt. Eine Anmeldung zum 27. DPT ist über folgenden Link möglich: https://www.praeventionstag.de/nano.cms/onlineanmeldung
Auslöser für Traumata bei Kindern und Jugendlichen sind divers:Gewalterfahrungen in der Familie, der Verlust einer Bezugsperson oder etwa grundlegende Veränderungen von Lebensbedingungen bei nationalen und internationalen Krisensituationen.
Es ist beispielsweise davon auszugehen, dass viele minderjährige Geflüchtete emotional sehr belastet sind – aufgrund schwieriger, traumatischer Erfahrungen im Herkunftsland und auf der Flucht und nicht zuletzt aufgrund ihrer Situation in Deutschland.
Die Tagesschulung gibt eine Einführung in das Thema und gemeinsam erarbeiten die Teilnehmenden Antworten auf Fragen rund um das Thema Trauma. Die Teilnehmenden lernen was ein Trauma ausmacht, lernen Traumafolgen und die posttraumatische Belastungsstörungen kennen sowie mögliche Anzeichen und Symptome. Ebenso lernen sie, einen sensiblen und wertschätzenden Umgang mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen zu finden, um ihnen und ihren Eltern unterstützend beizustehen – ohne dabei die eigene Selbstfürsorge aus den Augen zu verlieren.
Vom Mythos der gleichen Chancen für alle und Diskriminierung aufgrund der sozialen Herkunft Im letzten Jahr wurde an verschiedenen Punkten einmal mehr deutlich, dass wir in einer Klassengesellschaft leben: die prekären Arbeitsbedingungen von Wanderarbeitnehmer*innen und Menschen in sozialen Berufen, die Lebensbedingungen von Personen mit geringem oder überhaupt keinem Einkommen, die familiäre Versorgung, die Organisation von Lernprozessen zu Hause, soziale Unterstützung in krisenhaften Zeiten…
Die Liste ließe sich noch beliebig fortsetzen. Dabei sichern die einen ihren sozialen und ökonomischen Status ab, während die anderen ihre Verhältnisse gerne überwinden würden. Die Individualisierung von gesellschaftlichen Problemlagen trägt dazu bei, Macht- und Ausbeutungsverhältnisse aufrecht zu erhalten. Welche Teilhabechancen in Bildung, aber auch in anderen Bereichen der Gesellschaft haben Menschen, die aufgrund ihrer sozialen Herkunft bzw. aufgrund ihrer sozio-ökonomischen Position etikettiert werden? Das Recht auf die unveräußerliche Menschenwürde gilt doch für alle Menschen. Oder steht das etwa nur auf dem Papier?
Die Veranstaltung findet im Rahmen des DPT-TV des 27. Deutschen Präventionstages statt. Eine Anmeldung zum 27. DPT ist über folgenden Link möglich: https://www.praeventionstag.de/nano.cms/onlineanmeldung
Der Report des Kompetenznetzwerkes „Islamistischer Extremismus“ (KN:IX) beschreibt die Herausforderungen, Bedarfe und Trends im Themenfeld „Islamistischer Extremismus“ im Jahr 2021. In der Funktion als bundesweite Schnittstelle und Plattform für zivilgesellschaftliche und staatliche Akteur*innen, hat KN:IX Handelnde aus dem Themenfeld befragt, um ein Stimmungsbild zu erhalten. Auf Basis der Ergebnisse bietet KN:IX spezifische Formate an, um Fachdiskussionen anzuregen und die inhaltliche Arbeit gemeinsam mit den Präventionsakteur*innen weiterzuentwickeln. Bei der Veranstaltung werden das Kompetenznetzwerk KN:IX und die Ergebnisse des Reports vorgestellt. Anschließend gibt es die Gelegenheit, die Herausforderungen für die Zukunft gemeinsam zu diskutieren.
Die Veranstaltung findet im Rahmen des DPT-TV des 27. Deutschen Präventionstages statt. Eine Anmeldung zum 27. DPT ist über folgenden Link möglich: https://www.praeventionstag.de/nano.cms/onlineanmeldung
-
07.04.2022
-
06.04.2022
Die BumF-Frühjahrstagung 2022 zum Thema „Ermächtigung gestalten“ wird vom 4. bis 6. April im Digitalen stattfinden. Dabei wird ein Fokus auf der Rolle der Fachkräfte und auf den Konzepten „Empowerment“ und „Powersharing“ liegen. Was bedeuten diese Begriffe und was heißt es diskriminierungskritisch zu arbeiten? Welche Voraussetzungen braucht es, damit die Ermächtigung geflüchteter junger Menschen möglich wird? Gleichzeitig wird es auch um die Stärkung der Fachkräfte selbst gehen und um den Wissenstransfer und -austausch über etwa rechtliche Grundlagen für eine informierte Arbeit mit jungen Geflüchteten.
Die Frühjahrstagung richtet sich vor allem an Mitarbeitende von Jugendämtern, Trägern der Jugendhilfe, Beratungsstellen, Vormund*innen und andere Personen, die mit jungen geflüchteten Personen arbeiten. Sie bietet Raum für vertiefenden Austausch über die Arbeit mit unbegleiteten und begleiteten Minderjährigen und jungen Volljährigen. Das Ziel der Veranstaltung ist zudem die bundesländerübergreifende Vernetzung zwischen Fachkräften. Eine Tagungsdokumentation wird die Ergebnisse unserer Diskussionen über den Rahmen der Veranstaltung hinaus verfügbar machen.
März 2022
Mit welchen Mitteln arbeiten demokratiefeindliche Bewegungen, um ein starkes Gruppenzugehörigkeitsgefühl unter ihren Mitgliedern zu erzeugen? Inwiefern verschwimmen durch Insider-Codes, satirische Memes und videospielartige Anreizsysteme die Grenzen zwischen Wirklichkeit und Spiel?
Der Fachvortrag beleuchtet die unterschiedlichen Stufen von Radikalisierungsprozessen sowie Manipulationsstrategien aus verschiedenen ideologischen Ecken. Die vortragende Wissenschaftlerin Julia Ebner geht dabei von den Herausforderungen im Umgang mit islamistischem Extremismus aus und knüpft an ihre laufenden Recherchen zu Online-Extremismus, Radikalisierung und Desinformation an.
Das Seminar beinhaltet Basiswissen zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt; Einführung in die recht-liche, politische und soziale Situation von LSBTI-Geflüchteten in Deutschland und in den Herkunftslän-dern; Stärkung von Handlungs- und Verweisungskompetenz im Umgang mit LSBTI-Geflüchteten.
Die Veranstaltung möchte Lehrer:innen und Schulsozialarbeiter:innen Impulse für ihre Arbeit liefern, um sie in einer diversitätssensiblen Pädagogik zu unterstützen. Prof. Dr. Riem Spielhaus stellt in ihrem Vortrag "Und Ayşe spricht über den Islam" religiöse und kulturelle Konflikte im Klassenzimmer vor und wirft die Frage auf, ob diese tatsächlich einen Bezug zu Religion haben.
Deutschland ist eine Migrationsgesellschaft und das wird auch für die Lebenswelten junger Menschen immer selbstverständlicher: Im Unterricht ergeben sich damit neue Möglichkeiten, Herausforderungen und Notwendigkeiten Perspektiven einer zunehmend pluralen Schüler*innenschaft aufzugreifen und zu berücksichtigen.
Zugleich eignen sich die alltäglichen Fragen und Konflikte, die sich in einer vielfältigen Gesellschaft zwangsläufig ergeben, für eine lebensweltnahe Gestaltung des Unterrichts. Die Veranstaltung möchte Lehrer*innen und Schulsozialarbeiter*innen Impulse für ihre Arbeit liefern, um sie in einer diversitätssensiblen Pädagogik zu unterstützen.
Heute scheint Konsens zu herrschen, dass alle Menschen "frei und gleich geboren„ sind. Ist das so in der Realität für alle Menschen in Deutschland? Ebenso scheinen alle einig darin zu sein, dass Rassismus und jede Art und Form von Diskriminierung uns alle angehen, also auch der ganzen Gesellschaft! Doch was ist Rassismus in Deutschland im 21. Jahrhundert? Wie wird Rassismus von Rechtsextremismus unterschieden? Wer und wie wird über "Racial Profiling„ diskutiert? Oder wie sind die islamfeindlichen Straftaten zu beurteilen? Wurde früher auf Toleranz gegenüber den fremden Menschen appelliert, scheint heute Vielfalt, Respekt und Solidarität die neue Narrative zu sein! Doch auch wenn stets auf Gemeinsamkeit statt Ausgrenzung, Miteinander statt Hass appelliert wird, erleben wir immer wieder Anschläge, Morde, Hetzjagden auf unterschiedlichen Menschen. Rechtsextreme Gewalt in Deutschland scheint zum Alltag geworden zu sein! Diese Beispiele zeigen es deutlich: Hanau, Rostock-Lichtenhagen, Hoyerswerda, Rostock, Solingen und Mölln, Eberswalde in Brandenburg und nicht zuletzt die NSU-Morde.
Um gegen Rassismus vorzugehen, sind sich scheinbar alle bemüht, Diversity als Kriterium oder Arbeitsgrundlage gegen jede Form von Diskriminierungen zu benutzen. Es geht dabei um Wertschätzung von ethnischer Herkunft, der geschlechtlichen Identität, dem Alter, Behinderungen, Berufserfahrung oder Religiosität. Doch die Erfahrungen haben bis jetzt gezeigt: Die Vielfalt spiegelt sich in Staat und zivilen Gesellschaft nicht wirklich wieder. Und die Besetzung von Machtstellen mit dem Kriterium Diversity hat leider nicht zu fundamentalen Veränderungen der männerdominierten Strukturen in Staat und Gesellschaft geführt. Die politischen Systeme bzw. ökonomische Modelle scheinen sich eher zu verfestigen, und wenn es so weiter geht, scheint es, dass das "Biozid" definitiv nicht gestoppt werden kann, also die Vernichtung alles "Lebendiges" wird rücksichtslos weiter betrieben. Darum fordern wir, dass ökofeministische Positionen und Überzeugungen bei der Besetzung von Positionen berücksichtigt werden sollten.
In diesem Sinne werden wir gemeinsam versuchen. Über folgende Fragen zu reflektieren:
- Welche sind aber die Grundlagen für menschenfeindlichen bis hin zu rechtsextremen Einstellungen und Verhalten?
- Welches Bewusstsein ist notwendig, um koloniale Kontinuitäten in der heutigen Gesellschaft sichtbar zu machen?
- Welches Bewusstsein gibt es für die eigenen privilegierten Positionen?
- Welche Formen menschenfeindliche bis hin zu rechtsextreme Weltbilder und Argumentationsweisen können festgestellt werden?
- Wer und wie engagieren sich Menschen in menschenfeindlichen bis hin zu rechtsextremen Organisationen, Ideologien oder Parteien?
- Wer sind die Menschen, die gar bei rechtsextrem motivierten Straftaten involviert sind?
- Sind auch Frauen aktiv oder nur Sympathisantinnen bei rechtsextremen Ideologien, Organisationen und Parteien festzumachen?
- Wie werden Begriffe wie Rassismus, Fremdenfeindlichkeit oder Antisemitismus unterschieden?
- Gibt es einen Alltagsrassismus in Deutschland?
- Was wird unter institutionellem und strukturellem Rassismus verstanden?
-
16.03.2022
-
27.03.2022
Die Internationalen Wochen gegen Rassismus sind Aktionswochen der Solidarität mit den Gegnern und Opfern von Rassismus finden auch dieses Jahr wieder vom 14.03. bis zum 27.03. in ganz Deutschland statt.
Im Online-Veranstaltungskalender finden Sie alle Events rund um die Internationalen Wochen gegen Rassismus 2022. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institutionen machen auch dieses Jahr auf ihre Veranstaltungen und Festivitäten im ganzen Bundesgebiet aufmerksam und laden herzlich zum Besuch ihrer Events ein. Im Veranstaltungskalender finden Sie alle Veranstaltungen, die sich mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit befassen.
Geschlecht, Alter, Herkunft, soziale Klasse – so haben wir gelernt die Vielfalt unserer Gesellschaft zu gliedern. Die Referentin hat lange die Frage bewegt, welche Kategorien wohl Kinder verwenden würden, um soziale Vielfalt zu beschreiben. Dieser Frage ist sie über eine wissenschaftliche Erhebung mit 38 Münchner Kindern im Alter von 4 bis 10 Jahren nachgegangen.
Die Fortbildung ermöglicht Ihnen durch ein Zusammenspiel aus wissenschaftlichen Betrachtungen, Übungen der Selbsterfahrung und Gruppenreflexionen, das Thema Diversity neu zu denken.
In den letzten Jahren ist die Thematik „Hass und Gewalt gegen Amtsträger*innen und Personen des öffentlichen Lebens“ besonders in den Fokus gerückt und erreichte im Jahr 2019 durch den Tod des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke einen traurigen Höhepunkt.
Auch die großen Veränderungen der Lebensumstände durch die Maßnahmen während der Corona-Pandemie stellten die politischen Entscheidungsträger*innen mehr denn je in den Mittelpunkt der öffentlichen Wahrnehmung.
Unter anderem im Rahmen der neuen Querdenker*innen-Bewegung, aber auch in anderen Kontexten wurden und werden Personen des öffentlichen Lebens Beleidigungen, Bedrohungen und Nötigungen bis hin zu tätlichen Angriffen ausgesetzt.
In zwei Keynote-Vorträgen wird dieses Schwerpunktthema des 13. Niedersächsischen Präventionstages aus Sicht der Forschung sowie im Rahmen eines persönlichen Erfahrungsberichts beleuchtet.
Eine Podiumsdiskussion mit hochrangigen Vertreter*innen der Polizei, Feuerwehr, Kommunalpolitik, kommunalen Prävention, Betroffenenberatung etc. beschäftigt sich unter dem Titel „Was bedeuten Beleidigungen, Drohungen, Hass und Gewalt für Amts- und Mandatsträger*innen und für das Gemeinwohl? Konsequenzen für die Präventionsarbeit“ mit diesem herausfordernden Problemfeld.
Ein weiterer Höhepunkt der Veranstaltung ist die Anerkennung der kommunalen Präventionsarbeit im Rahmen der Verleihung des 1. Niedersächsischen Präventionspreises an drei kommunale Präventionsgremien durch die Niedersächsische Justizministerin.
Neben dem Schwerpunktthema soll die Vielfalt der Präventionsthemen und –projekte in Niedersachsen nicht zu kurz kommen.
Eine Auswahl an Workshops zu unterschiedlichen Themenfeldern der Prävention sowie der „Markt der Möglichkeiten“ werden den 13. Niedersächsischen Präventionstag abrunden und unter anderem wertvolle Informationen für interessierte Teilnehmende bereitstellen.
-
02.03.2022
Weitere Informationen zum neuen Kongressformat des 27. Deutschen Präventionstages finden Sie hier.
-
02.02.2022
Weitere Informationen zum neuen Kongressformat des 27. Deutschen Präventionstages finden Sie hier.
Februar 2022
Gemeinschaftsunterbringung stellt eine große physische und psychische Belastung für Geflüchtete dar. Viele Asylsuchende leben über Jahre hinweg und auch nach Abschluss des Asylverfahrens in Gemeinschaftsunterkünften oder anderen nicht selbst gewählten Wohnformen. Der Aufenthalt in sogenannten Einrichtungen der vorläufigen Unterbringung ist längst nicht mehr vorläufig. Die überwiegende Mehrheit der Menschen, die nach ihrer Ankunft in der Erstaufnahme in die Kommunen verteilt werden, sind in Brandenburg nach wie vor in Gemeinschaftsunterkünften oder Wohnverbünden untergebracht. Lediglich ein Drittel der kommunal untergebrachten Geflüchteten lebt in Übergangswohnungen. Laut Zahlen des Sozialministeriums rangiert Brandenburg mit 65 % zentraler Unterbringung nach wie vor auf dem vorletzten Platz im Bundesvergleich.
Teilhabe durch selbstbestimmtes Wohnen ist ein wichtiger Schritt für ein gesundes Ankommen in Brandenburg. Rechtliche, behördliche und wohnungspolitische Hürden erschweren Geflüchteten jedoch ihren Weg dorthin.
Die Veranstaltung richtet sich an Engagierte und Interessierte im Themenfeld. Wir setzen eine aktive Beteiligung während der Veranstaltung voraus. Bitte melden Sie sich nur an, wenn Sie fest vorhaben, an der Veranstaltung teilzunehmen.
-
18.02.2022
IBIS e. V. bietet am 16.02 & 18.02. jeweils von 16:30-20:00 Uhr Argumentationstraining zum Schwerpunkt Sexismus, Antifeminismus und Rechtsextremismus an. Das Training findet online über BigBlueButton statt.
Kennen Sie diese Situation? Sie sitzen in der Bahn, auf der Arbeit oder mit der Familie zusammen. Plötzlich fällt eine sexistische Aussage. Sie möchten diese nicht unberührt stehen lassen und wollen einschreiten, aber Ihnen fehlen die richtigen Worte? Oder Sie sind sich unsicher, ob eine Äußerung wirklich sexistisch war, fühlen sich aber unwohl?
Dann besuchen Sie doch unser Argumentationstraining zum Schwerpunkt Sexismus, Antifeminismus und Rechtsextremismus! In unseren Argumentationstrainings erfahren Sie zunächst, wie Sie sexistische und antifeministische Aussagen erkennen und wo ein Zusammenhang mit Rechtsextremismus besteht. Anschließend üben Sie diese Aussagen in der Praxis zu entkräften und darauf schlagfertig zu antworten. Für die Teilnahme sind keine Vorkenntnisse nötig.
-
17.02.2022
Migration is at the heart of urban growth, both as a lever of development and as a set of challenges for cities. By 2050, two-thirds of the world’s population will live in cities, external link, with migration driving significant change. In the decades ahead, we will see the continued rise of the megacity and, at the same time, population decline in many regional settings. Increasingly, cities will welcome migration’s contribution to diversity and cultural vibrancy, while they will also struggle to provide services for rising migrant populations or for refugees in need of sanctuary.
This conference reflects on cities as hubs of creativity but also as places of tension where different types of minorities and migrants meet and mingle. We look at top-down urban policies that aim to build on diversity or provide shelter, and to grassroots mobilizations advocating for solidarity and inclusion; we consider how cities negotiate the different levels of governance (local, national and transnational) in managing transit migrant or refugee populations; and we examine the role of diasporas in urbanization. While our focus is transnational, we will also address issues that are unique to Canada. We seek to bring together insights from different world regions to better understand the relationship between migration and the city in the 21st century.
Was heißt das für die demokratische Orientierung der Gesellschaft?
Alle zwei Jahre untersucht die Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung rechtsextreme und demokratiegefährdende Einstellungen in der deutschen Gesellschaft. Die aktuelle repräsentative Umfrage von Dezember 2020 bis Frühjahr 2021 zeigt: Die „Mitte“ ist gefordert, Haltung zu zeigen, Position zu beziehen und ihre Demokratie zu stärken! Die Studie erkennt sowohl Entwicklungen, die die Demokratie fördern, als auch solche, die sie gefährden. Die Mitte selbst schätzt den Rechtsextremismus als größte Bedrohung für die Demokratie ein, und hierin liegt die Chance, ihm zu begegnen.
Über die Ergebnisse der Studie und die Folgerungen für unser Bundesland wollen wir am 15. Februar 2022 ab 17.30 Uhr ONLINE diskutieren mit Boris Pistorius, Innenminister des Landes Niedersachsen, Franziska Schröter, FES Berlin und Herausgeberin der Studie sowie Lars Niggemeyer, Abteilungsleiter Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, DGB Niedersachsen.
Die Erlebnisse und Erfahrungen, die Kinder und Jugendliche im Krieg und auf der Flucht machen, können tiefe seelische Wunden hinterlassen. Schlafstörungen, Angstzustände, Depressionen, aggressives Verhalten und jahrelange psychosomatische Leiden sind häufige Folgen und beeinträchtigen die weitere Entwicklung oft nachhaltig.
In der Februar-Veranstaltung der REFUGIO Online-Fortbildungsreihe wird Dr. Marco Walg einen Einblick in die Spezialambulanz für geflüchtete, häufig unbegleitete Kinder und
Jugendliche in Wuppertal geben. Diese wurde vom Zentrum für seelische Gesundheit des Kindes- und Jugendalters des Sana-Klinikums Remscheid eingerichtet und gibt dieser besonderen Klientel Unterstützung und emotionalen Halt.
Dr. Walg wird sein Gruppenstabilisierungstraining für jugendliche Geflüchtete mit Traumafolgestörungen vorstellen, welches er gemeinsam mit Kolleg*innen entwickelt hat. Das Stabilisierungstraining bietet eine praxistaugliche, effiziente und wirksame Intervention und Prophylaxe bei Traumafolgestörungen. Das Konzept des Stabilisierungstrainings basiert auf Methoden der Verhaltenstherapie, der Dialektisch-Behavioralen Therapie und der Zeitperspektiven-Therapie. Visualisiertes Arbeitsmaterial und eine eigens dafür entwickelte App ermöglichen eine spracharme Durchführung. Darüber hinaus kann Dr. Walg auf eigene Forschungsergebnisse in diesem Kontext eingehen sowie auf Vernetzungsbestrebungen, wie zum Beispiel ein multiprofessioneller Qualitätszirkel.
Januar 2022
Viele Flüchtlinge leben mit dem unsicheren Status einer Duldung: Sie sind ausreisepflichtig, ihre Abschiebung ist nur vorübergehend ausgesetzt.
Wann und warum erhalten Flüchtlinge eigentlich eine Duldung? Welche verschiedenen Duldungsformen gibt es? Und welche Rechte und Pflichten sind mit diesem Status verbunden? Das klären wir in dieser Kurzschulung für Ehrenamtliche. Es werden keine Vorkenntnisse vorausgesetzt.
Anmeldung bitte bis zum 27.01.2022 bei Maria Fechter unter ehrenamt2 (at) frnrw.de
-
30.01.2022
In Zusammenarbeit mit dem Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart, dem Diakonischen Werk Württemberg und dem DGB-Bezirk Baden-Württemberg
Unbegleitete Minderjährige werden aufgrund ihrer hohen Schutzbedürftigkeit besonders behandelt. Dazu gehört unteranderem, dass das Jugendamt sie in Obhut nimmt, bis sie mit ihren Personensorge- oder Erziehungsberechtigten zusammen sind oder volljährig werden. Rechtliche Grundlage hierfür ist das Kinder- und Jugendhilferecht im Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII).
Susanne Achterfeld wird im Rahmen ihres Vortrags einen Überblick über die jugendhilferechtliche Praxis geben und ihren Blick insbesondere auch auf die damit verbundenen migrationsrechtlichen Besonderheiten richten. Nach ihrer Tätigkeit als Rechtsanwältin mit dem Schwerpunkt für Ausländer- und Asylrecht, arbeitet Susanne Achterfeld seit 2016 im Deutschen Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (DIJuF) als Referentin für Kinder- und Jugendhilferecht sowie Asyl- und Ausländerrecht mit dem Schwerpunkt unbegleitete minderjährige Ausländer*innen.
"20 Jahre Violence Prevention Network – dieses Jubiläum haben wir zum Anlass genommen, unsere Expertise in der Extremismusprävention und Deradikalisierung in einer besonderen Ausgabe der Schriftenreihe zu bündeln.
Wir stellen
„Erfolgreiche Distanzierungs- und Deradikalisierungsarbeit –
20 Jahre Verantwortungspädagogik – entwickelt von Violence Prevention Network“
am 25. Januar 2022 von 10.00 bis 11.30 Uhr online vor.
Nach einem Grußwort von Thomas Mücke, Geschäftsführer von Violence Prevention Network, geben Ihnen Kolleg*innen aus den Phänomenbereichen Rechtsextremismus und religiös begründeter Extremismus Einblicke in die Praxis der Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention sowie in den Fachbereich Wissenschaft. Durch das Programm führt Dr. Dennis Walkenhorst, wissenschaftlicher Leiter von Violence Prevention Network."
Anmeldungen sind an presse@violence-prevention-network.de möglich
- Wie begegne ich Angriffen und Aggression im Netz?
- Wie treten extremistische Gruppen im Internet auf?
- Wie erkenne ich Fake News?
- Wie kann ich selbst aktiv gegen Hass und Hetze vorgehen? *Wie ist die rechtliche Situation in Österreich?
- Wie kann ich Betroffene von Hass im Netz unterstützen?
- Wo und wie bekomme ich als Betroffene*r Hilfe?
Nach wie vor ist Afghanistan eines der Hauptherkunftsländer für Flüchtlinge. Obwohl die Sicherheitslage sich auch im letzten Jahr verschlechtert hat, wird von offizieller Seite versucht den Zugang von afghanischen Flüchtlingen nach Europa und ihre Bleibemöglichkeiten weiter zu erschweren.
Neben der allgemeinen Sicherheitslage in Afghanistan haben Flüchtlinge die unterschiedlichsten Fluchtgründe. In der Veranstaltung sollen diese an Beispielen dargestellt werden und ihre jeweilige Bedeutung für das Asylverfahren erläutert werden. Anhand der Beispiele werden die unterschiedlichen Schutzmöglichkeiten im Asylrecht dargestellt. Darüber hinaus werden Fragen des Familiennachzugs und die Möglichkeiten, in Griechenland gestrandete Familienangehörige über die Dublin-Regeln nach Deutschland zu holen, besprochen.
Dargestellt werden auch die Möglichkeiten außerhalb des Asylverfahrens ein Aufenthaltsrecht zu erhalten.
Dezember 2021
Fortbildungen im Januar, Februar und März 2022 bei IBIS e.V. in Oldenburg
Termine:
Asyl-, aufenthalts- und sozialrechtliche Bedingungen und psychosoziale Krisen (Sa. 15.01.22; online)
Trauma- und vielfaltssensible Beratung und Therapie für geflüchtete Familien I (Sa. 29.01.22)
Trauma- und vielfaltssensible Beratung und Therapie für geflüchtete Familien II (Sa. 12.02.22)
————–
Vielfalts- und diskriminierungssensible Haltung: Lebensrealitäten von queeren Geflüchteten I (Sa. 26.02.22)
Vielfalts- und diskriminierungssensible Haltung: Lebensrealitäten von queeren Geflüchteten II (Sa. 12.03.22)
Inhalt:
Vor und auf der Flucht machen viele geflüchtete Menschen psychisch sehr belastende und traumatisierende Erfahrungen. Häufig werden Traumata ausgelöst durch Kriegserlebnisse, den Verlust von Existenzgrundlagen und Angehörigen, Schutz- und Orientierungslosigkeit und verschiedene Formen massiver physischer und psychischer Gewalt. Doch auch nach der Flucht sind Asylsuchende enormen Belastungen ausgesetzt, welche ihre Lebensverhältnisse und Möglichkeiten der Traumaverarbeitung beeinflussen. Dazu gehören insbesondere Probleme im Asylsystem, (strukturelle) Diskriminierung, Familientrennung, eingeschränkte Gesundheitsversorgung und sprachliche Hürden. Wie kann in der Beratung und Therapie professionell mit diesen Bedingungen und individuellen Lebensrealitäten umgegangen werden? Welche Haltungen, Handlungsansätze und Methoden braucht es? Die Fortbildungsreihe widmet sich diesen Fragen aus einer psychosozialen Perspektive – mit besonderem Fokus auf die Themen Gesundheit und geschlechtliche Identitäten sowie sexuelle Orientierungen.
Zielgruppe:
Die kostenlosen Fortbildungen richten sich an: Behörden, Beratungsstellen, Therapeut_innen,pädagogische und sozialarbeiterische Einrichtungen, Kinder- und Jugendhilfe, Jugendämter sowie weitere haupt- und ehrenamtlich tätige Personen und Interessierte.
Es ist möglich, an allen Fortbildungen (1-5) oder einem der Fortbildungsblöcke (1-3 oder 4-5) teilzunehmen (mit Teilnahmebescheinigung).
The EU-funded Cutting Crime Impact (CCI) project is coming to an end and so is the 10-part webinar series with the German Prevention Congress (DPT). The final webinar will give an overview of the CCI project over the past three years and an outlook on how project results can be used appropriately, wisely and sustainably.
We will start with a keynote by Dr Raphael Bossong, who will put the CCI Project into a European contemporary spirit. He will give us a brief overview of security policy in Europe up to the start of the CCI project and reflect on the European trends we are currently moving in. He will explore what is missing in the current European security policy regarding the fight against high-impact petty crime and how CCI can contribute to these challenges.
Afterwards, Professor Caroline Davey and Andrew Wootton, CCI Project Coordinators, will reflect on Cutting Crime Impact. Thinking back and looking forward: they will talk about lessons learned and future steps for CCI.
The need for a better defined European Security Model was outlined in the Horizon2020 research programme. CCI was asked to intergrate high-impact petty crime into the European Security Model. Yet research undertaken during the project found that a definitive European Security Model does not actually exist, therefore we created our own, new version of a European Security Model – a human-centred conceptualisation of security, which Professor Caroline Davey and Andrew Wootton will present in this webinar.
We will conclude the webinar with short statements from the Advisory Board Members who have accompanied and supported the project. We are looking forward to you joining us and your questions and comments.
Im Seminar werden kind- bzw. jugendspezifische Fluchtgründe erörtet und eine Abgrenzung zu Fluchtgründen volljähriger Menschen vorgenommen. Weiter wird auf die Besonderheiten bei der Anhörungsvorbereitung eingegangen und diskutiert, welche besonderen Punkte zu beachten sind.
Zum Abschluss werden die Folgen von kind- und jugendspezifischen Fluchtgründen bei Erreichen der Volljährigkeit thematisiert.
Referent: Dr. Stephan Hocks, Rechtsanwalt und Autor (u.a. Fachbuch Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge), Frankfurt am Main
-
13.12.2021
Der Anschlag auf die Synagoge in Halle (Saale) zu Yom Kippur am 9. Oktober 2019, bei dem zwei Menschen getötet und die Ermordung von vielen weiteren Personen nur durch eine verschlossene Tür verhindert wurde, zeigte in bestürzender Weise, dass Antisemitismus in Deutschland allgegenwärtig ist. Erst zu Yom Kippur dieses Jahr wurde ein solcher Angriff auf die Synagoge in Hagen vereitelt.
Auf unserer zweitägigen Veranstaltung widmen wir uns aber nicht nur der Frage, wie zivilgesellschaftliches Engagement gegen die verschiedenen Erscheinungsformen von Antisemitismus gestaltet werden kann, sondern vor allem wollen wir kennenlernen und erarbeiten, wie jüdisches Leben in Deutschland heute sichtbar gemacht und unterstützt werden kann.
Die Veranstaltung dient der bundesweiten und nachhaltigen Vernetzung von Vereinen, Initiativen und Projekten gegen Antisemitismus. Wir wollen zu neuen Formen des Engagements ermutigen, anhand von Praxisbeispielen Lösungsmöglichkeiten und präventive Strategien diskutieren sowie weiterentwickeln und den Engagierten Hilfestellungen für aktuelle Herausforderungen im ehrenamtlichen Alltag mitgeben.
In diesem Workshop möchten wir gemeinsam einen vertraulichen Raum schaffen, in dem wir uns darüber austauschen können, was uns bewegt, mit welchen Situationen wir gut klarkommen und welche Situationen uns noch immer Schwierigkeiten bereiten. Wir wollen uns gegenseitig zeigen, welche Sprüche uns helfen, um auf unangenehme Fragen zu antworten, welche Musik uns am besten durch den Tag hilft und welche Memes-Seite uns am besten ablenkt.
Gemeinsam wollen wir anhand verschiedener Übungen einen Austausch fördern, uns reflektieren und uns gemeinsam und gegenseitig stärken.
Anschließend wollen wir mit euch Wege finden, diese Stärkung mit in den Alltag hinaus zu nehmen."
Obwohl die sozialwissenschaftliche Forschung zu Rassismus in Deutschland bereits seit Jahrzehnten vor allem in akademischen und aktivistischen Nischen existiert, gewinnt sie erst seit Kurzem zunehmend öffentliche Aufmerksamkeit: Zum einen durch die Auseinandersetzung mit rassistischen Gewaltverbrechen und der extremen Rechten, zum anderen auch durch die erstarkten gesellschaftlichen, medialen und politischen Debatten um Rassismus in jüngster Vergangenheit.
Im Fokus der wissenschaftlichen Auseinandersetzung stehen dabei Phänomene und Erfahrungen des alltäglichen, institutionellen und strukturellen Rassismus sowie rassistischer Hasskriminalität, Auswirkungen von Rassismus auf gesellschaftliche Teilhabe und Ungleichheiten, aber auch seine historischen Kontinuitäten und ihre Aufarbeitung. Um diese Forschung mit einer interdisziplinären Zusammenhaltsforschung zu verknüpfen, sind theoretische, empirische und (ideen-)geschichtliche Zugänge ebenso hilfreich wie die Untersuchung konkurrierender normativer Orientierungen, Konzepte sozialer Identitäten sowie emanzipatorischer Bewegungen und Praktiken. Rassismussensible Forschung braucht auch den Dialog mit jenen, innerhalb und außerhalb der Forschungslandschaft, deren Lebensrealität durch Rassismus beeinflusst ist. Diesen Dialog soll die Fachtagung durch unterschiedliche Formate verstärken.
Ziel der digitalen Fachtagung ist es, die Verknüpfung zwischen unterschiedlichen wissenschaftlichen Forschungsansätzen, Fragestellungen und interdisziplinären Forschungstraditionen voranzutreiben. Sie fördert den wechselseitigen Transfer zwischen Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft, in dem lebensweltliche und zivilgesellschaftliche Perspektiven auf die Probleme und Herausforderungen in Bezug auf Rassismus und Zusammenhalt nicht fehlen dürfen.
Die Fachtagung wird vom IDZ als Teilinstitut Jena des Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt ausgerichtet und wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.
"Wir diskutieren und üben mit Ihnen die Grundprinzipien Radikaler Höflichkeit im Umgang mit Rechtspopulismus in verschiedenen Alltagssituationen. Dafür arbeiten wir mit den Erfahrungen, die Sie mitbringen – und diskutieren gemeinsam mit Ihnen, wie sich unsere Ansätze in Ihrem Alltag anwenden lassen. Sie erwartet eine Mischung aus Inputs, praktischen Übungen und moderierten Diskussionen. Sie erhalten anwendbares Basiswissen über Rechtspopulismus, werden für seine Auswirkungen im Alltag sensibilisiert und lernen, verschiedene Situationen und Ihren Umgang mit ihnen zu differenzieren.
Das Argumentationstraining wird von dem Projekt Prävention und Gesellschaftlicher Zusammenhalt (PGZ) organisiert."
-
08.12.2021
Menschen auf der Flucht sind besonders gefährdet, Gewalt zu erfahren und/oder ausgebeutet zu werden. Die besondere Gefährdung bleibt auch im europäischen Aufnahmeland bestehen. Faktoren wie prekäre Unterbringung, eingeschränkte Rechte, Lücken im Unterstützungssystem sowie fehlende Informationen zur eigenen rechtlichen Situation können das Risiko erhöhen, in ausbeuterische Situationen zu gelangen.
In Deutschland stehen Betroffenen von Menschenhandel besondere Schutzrechte zu. Doch nur, wenn sie als Betroffene von Menschenhandel erkannt werden, können sie ihre Rechte wahrnehmen und Unterstützung erhalten.
Waldbrände in Griechenland und der Türkei, Überschwemmungen in Deutschland: Die Naturkatastrophen im Sommer 2021 haben uns die Folgen des Klimawandels einmal mehr vor Augen geführt. Extreme Wetterereignisse nehmen Wissenschaftler*innen zufolge durch die Erderwärmung zu und bedrohen die Lebensgrundlagen vieler Menschen weltweit. Anhaltende Dürren, schmelzende Gletscher und der steigende Meeresspiegel machen ganze Landstriche unbewohnbar.
Besonders im Globalen Süden sind die Folgen schon heute spürbar, obwohl gerade ärmere Länder nicht zu den Hauptverursachern der menschengemachten Erderwärmung zählen. Die Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch e.V. nennt es einen „Gerechtigkeitsskandal“, dass die Weltgemeinschaft beim UN-Klimagipfel in Glasgow keine verbindlichen Zusagen gemacht hat, um die Betroffenen von klimabedingten Schäden angemessen zu unterstützen.
Die Klimakrise ist dabei nicht nur eine Gefahr für Natur und Umwelt, sondern auch für den Frieden und die menschliche Sicherheit. Bestehende Konflikte werden verschärft, neue könnten entstehen. So fehlen beispielsweise vielerorts Mechanismen zur gewaltfreien und gerechten Verteilung von knapper werdenden Ressourcen. Manche Beobachter*innen sprechen sogar von drohenden „Klima-Kriegen“. Gefährdet die Erderwärmung den Frieden weltweit? Was kann Friedensarbeit zur notwendigen Transformation beitragen? Wie kann eine konfliktsensible Klimapolitik aussehen? Und wie sind vor diesem Hintergrund die Ergebnisse des Klimagipfels von Glasgow einzuschätzen?
November 2021
Im Workshop werden sowohl der Begriff als auch der Anspruch von Empowerment thematisiert, Hindernisse erörtert, gute Beispiele gesammelt sowie die Arbeit der Flüchtlingshilfe Sprockhövel als Good Practice-Beispiel vorgestellt. Im Rahmen des Workshops erhalten Sie außerdem Tipps und Anregungen, wie Sie Ihre Arbeit auch in Pandemie-Zeiten aufrechterhalten können. Schließlich können eigene Vorhaben und Projekte mit Blick auf eine stärkere Beteiligung und das Empowerment von Geflüchteten konzipiert und optimiert werden. Dieses Seminar richtet sich an ehren- und hauptamtliche Kräfte in der Arbeit mit Neuzugewanderten.
Seit März 2020 beschäftigt sich das Forschungs- und Transfervorhaben PrEval mit Fragen der Evaluation und wissenschaftlichen Begleitung von Maßnahmen in der Extremismusprävention sowie an den Schnittstellen zur politischen Bildung und Gewaltprävention.
PrEval nutzt Analyse-, Monitoring- und Mapping-Formate und entwickelt multimethodische Evaluationsdesigns im Rahmen von ausgewählten Pilotstudien. Ziel von PrEval ist es, im Dialog mit den verschiedenen Präventionsakteuren aus Fachpraxis, Sicherheitsbehörden, Verwaltung und Wissenschaft den aktuellen Wissensstand zu Evaluation und Qualitätssicherung zu erheben und gemeinsam Evaluationsdesigns, gerade an diesen Schnittstellen zwischen verschiedenen Präventionsbereichen, Zugängen, Phänomenfeldern und Akteuren, zu diskutieren.
Auf dem PrEval-Fachtag 2021 sollen die Ergebnisse des bisherigen Dialogs zwischen Fachpraxis, Behörden und Wissenschaft vorgestellt und reflektiert werden.
Anmeldung zum Online-Fachtag bis zum 18. November 2021 unter Angabe von Namen und Institution per Mail an: preval@hsfk.de
Junge begleitete und unbegleitete Geflüchtete bringen bereits eine Vielzahl an Ressourcen und Strategien zur Bewältigung dieser Übergangsprozesse mit. Hier setzt der Methodenworkshop an und bietet Anregungen für Fachkräfte und Ehrenamtliche in der Arbeit mit den Jugendlichen zur Stärkung ihrer Identität und vorhandener Bewältigungsstrategien sowie zur selbstreflexiven Auseinandersetzung mit der eigenen (professionellen) Haltung.
Schwierige Asylverfahren, langes Warten auf einen Schulplatz, Übersetzen für die Eltern, Erlebnisse der Diskriminierung, fremdbestimmtes Wohnen – sind nur einige der zu bewältigenden und für junge Geflüchtete oft herausfordernden Übergänge. Für die eigentlichen Themen der Jugendphase bleibt dabei kaum Zeit oder Raum.
Wenn Medien über Religion berichten, geht es meist um Unterschiede und Trennendes. Dabei haben verschiedene Religionen viel gemeinsam, unter anderem ihren Einsatz für die Gesellschaft. Die interreligiöse Gesprächsrunde geht der Frage nach, „was Religionsgemeinschaften zum sozialen Frieden in unserer Gesellschaft beitragen“.
Neben Vertreter*innen aus jüdischen, christlichen, muslimischen und Bahai-Gemeinden im Kreis Offenbach steht zu Beginn der Veranstaltung dabei ein Impulsvortrag von Ulf Plessentin, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Leiter der Öffentlichkeitsarbeit des Zentrums für Religionswissenschaftliche Studien der Universität Bochum. Moderiert wird der Online-Talk von Paola Fabbri-Lipsch vom Zentrum Ökumene der Evangelischen Kirche, Frankfurt.
Weitere Informationen zum Projekt:
Rückkehrer*innen und die (ausbleibende) Rückführung deutscher Staatsangehöriger aus den Camps in den kurdischen Gebieten sind auf politischer, zivil- und gesamtgesellschaftlicher Ebene relevante Themen. Diese wollen wir im Rahmen unserer Veranstaltung am 17. November 2021 aufgreifen. Wir freuen uns, Sie für diesen Tag zu einem neuen Format begrüßen zu können: unserem ersten Online Politik- und Pressegespräch – dieses Mal live aus den Türmen am Frankfurter Tor in Berlin.
Nach Vorträgen von Prof. Peter Neumann (King´s College London) und Sofia Koller (Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik e. V.) werden wir gemeinsam mit Claudia Dantschke (Grüner Vogel e. V.) und Gästen aus der Politik über den Umgang mit Rückkehrer*innen aus dem so genannten Islamischen Staat diskutieren. Weitere Informationen zur Veranstaltung folgen in Kürze.
-
21.11.2021
Der Lokalsender Oldenburg Eins (oeins) und die Redaktionsgruppe Radio Globale/MITEINANDER LEBEN haben eine Themenwoche im Radio und TV zusammengestellt – unter vielfältiger Beteiligung verschiedener Menschen, lokaler Gruppen und Institutionen.
Die Aktionswoche will sensibilisieren und anregen. In den Beiträgen und Sendungen geht es um das Verstehen und Verständnis unterschiedlicher Lebensrealitäten - in den Nachbarschaften, Stadtteilen, Arbeitswelten.
Beispiele dazu werden aus verschiedenen Perspektiven dargestellt. Die Aufmerksamkeit gilt der Frage, wie ein gutes und faires Miteinander vor Ort und darüber hinaus gelingen kann.
Informationen, Kennenlernen, Austausch und Respekt sind dafür wichtige Grundlagen. Dies zeigen die zahlreichen Sendungen und ihre Schwerpunktthemen.
-
14.11.2021
Projekte bestimmen mehr und mehr unsere professionelle als auch ehrenamtliche Arbeit im Team. Doch häufig laufen Projekte nicht so wie gewünscht. Das Lösen von Problemen kostet dann viel Zeit und Energie und drückt auf die Stimmung und Produktivität des Projektteams. Ein durchdachtes Projektmanagement und die passenden Methoden für das jeweilige Projekt können helfen, Schwierigkeiten im Vorfeld zu vermeiden und gelassener mit Unwegsamkeiten umzugehen.
In diesem kompakten Projektmanagement-Seminar eignen Sie sich in kürzester Zeit die hierfür nötigen Grundlagen und Werkzeuge an.
Sie lernen, wie Sie Projekte erfolgreich initiieren, planen, durchführen und abschließen. Klassische Projektmanagement-Tools wie bspw. die Projektcharta, der Projektstrukturplan und die Meilensteinplanung helfen Ihnen dabei, den Überblick zu behalten. Zudem sind Sie in der Lage, agile Methoden und Techniken zu nutzen, um flexibel auf Veränderungen reagieren zu können. Agiles Arbeiten muss man erfahren, daher werden die bekanntesten agilen Methoden "Scrum" und "Kanban" im Rahmen von Teamübungen simuliert.
Am Ende des Seminars sind Sie in der Lage, die für Ihre Projekte passenden Strategien zu entwickeln und bewusst Entscheidungen zu treffen - klassisch, agil oder auch kombiniert: hybrid.
Methoden und Techniken sind aber nur die halbe Miete im Projekt - daher wird im Seminar auch besonderer Wert auf die Teamarbeit, Projektleitung und den Umgang mit Konflikten gelegt. Der Workshop richtet sich insbesondere an Jugendliche und ehrenamtliche Akteure.
-
11.11.2021
-
11.11.2021
Die vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und UNICEF ins Leben gerufene Bundesinitiative „Schutz von geflüchteten Menschen in Flüchtlingsunterkünften“ blickt auf intensive Arbeitsjahre zurück. Anlässlich des diesjährigen Netzwerktreffens blicken wir zugleich in die Zukunft: Was hat die Bundesinitiative erreicht und welche Herausforderungen stehen bevor?
Das diesjährige Netzwerktreffen widmet sich daher der Frage, welche Wege im Bündnis zwischen Behörden, Zivilgesellschaft und Praxis besonders vielversprechend sind, um bestehende Lücken bezüglich des Schutzes von geflüchteten Menschen in der Unterbringung zu schließen und den Gewaltschutz weiter voranzubringen. Hierfür finden am ersten Tag des Netzwerktreffens ein Impulsvortrag, exemplarische Blitzlichter aus der Praxis und der Zivilgesellschaft und ein Podiumsgespräch statt. Darüber hinaus haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, mehr über die aktuell vier Modellprojekte im Kontext der Bundesinitiative zu erfahren und sich in ‚virtuellen Flurgesprächen‘ themenbezogen zu vernetzen. Am zweiten Tag finden an jeweils zwei Zeitslots Online-Workshops parallel statt. Die Teilnahme an den Online-Workshops ist optional.
Design for Security (DfS) is a team of built environment professionals (architects, landscape architects & planners), within Greater Manchester Police (GMP) that provide security and crime prevention assessments of built environment design proposals. Engagement with DfS is a statutory requirement for developments seeking planning approval for 'major projects' in Greater Manchester.
As part of the EU funded Cutting Crime Impact project the ProMIS tool has been developed to support the DfS team, through enhanced project management and understanding the impact of CPTED within GMP. David will be presenting this tool. ProMIS will enable DfS to gain a much needed visual analysis of urban development across Greater Manchester; especially with regard to the growth and development of new communities, and their impact on infrastructure needs. With the use of Geographic information system mapping the tool will support long term tracking of historic DfS projects in a geographic context (i.e. mapping DfS projects across Greater Manchester), and their potential impact on future policing resourcing strategies.
Umberto will discuss the importance of early stage design interaction and CPTED alongside a case study. He will also provide a potted history of Design for Security during its inception.
Speakers:
- David Maher is an Architectural Designer with over 18 years’ experience of delivering buildings and public realm spaces across the UK & Ireland. Since joining Design for Security David has been a guest lecturer discussing the work of DfS and the merits of CPTED principles alongside his architectural and environment experience.
- Dr Umberto Nicolini is an Architect and Director of the Laboratory for Urban Quality and Security (LabQUS) in Italy. Engaged since the very beginning in implementing environmental crime prevention as an institutional tool in planning policies, Umberto has recently promoted and chaired the European Programme COST TU1203 – CP-UDP – as well as many other related projects.
-
09.11.2021
Die diesjährige Herbsttagung des Bundesfachverbands umF steht unter dem Motto „Gut vernetzt – wo steht die Arbeit mit jungen Geflüchteten?“. Sie stellt neben aktuellen Themen aus der Praxis der Arbeit mit (unbegleiteten) minderjährigen Geflüchteten vor allem die Vernetzung in den Vordergrund.
Durch sinkende Fallzahlen vor Ort, damit Abbau von Strukturen und Expertise, Einzelkämpfer*innentum und coronabedingten Wegfall von Arbeitsgruppen und Fachgremien hat die Vernetzung vor Ort gelitten. Wir wollen gemeinsam schauen, welche Vernetzungsstrukturen und -angebote es wo (noch) gibt, wovon wir auch überregional profitieren können und wie wir gute Strukturen stärken können.
Im Fokus steht zudem die Situation von jungen volljährigen Geflüchteten, da dies eine stetig wachsende Gruppe mit ganz eigenen Bedarfen und Voraussetzungen für Betreuung und Beratung ist. Mehr noch als bei Minderjährigen greifen hier aufenthaltsrechtliche und jugendhilferechtliche Aspekte ineinander und bestimmen den Alltag von jungen Menschen und Betreuungssettings. Die Reform des SGB VIII hat Care Leaver in den Blick genommen. Damit ergeben sich auch Änderungen für die Zielgruppe der ehemaligen umF.
Die Tagung findet als eine Hybridveranstaltung statt, 50-60 Teilnehmende haben die Möglichkeit vor Ort dabei zu sein, Weitere können digital teilnehmen. Ggf. wird die Teilnehmendenzahl in den kommenden Wochen noch erhöht werden können.
-
06.11.2021
Europaweit können gewaltverzichtende islamistische Gruppierungen und Bewegungen Zulauf verzeichnen und gelangen durch medienwirksame Aktionen in das Blickfeld der Öffentlichkeit. Von den Gruppierungen gehen unter dem Aspekt der Gewaltbereitschaft kaum Gefahren aus, als problematisch erweist sich aber ihre langfristige gesellschaftliche und politische Wirkung. Die meisten vertreten Ziele und Ideologien, die demokratische Strukturen zu überwinden versuchen, sich gegen ein offenes pluralistisches Gesellschaftsbild richten und damit bestimmte Menschengruppen grundlegend abwerten. Die Gruppierungen üben v.a. große Attraktivität und Anziehung auf junge Menschen aus, denn sie versprechen soziale Bindung und Unterstützung, Integration und Geborgenheit und thematisieren individuelle Ausgrenzungs- und Diskriminierungserfahrungen.
Referierende:
- Noman Mehmood: Islamwissenschaftler, gegenwärtig stellvertretende Projektleitung von Kick-off – Prävention und Deradikalisierung in Strafvollzug und Bewährungshilfe in Schleswig-Holstein bei der Türkischen Gemeinde in Schleswig-Holstein e.V. Zuvor arbeitete er als zertifizierter Onlineberater im Themenfeld religiös begründeter Extremismus und beschäftigte sich mit aktuellen Trends und Entwicklungen der islamistischen Onlineszene.
- Hanna Baron: Islamwissenschaftlerin, derzeit wissenschaftliche Begleitung von PROvention, der Präventions- und Beratungsstelle gegen religiös begründeten Extremismus der Türkische Gemeinde in Schlewsig-Holstein e.V. und Mitglied bei FoPraTEx (Forschung-Praxis-Transfer islamistischer Extremismus. Themenschwerpunkte: gewaltverzichtende (‚legalistische‘) islamistische Gruppierungen in Deutschland, Online-Propaganda, Geschlechterrollen und sexualisierte Gewalt im Islamismus
Am 10. Juni 2021 ist das neue Kinder- und Jugendstärkungsgesetz in Kraft getreten. Für Heranwachsende in stationärer Jugendhilfe stellt die Neuregelung der Hilfen für junge Volljährige dabei eine der wichtigsten Änderungen dar. Denn nach der Neufassung kommt es für die Gewährung der Hilfen nicht mehr darauf an, ob ein (weiterer) positiver Einfluss auf die Entwicklung des Heranwachsenden ersichtlich ist; sondern im Gegenteil darauf, ob eine Entziehung der Hilfen negative Folgen für seine Entwicklung erwarten lässt.
Am 05.11.2021 veranstaltet der Careleaver e.V. einen online-Fachtag zum Thema: Was ändert sich mit dem neuen KJSG für Careleaver*innen?
Hier erfahren Sie, was die Änderungen der Regelungen für Careleaver bedeuten, wie Unterstützung gelingen kann und welche Aspekte für Leistungsvereinbarungen zur Volljährigenförderung aus Careleaver-Sicht wichtig sind. Die Gestaltung guter Übergänge beginnt weit vor der Volljährigkeit, so dass auch die bestehenden Angebote auf ihre Zukunftstauglichkeit (und ihr Potential) überprüft werden.
Denn das Netz enthemmt durch Anonymität, Schnelllebigkeit und das Gefühl, Teil einer Gruppe zu sein, die sich traut, offen ihre Meinung und ihren Hass zu bekunden. Hatespeech, menschenverachtende Inhalte und Verschwörungserzählungen - auch und gerade zu Corona-Zeiten: Extremistische Gruppierungen nutzen das Internet und Soziale Netzwerke, um dort ihre Ideologien zu verbreiten und Hass zu schüren. So sind gerade Soziale Plattformen wie Facebook, Instagram und YouTube der ideale Platz für extremistische Akteure, um Menschen zu erreichen und diese für ihre menschenverachtenden Ansichten zu gewinnen.
Um dieser demokratiefeindlichen Entwicklung etwas entgegenzusetzen, müssen hasserfüllte Inhalte enttarnt und entkräftet werden, damit extremistischen Gruppierungen nicht die Macht über das Internet und somit über das gesamtgesellschaftliche Zusammenleben überlassen wird.
Dieses Online-Seminar ist interaktiv gestaltet und bietet einen selbstreflexiven Ansatz im Umgang mit Hatespeech und Vorurteilen, die analog und virtuell bestehen und unser Denken und Handeln teils unbewusst beeinflussen. Zudem werden Strategien zum Entlarven von Fake News, extremistischen Ansprachen und Hassparolen im Netz erprobt. Darüber hinaus zeigen wir Ihnen auf, mit welchen Strategien Sie dem Hass im Netz entgegengetreten können und vermitteln Ihnen konkrete Handlungsmöglichkeiten.
Das Online-Seminar richtet sich sowohl an Jugendliche als auch ehren- und hauptamtliche Fachkräfte in sozialen und pädagogischen Arbeitsfeldern, die Handlungssicherheit und Handlungsoptionen im Umgang mit Hatespeech und extremistischen Ansprachen im Internet erlangen möchten.
Am Mittwoch, 3. November 2021, 10.00-11.00 Uhr veranstaltet Pufii gemeinsam mit dem Forum Ziviler Friedensdienst und dem Fachdienst Soziales und Senioren der Stadt Salzgitter ein Webinar zum Thema Kommunale Konfliktberatung.
Bei der Kommunalen Konfliktberatung werden Kommunen und zivilgesellschaftliche Akteure durch externe Konfliktberater*innen bei der Analyse integrationsbezogener gesellschaftlicher Konflikte sowie beim Formulieren wirksamer und effektiver Maßnahmen begleitet. Kern und Besonderheit der Methode ist, dass integrationsbezogene Herausforderungen anhand von konkreten Konfliktdynamiken vor Ort analysiert und deren Ursachen bearbeitet werden. So werden auch die Besonderheiten der lokalen Akteuren, der vorhandenen Ressourcen, der konfliktierenden Interessen sowie der lokale Kontext beim Ausarbeiten wirksamer Maßnahmen berücksichtigt.
Im Webinar stellt Bart Denys (forumZFD) zunächst den Ansatz der Kommunalen Konfliktberatung vor. Anschließend wird Katharina Wunderling (Stadt Salzgitter) über die konkrete Arbeit vor Ort und die Wirksamkeit der Methode sprechen. Seit 2015 unterstützt das forumZFD die Stadt Salzgitter bei der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Evaluation des städtischen Integrationskonzepts sowie der Bearbeitung von Konfliktpotentialen angesichts neuer Herausforderungen von Zuwanderung, vor allem im präventiven Bereich.
- Bart Denys ist Programmleiter Kommunale Konfliktberatung (KKB) beim Forum Ziviler Friedensdienst. Er erzielte universitäre Abschlüsse in der Kriminologie, im öffentlichen Management und der Politikgestaltung und in den internationalen Beziehungen und Konfliktmanagement. Als Verantwortlicher für Prävention bei der Stadt Oostende (Belgien) sowie in Projekten der Demokratieförderung, der guten Regierungsführung auf lokaler Ebene und des Konfliktmanagements auf den Balkan und im nahen Osten vertiefte er seine Expertise in diesen Themen. Seit 2017 führt er die Kommunale Konfliktberatung in Deutschland.
- Katharina Wunderling leitet seit 2009 den Fachdienst Soziales und Integration der Stadt Salzgitter. Aufgrund des betriebswirtschaftlichen Hintergrundes stand in den ersten Jahren neben der Leitung des Fachdienstes mit 150 Mitarbeiter*innen die Betrachtung von Wirtschaftlichkeit und Kostentransparenz des Budgets im Vordergrund. In den letzten Jahren verlagerte sich der Fokus auf die Weiterentwicklung der Konzepte der kommunalen Sozialarbeit zur Schaffung von sozialräumlichen Strukturen in enger Zusammenarbeit mit der freien Wohlfahrtspflege.
Kostenlose Anmeldung per Mail an team@pufii.de
Den Zugangslink erhalten die angemeldeten Personen einen Tag vor der Veranstaltung.
Die Lebenslagen von geflüchteten Männern* sind vielfältig; genauso wie ihre Erwartungen und Hoffnungen für ihre Zukunft in Deutschland. Viele der Männer* haben hohe Eigenerwartungen und wollen selbstermächtigt handeln. Doch oftmals sind die Hürden für den selbstständigen Aufbau einer Zukunft durch Ausbildung, Beruf und Familiengründung hoch. Die Eigenerwartungen an „Männlichkeit“ können dann (zu) hoch sein und zu Verunsicherungen führen.
Viele Ehrenamtliche fragen sich, wie sie die Männer* bei ihren Unsicherheiten und Suchbewegungen orientierend begleiten und beraten können. Und welche Rolle kann es eigentlich im ehrenamtlichen Engagement spielen, selbst beispielsweise als Mann* oder Frau* von den Männern* gelesen zu werden?
Der Workshop bietet für Ehrenamtliche zu diesen und weiteren Fragen ein Forum zum Austausch. Praxis- und Methodenbeispiele geben Impulse und Antworten, wie das ehrenamtliche Engagement männlichkeits*kritisch und -sensibel zugleich gestaltet werden kann.
Oktober 2021
Wie können Geflüchtete dabei unterstützt werden, wieder Gestalter*innen ihrer Belange und Umgebung zu werden? Und wie kann eine Unterstützung auf Augenhöhe gelingen?
Im Workshop werden sowohl der Begriff als auch der Anspruch von Empowerment thematisiert, Hindernisse erörtert, gute Beispiele gesammelt sowie die Arbeit der Flüchtlingshilfe Sprockhövel als Good Practice-Beispiel vorgestellt.
Im Rahmen des Workshops erhalten Sie außerdem Tipps und Anregungen, wie Sie Ihre Arbeit auch in Pandemie-Zeiten aufrechterhalten können.
Schließlich können eigene Vorhaben und Projekte mit Blick auf eine stärkere Beteiligung und das Empowerment von Geflüchteten konzipiert und optimiert werden.
Dieses Seminar richtet sich an ehren- und hauptamtliche Kräfte in der Arbeit mit Neuzugewanderten.
Gute Nachbarschaft ist eine entscheidende Grundlage für den Zusammenhalt und die Integrationsfähigkeit unserer Gesellschaft und der Schlüssel für ein sicheres und gutes Leben im Quartier oder Dorf. Gerade die Corona Pandemie hat uns dies noch einmal deutlich gemacht. Aber gute Nachbarschaft geschieht nicht von alleine. Sie kann nur gelingen, wenn unterschiedliche Akteure zusammenarbeiten.
Genau hier setzt das Bündnis an: Ziel ist es, gemeinsam mit den unterschiedlichen gesellschaftlichen Akteuren das nachbarschaftliche Zusammenleben in Niedersachsen zu stärken.
Die Auftaktveranstaltung
- stellt die Ziele des Bündnisses vor
- berichtet aus den ersten Arbeitsgruppen
- präsentiert Beispiele von guten Nachbarschaften
- zeigt Möglichkeiten, wie Sie sich beteiligen können.
-
31.10.2021
Spätestens seit dem Mord an George Floyd in den USA und den darauf folgenden Protesten der Black-Lives-Matter-Bewegung wird auch in der deutschen Mehrheitsgesellschaft verstärkt über Rassismus debattiert. Das gilt auch für die Friedens- und Entwicklungsarbeit. Bei der Aktionstagung wollen wir uns (selbst-)kritische Fragen stellen: Gibt es eine ‚weiße‘ Vorstellung von Frieden und Entwicklung? Wie wirkt das koloniale Erbe in Friedens- und Entwicklungsprojekten bis heute nach? Und wie können wir alle dazu beitragen, rassistische Strukturen und Denkmuster zu überwinden?
Die Aktionstagung 2021 des forumZFD gibt Denkanstöße und ermutigt dazu, in offener Atmosphäre zu lernen. Sie zeigt Möglichkeiten auf, unser eigenes Engagement für Frieden, Entwicklung und die Eine Welt anti-rassistisch zu gestalten. Die Tagung bietet einen geschützten Raum zum Austausch und zum Voneinander Lernen: für Menschen mit unterschiedlichen Wissensständen zum Thema Rassismus, für weiße Menschen ebenso wie für Menschen, die von Rassismus betroffen sind.
"Live, analog und erstmals in Köln
In diesem Jahr schreiben wir mit unserer Bundeskonferenz Geschichte: Wir treffen uns erstmals in Köln statt in Berlin – wow! Nach einer gefühlten Ewigkeit Pandemie wollen wir uns endlich wieder sehen, quatschen, lachen, austauschen und später am Abend auch tanzen, trinken, torkeln – selbstverständlich im Rahmen der dann geltenden Coronaschutzverordnung.
In einem Premium-Panel übers Karrieremachen sprechen wir mit denen, die schon da sind, wo viele von uns hin möchten. Und wir prämieren das Medium mit der unterirdischsten Berichterstattung im Einwanderungsland Deutschland mit der Goldenen Kartoffel 2021.
Wer dabei sein will, muss schnell die Anmeldung ausfüllen. Wir können nicht mehr als 100 NdMedienmacher*innen zulassen, sorry!"
Weitere Informationen zum Projekt:
In diesem Online-Training setzen wir uns intensiv mit den Themen Identität, Vielfalt, Eigen- und Fremdzuschreibungen und Diskriminierung auf individueller Ebene auseinander. Gemeinsam werden Unterschiede thematisiert, eigene und fremde Vorurteile reflektiert und Strategien im Umgang mit Vielfalt erarbeitet – ohne Zeigerfingermoral!
Themen:
- Wie wirkt sich Diskriminierung auf Einzelne aus?
- Was ist meine Identität und mein Umgang mit Gruppenzugehörigkeit?
- Was bedeutet Vielfalt?
- Welche Relevanz haben Unterschiede?
- Wie kann ich mit Unterschieden positiv umgehen und „Vielfalt“ als positiven Wert in meinem (Arbeits-)alltag fördern?
Ein Kind trägt in der Grundschule ein T-Shirt mit der Aufschrift „Kleiner Germane“. Ein Vater organisiert rechte Liederabende und engagiert sich in der Elternvertretung. Ein Mädchen erzählt der Schulsozialarbeiterin von ihrem Ferienaufenthalt im Zeltlager des „Sturmvogels“. Angesichts dieser Beispiele sind pädagogische Fachkräfte mit vielfältigen Fragen konfrontiert: Istdie Familie tatsächlich rechtsextrem? Ist das Privatsache? Wie kann ich den Eltern Grenzen aufzeigen und gleichzeitig die Beziehung zu den Kindern aufrechterhalten? Wie ist es um das Wohl des Kindes bestellt? Wie können wir im Kollegium mit dem Thema Rechtsextremismus umgehen? Wie kann ich Einrichtungen im demokratischen Wirken stärken? Der Fachtag am 14. Oktober 2021 unterstützt pädagogische Fachkräfte darin, einen handlungssicheren Umgang mit diesen Fragen zu finden. Die Vorträge und Workshops informieren und sensibilisieren zu Besonderheiten des Aufwachsens in extrem rechten Elternhäusern im Spannungsfeld zwischen Kindeswohl und Elternrecht.
Der Fachtag in Halle (Saale) richtet sich an pädagogische Fachkräfte aus der Sozialen Arbeit, Kinder-, Jugend-, Familienhilfe und -beratung sowie frühkindlicher Bildung, an Lehrer*innen, Studierende und alle weiteren Interessierten.
Geflüchtete Frauen* sind häufig besonderen, geschlechtsspezifischen Verfolgungsgründen und Gewalterfahrungen ausgesetzt. Die Fortbildung gibt zunächst einen Einblick in Frauen* spezifische Flucht- und Verfolgungsgründe sowie rechtliche Hintergründe im Asylverfahren von Rechtsanwältin Claire Deery.
Im Nachmittagsteil liegt der Schwerpunkt auf der Erkennung und Unterstützung von Frauen* mit besonderen Schutzbedarf im Asylverfahren in Deutschland. Wie wird die besondere Schutzbedürftigkeit im Asylverfahren festgestellt? Was bedeutet das für das Asylverfahren und wo gibt es Verbesserungsbedarf bei der Identifizierung besonderer Schutzbedarfe? Dazu gibt es einen Input von Susanne Heubach (Sonderbeauftragte für Opfer geschlechtsspezifischer Verfolgung sowie für Traumatisierte und Folteropfer, BAMF Thüringen) und Lea Stegmann ( Refugio Thüringen e.V. ) . Anschließend besteht Raum für Austausch und Diskussion.
Inhaltliche Schwerpunkte sind insbesondere:
- Vermittlung von Grundkenntnissen zu Frauen*/Genderspezifische Verfolgungsgründe
- Unterstützungsmöglichkeiten von Frauen* mit besonderem Schutzbedarf im Asylverfahren
- Bedarfe für die Praxis bei der Identifizierung von besonderen Schutzbedarfen
The Estonian Police and Border Guard Board (PJP) have set as one of its strategic objectives the creation of a safe environment for their citizens. Creating a safe space is about preventing crime through the design of the environment. This requires a common understanding of the role of the Estonian Police within the urban development process, and for there to be communication and collaboration between the police and local planners, architects, designers and development companies.
During the Cutting Crime Impact (CCI) project PJP created the Building Safer Cities Together tool, with the aim of developing a comprehensive, methodical and collaborative approach for the development of safe spaces following CP-UDP principles. The tool comprises of a training programme, policy guide and process protocol to enable the Estonian police to support the effective planning, design and development of safe urban environments.
Speakers:
- Mari-Liis Mölder is a prevention specialist at PJP who has worked in the police service for over 10 years. Mari-Liis will introduce the Building Safer Cities Together tool, present the various elements and how these support PJP in achieving their objective.
- Kelly Miido works as a regional police officer at PJP. Kelly will focus on how the police implements the tool in their everyday work, presenting a case study of how the tool has been implemented in the design and development of Tondiraba Park in Talinn. She will talk about the different roles in designing safe urban environments and about cooperation with local partners.
- Pärtel Preinvalt’s role at PJP is in the prevention of radicalisation leading to violent extremism within the context of law enforcement. One of the challenges his team face is the safeguarding safe public spaces. He will talk about non-traditional or unconventional security threats and present how the Building Safer Cities Together tool supports his work.
-
08.10.2021
Zuwanderung ist eine Chance, aber auch eine Herausforderung für Deutschland. Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels ist die Bundesrepublik heute auch auf Immigration angewiesen, um den Fachkräftebedarf der Wirtschaft und die Kosten der Sozialsysteme zu decken. Gleichzeitig hatten insbesondere bei der Flüchtlingskrise von 2015/16 viele Einheimische den Eindruck, dass der gesellschaftliche Wandel sich zu schnell vollzieht und dass die eigene Kultur dabei verloren geht. In extremen Fällen führte dies zu Nationalismus und Rassismus.
Politik und Gesellschaft stehen daher vor der Aufgabe, Zugewanderte kulturell, sozial und wirtschaftlich zu integrieren, um die Chancen der Zuwanderung zu nutzen und gleichzeitig den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu bewahren. Die Integration in Ausbildung und Arbeit spielt dabei eine wesentliche Rolle, weshalb sich die Konferenz speziell diesem Thema widmet.
Es gibt mehrere Communities die sich mit dem Thema der Arbeitsmarktintegration Zugewanderter beschäftigen. Politische Akteure erlassen Gesetze und Förderprogramme um den Einstieg Zugewanderter in Ausbildung und Arbeit zu erleichtern. Öffentliche Verwaltungsstrukturen und Projektträger suchen nach Lösungen, um diese Maßnahmen bestmöglich in die Tat umzusetzen. Wissenschaftler beschäftigen sich mit Arbeitsmarktintegration nicht nur quantitativ durch Umfragen und Datenanalysen, sondern auch qualitativ und kritisch.
Jede dieser Communities beschäftigt sich mit dem Problem der Arbeitsmarktintegration in ihrem eigenen Umfeld. Berührungspunkte existieren nur punktuell und selten bietet sich die Möglichkeit, über Maßnahmen, Erfolge und Herausforderungen zu reflektieren. Wenn bei Praktikern überhaupt Kontakt zu Wissenschaftlern besteht, dann meist beim Hören eines Vortrages zu statistischen Auswertungen von Daten der Agentur für Arbeit. Schnittstellen zur qualitativen Migrationsforschung, oder gar zu kritischen Ansätzen existieren kaum. Ziel der Konferenz ist es, die Communities zusammenzubringen und ihnen ein Austauschforum zu bieten.
-
08.10.2021
Die Fortbildungen/Themen:
- (Unbegleitete) minderjährige Geflüchtete: Asyl- und aufenthaltsrechtliche Besonderheiten | Aufnahme und Versorgung (06.10.21)
- Die Dublin-III-VO und der Ablauf des Dublin-Verfahrens: Besonderheiten bei positiven und negativen Asylverfahren in anderen ‚Dublin-Ländern‘ – Grundlagen| Länderspezifika | Familienzusammenführung (07.10.21)
- Anerkannt oder abgelehnt – und nun? Aufenthaltstitel und Aufenthaltsverfestigung nach positiven Asylverfahren, die verschiedenen Ablehnungsgründe und alternative Bleibeperspektiven (08.10.21)
Anmeldung:
Anmeldung bis zum 24.09.2021. Es ist möglich, an allen drei oder einzelnen Fortbildungen teilzunehmen.
September 2021
In dem Workshop soll sich mit den (fehlenden) Kenntnissen zur Entwicklung des Rechtsextremismus in Deutschland auseinandergesetzt und über die Rolle diskutiert werden, welche die Soziologie dabei einnehmen könnte. Damit stehen die Gefährdungen der Gesellschaft ebenso im Fokus der Veranstaltung wie die Herausforderungen, die sich daraus für das Fach ergeben. Denn obwohl Rechtsextremismus die Frage nach sozialer Ordnung und gesellschaftlichen Verträgen akut aufwirft, spiegelt die Soziologie den gesellschaftlichen Umgang mit ihm bislang eher wieder als seine gesellschaftliche Hervorbringung und (fehlende) Aufarbeitung zu reflektieren. Dies macht sich v. a. auf den Ebenen der soziologischen Be-griffskonzeptionen und Theorien, der methodologischen Reflexionen und des tatsächlichen Wissens (etwa zum Rechtsterrorismus), der curricularen, akademischen und beruflichen Infrastruktur sowie schließlich beim Verhältnis bemerkbar, das die Soziologie zum NS(U) (nicht) einnimmt.
Mit diesen Strängen soll sich im Rahmen des Arbeitskreises "Sociology of the far right" befasst werden, zu dessen Gründung der Workshop beitragen soll. Die Veranstaltung stellt somit einen ersten Schritt der Öffnung des beim 40. DGS-Kongress 2020 über eine Ad hoc-Gruppe gestarteten AKs für und in eine größere Fachöffentlichkeit dar. Sie steht interessierten Kolleg*innen (nicht ausschließlich!) der Soziologie nach Anmeldung offen und soll vor allem eine weitere konzeptionelle, methodologische, theoretische sowie strukturelle Bestandsaufnahme ermöglichen.
-
29.09.2021
Das zweitägige Veranstaltungsformat gibt Einblick in das vielfältige Arbeitsfeld der Radikalisierungsprävention und vermittelt Grundlagen zur Präventionsarbeit. Gemeinsam mit den Teilnehmenden werden außerdem Methoden und Übungen für den Einsatz im vhs-Kurskontext erarbeitet und getestet. Die Teilnahme ist kostenfrei.
Zielgruppe der Veranstaltung sind vhs-Mitarbeiter*innen, Respekt Coaches und Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe.
Welchen Einfluss haben Medienberichterstattung und Soziale Medien auf ein gutes und sicheres Zusammenleben in der Stadt und in Quartieren der Vielfalt? Wie könnte eine gute Medienkommunikation aussehen und wie können städtische Akteure ihre Kommunikation in und mit ethnisch pluralen Gemeinschaften verbessern? Das durch das BMBF geförderte Forschungsprojekt Migration und Sicherheit in der Stadt (migsst) beschäftigt sich in zwei Teilprojekten mit Fragen von Kommunikation und Mediennutzung in Stadtvierteln, in denen viele Menschen mit Migrationserfahrung leben. Im Vordergrund steht die Rolle von Medien für eine gelingende Kommunikation über die Stadtviertel und innerhalb der Quartiere, wenn es z. B. um Behördenkommunikation geht oder die Partizipation der Bewohnerinnen und Bewohner an den Belangen ihres Viertels. In diesem Zusammenhang ist die These leitend, dass Medien und Kommunikation eine integrierende Wirkung entfalten können und für Sicherheit und Sicherheitswahrnehmung im Quartier eine zentrale Rolle spielen.
In diesem zweiten Prävinar der zweiteiligen Reihe werden die Ergebnisse dieser Teilprojekte zur Kommunikation und Mediennutzung vorgestellt.
Zur Projektwebsite:
Referierende:
- PD Dr. Jessica Heesen (Eberhard Karls Universität Tübingen, Internationales Zentrum für Ethik in den Wissenschaften)
- Prof. Dr. Stefan Jarolimek (Deutsche Hochschule der Polizei, Fachgebiet Kommunikationswissenschaft)
In diesem Tagesworkshop vermitteln wir Ihnen, wie Sie Fake News erkennen und Informationen auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen. Sie lernen, Verschwörungstheorien aufzudecken bzw. zu entlarven und erfahren, warum Verschwörungstheoretiker so oft mit dem Finger auf Jüdinnen und Juden zeigen.
Die Vermittlung von Medienkompetenz als auch die Sensibilisierung für Fake News, Antisemitismus und Verschwörungstheorien sind wesentliche Ziele dieses interaktiven und methodenreichen Online-Workshops.
Das Seminar richtet sich sowohl an Jugendliche als auch an ehren- und hauptamtliche Fachkräfte.
High Impact Crime (HIC) such as violent assault, robbery and burglary impact negatively on citizens and their communities. As part of the EU funded Cutting Crime Impact project (www.cuttingcrimeimpact.eu) a comprehensive, problem-oriented approach to HIC has been developed in the Netherlands by the national police, ministry, municipalities and a private research and consultancy bureau. This approach is called ProHIC. It provides methods and solutions to address HIC through a detailed manual, support materials and evidence-based ‘pearls of knowledge’ all available on www.ProHIC.nl.
The approach outlines a practical process for police, local authorities, residents and entrepreneurs to tackle High Impact Crime together. It starts with a thorough analysis of the problem by all stakeholders to determine precisely what the problem is, before deciding on the appropriate intervention. Defining and analysing the problem is key to the efficacy of a collaborative solution. ProHIC guides the stakeholders through the collaborative process from problem identification (scanning and analysis) to developing an action plan and evaluating it. It supports the police, relevant local and national authorities, residents and businesses to reduce and, where possible, prevent these crimes from happening.
Speakers:
Armando Jongejan MSc studied at the University of Amsterdam. Armando Jongejan started working at the National Police of the Netherlands as a project, process, information and innovation manager. Today he is head of a Business Intelligence Division. Since 1995 he is involved with Crime Prevention Through Environmental Design. He has presented at numerous European and USA CPTED seminars and conferences and has written several international articles about the Dutch Police Label Secure Housing.
Paul van Soomeren is founder of the Amsterdam based research and consultancy bureau DSP (www.DSP-groep.eu). Paul van Soomeren worked at the national Bureau of Crime Prevention in the Netherlands for several years and is considered an international expert in Crime Prevention, specifically in Crime Prevention through Environmental Design (CPTED). At the moment Paul van Soomeren works on standardisation of CPTED and participates in the projects like Secu4All, the European Urban Agenda and Cutting Crime Impact.
Veranstaltung der Dezentrale Beratungs- und Unterstützungsstruktur für Gewaltschutz in Flüchtlingsunterkünften (DeBUG).
Das Misstrauen gegenüber Medienschaffenden ist ein bereits seit längerem auftretendes Phänomen in Teilen der Gesellschaft: Das Skandieren von „Lügenpresse“ auf Demonstrationen oder die Nutzung von „Alternativen Medien“ sind nur zwei Aspekte davon. In der letzten Zeit kommt eine enorm feindselige Stimmung gegenüber der Presse hinzu: Neben einer Vielzahl von verbalen Attacken und direkten Anfeindungen gibt es auch eine enorme Zunahme von tätlichen Angriffen. Die Bedrohungslage für Journalist:innen ist hoch. Die Nichtregierungsorganisation „Reporter ohne Grenzen“ bezeichnet die Lage der Pressefreiheit in Deutschland in ihrem aktuellen Bericht nur noch als „zufriedenstellend“, registriert sie doch fünfmal so viel Übergriffe wie im Vorjahr.
Handelt es sich um ein vorübergehendes Phänomen oder ist die Aggression Ausdruck eines längeren Angriffs auf den medialen Kern der Demokratie? Sollten Journalist:innen Position beziehen? Welche Rolle spielen sogenannte „alternative Nachrichtenmedien“?
Diese und weitere Fragen diskutieren wir mit:
- Yann Paul Mattis Rees (Universität Bielefeld, FGZ-Teilinstitut Bielefeld)
- Amelie Heldt (Hans-Bredow-Institut, FGZ-Teilinstitut Hamburg)
- Sebastian Haak (freier Journalist Thüringen)
Moderiert wird die Veranstaltung von Anne Tahirovic (IDZ Jena).
Das Netzwerk gegen Gewalt veranstaltet am 16.09.2021 in Kassel eine Fachtagung zum Thema “Erfolgreiche Ansätze zur Prävention interkultureller Konflikte unter besonderer Berücksichtigung der Herausforderungen für Kinder und Jugendliche nach Fluchterfahrungen“. Die Veranstaltung richtet sich an Schule, Polizei, Justiz, Sozialarbeit und Kommunen sowie weitere Interessierte.
Zwei Vorträge führen in die Thematik des Fachtags ein und erläutern erprobte Möglichkeiten der Konfliktbewältigung. Am Nachmittag haben die Teilnehmenden die Gelegenheit, jeweils zwei von fünf der angebotenen Workshops zu besuchen.
Die Teilnahme ist kostenfrei.
Weitere Informationen und Anmeldung (bis Mittwoch, 8. September 2021)
Der Abbau von Rassismus und Diskriminierung ist in Schulen und Kitaeinrichtungen Lehr- und Lernziel. Was im Denken und Handeln offensichtlich ist, wird in der
Sprache übersehen. Doch mit der Sprache wird die Wirklichkeit durch gedankliche Deutungsrahmen (Frames) interpretiert.
In einem Methodenmix lernen Sie u. a.:
- Frames und Wahrnehmung verstehen
- Zusammenhang von Sprache, Rassismus, Macht
- Strategien der Dethematisierung und Abwehr
- Best Practices für die Berufspraxis
Angesprochen sind Fachkräfte in pädagogischen und sozialen Einrichtungen.
Der Fachtag „Gewaltschutz in Flüchtlingsunterkünften in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen“ hat zum Ziel, diesen fachlichen Austausch zu befördern und legt den Fokus auf den Transfer gewonnener Erfahrungen und Erkenntnisse. Im Zentrum stehen Fragen, die sich unter dem Gesichtspunkt des Gewaltschutzes im Unterbringungskontext immer wieder als besonders virulent erwiesen haben.
In deutschen Großstädten sind sozial und ethnisch vielfältige Quartiere verbreitet. Einige Menschen bereichert die Diversität und sind über die Abwechslung erfreut, andere Menschen fühlen sich überfordert und verunsichert von den unterschiedlichen Lebensstilen und Kulturen. Im BMBF-Verbundprojekt untersuchten die Forschenden das Leben in vier Partnerstädten in jeweils zwei ethnisch vielfältigen Quartieren. Aufschluss darüber gaben Interviews mit Expert:innen und der Bewohnerschaft, deren Perspektive besonderes Gewicht zukam: Wie nehmen sie die Sicherheit in ihrer Nachbarschaft wahr? Wie ist es um die Integration bestellt? Gibt es Segregation? Und lassen sich diesbezüglich Wirkungen auf das Konfliktpotenzial in der Bewohnerschaft, aber auch auf das Aufkommen von Ordnungsstörungen und Kriminalität feststellen? Daneben fragen wir nach den Steuerungs- und Handlungsmöglichkeiten der Administrationen: Es gibt nicht Vielfalt oder Homogenität, sondern mehr oder weniger Vielfalt. Gibt es rechtliche Möglichkeiten, Entstehung und Ausmaß ethnischer Vielfalt im Quartier zu steuern? Oder gibt es Möglichkeiten, als negativ empfundene Wirkungen derartiger Vielfalt zu gestalten? Das Recht gibt hier nur wenige Handlungsmöglichkeiten: Die Gesetze als Kooperationsordnung zwischen Akteuren sowie zwischen Akteuren und Beteiligten sowie betroffenen Menschen sind bislang unterentwickelt. Im Prävinar präsentieren wir nach der Vorstellung unseres Verbundprojekts Erkenntnisse aus dem Forschungsprojekt der Universität Tübingen über Konflikte in der Nachbarschaft, die oft mit Vorstellungen von ethnischen und kulturellen Merkmalen verbunden sind, sowie aus dem Forschungsprojekt der Uni Bielefeld zu Rechtsfragen der Entstehung und Bewältigung von Segregationsfolgen.
Referierende:
- Prof. Dr. Rita Haverkamp (Eberhard Karls Universität Tübingen, Stiftungsprofessur für Kriminalprävention und Risikomanagement)
- Prof. Dr. Christoph Gusy (Universität Bielefeld, Fakultät für Rechtswissenschaft)
-
12.09.2021
-
31.12.2021
Gesellschaftliche Vielfalt ist heutzutage Normalität und prägt alle Bereiche unseres Zusammenlebens. Vielfalt bedeutet, dass Menschen unterschiedlicher Sprachen, Geschlechter, Hintergründe und sexueller Lebens- und Liebesformen in einer Gesellschaft zusammenleben.
Dieser Vielfalt in den verschiedenen Arbeitskontexten mit Jugendlichen gerecht zu werden, ist nicht immer einfach. Häufig begegnen uns im Alltag verschiedene Formen von Diskriminierung wie z.B. Rassismus oder Sexismus. Viele Institutionen sind zudem noch nicht auf die gesellschaftliche Vielfalt eingestellt und verhindern dadurch, dass sich Menschen aktiv am gesellschaftlichen Leben beteiligen können. Auch in schulischen Kontexten finden sich kaum Bildungsangebote zu den Themen Diskriminierung und Diversität, wodurch junge Menschen wenig darüber lernen, wie man sich aktiv gegen Diskriminierung einsetzen kann.
Du bist im engeren oder weiteren Sinne in der Jugendarbeit tätig und hast Lust, Dich zur Trainer*in der politischen Bildungsarbeit weiterzubilden? Dann bewirb Dich für die Multiplikator*innen-Schulung „Vielfalt gemeinsam gestalten“.
-
16.12.2021
-
11.09.2021
Gemeinsam laden wir unsere Widerstände hoch und arbeiten an neuen Systemeinstellungen, klar ist, so wie es ist, kann es nicht bleiben. <edit...>
Auf dem ndo Bundeskongress 2021 debattieren Vorreiter*innen und Verfechter*innen einer offenen Gesellschaft den Weg in eine rassismuskritische und gerechtere Zukunft.
Die Veranstaltung ist zum Teil als Livestream öffentlich und in begrenzter Anzahl über Zoom zugänglich.
Zur Anmeldung:
Zum Programm:
Der Begriff „Rechtspopulismus“ ist seit Jahren auch in Deutschland allgegenwärtig, wenn es um die Politik radikal und extrem rechter Parteien und Bewegungen geht. Mit der AfD ist eine Akteurin angetreten, die sich mehr und mehr als Feindin der offenen, pluralistischen Gesellschaft offenbart – und besorgniserregende Wahlerfolge verbucht hat. Im Hinblick auf die anstehende Bundestagswahl stellt sich die Frage: Was heißt das für die nächsten fünf Jahre? Mit unseren Gästinnen diskutieren wir darüber, was Rechtspopulismus ist, welche Strategien und Ziele verfolgt werden, wieso Teile der Bevölkerung dafür empfänglich sind und was Demokrat:innen dagegen tun können.
Wir begrüßen auf dem Podium:
- Anne Küppers (FSU Jena)
- Anna-Sophie Heinze (Uni Trier)
- Julia Schuler (FGZ Leipzig)
Die Fortbildung beschäftigt sich mit den rechtlichen Grundlagen des Ausländerstrafrechtes und Abschiebehaftrechtes. Strafrechtliche Verurteilungen können oft auch weitreichende aufenthaltsrechtliche Folgewirkungen haben, deren Kenntnis für die Beratungspraxis wichtig ist. Gerade im Bereich der Abschiebungshaft ist oft nur wenig Zeit, um noch Rechtsmittel geltend zu machen. Deswegen kann eine konstruktive Zusammenarbeit zwischen Rechtsanwält:innen und Unterstützer:innen besonders wichtig sein, um die Rechte der Betroffenen zu wahren.
Zu den Schwerpunkten der Fortbildung zählen:
- Überblick über die Straftatbestände im Ausländerrecht, insbesondere Strafbefehl wegen illegaler Einreise/ illegalem Aufenthalt
- aufenthaltsrechtliche Folgewirkungen incl. Ausweisungsinteressen
- Überblick über die verschiedenen Haftarten (Abschiebehaft, Ausreisegewahrsam, etc.) im Ausländerrecht und deren Rechtsgrundlagen
- Rechte und Pflichten der Betroffenen, Rechtsmittelmöglichkeiten sowie Frage nach der Erforderlichkeit anwaltlicher Vertretung incl. Kosten
- Chancen der Zusammenarbeit von Unterstützer:innen und Rechtsanwält:innen zur Wahrung der Rechte der Betroffenen
Der Fachtag findet im Rahmen unseres Förderprojekts “Flucht-Trauma-Sucht” in Kooperation mit der Niedersächsischen Landesstelle für Suchtfragen (NLS) statt und richtet sich an Akteure der Suchthilfe, Flüchtlingshilfe sowie den psychosozialen, psychotherapeutischen und psychiatrischen Versorgungsstrukturen.
Die folgenden Referent*innen werden aus ihren Projekten berichten und ihre Konzepte mit Anwendungsbezug für die Sucht- und Geflüchtetenhilfe vorstellen:
- “Trauma und Sucht – Konzepte/ Diagnostik/ Behandlung” – Prof. Dr. Ingo Schäfer, Leiter des Koordinierenden Zentrums für traumatisierte Geflüchtete (centra), Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE)
- “Suchtprävention für und mit Menschen mit Fluchterfahrung” – Markus Wirtz, Projektleitung, Landesverband Westfalen-Lippe, Koordinationsstelle Sucht
Zudem wird es die Möglichkeit zu Austausch und Diskussion mit den Referent*innen geben. Sollte es coronabedingt nicht möglich sein, den Fachtag in Präsenz abzuhalten, wird die Veranstaltung online stattfinden.
As part of the EU-funded Cutting Crime Impact (CCI) project, the State Office of Criminal Investigation (LKA) in Lower Saxony, Germany, investigated the implementation and front-line use of Predictive Policing with the aim to identify issues and address shortcomings. Researchers conducted observation and interview research into the use of the LKA's PreMAP predictive system by police officers. Findings revealed that predictive data was not being used as it was not provided in a way that met the needs of officers. In addition, research found that PreMAP data was just one of many types of information that needed to be provided more systematically to officers in daily patrol briefings and shared between shifts. Observational research highlighted the fact that shortcomings in the implementation of PreMAP were not simply due to the technology, but to relevant information not being communicated in a way that supported officers in their patrolling duties.
From these insights, the LKA researchers designed and developed their PATROL Tool. This Tool is tailored to the local policing context, and includes various elements that support comprehensive information processing and more effective internal communication, enabling an intelligence-enhanced approach to patrolling.
Maurice Illi will present the PATROL tool, discussing the research that led to its development, how it works and how it supports police officers to more effectively receive, share and use information.
Dr Chiara Ryffel will present on the critical importance of information in decision-making and taking effective action. She will discuss how poor communication and a lack of information in High Reliability Organisations (HRO) can result in inadequate actions that in turn lead to critical incidents. The more precise and comprehensive information is, the better a situation can be assessed and appropriate action identified and taken. This is especially important in emergency situations where decisions and actions must be taken speedily. By focusing on providing employees with the information, resources and equipment they need, organisations can better create and enhance safety.
-
03.09.2021
"Rechtsextremismus lebt von Allianzen zwischen seinen Akteur*innen und sucht gezielt Anknüpfungspunkte in der Mitte der Gesellschaft. Die Querdenken-Bewegung zeigt erschreckende Bezüge zwischen ökologisch orientierten Kreisen und völkischen Siedler*innen, neue Allianzen zwischen Impfskeptiker*innen und Wissenschaftsleugner*innen verfestigen sich und oft fällt die Abgrenzung gegenüber demokratiefeindlichen Bewegungen aus. Als plurale und bunte Zivilgesellschaft brauchen auch wir starke und demokratische Allianzen: daher laden wir als Kompetenznetzwerk Rechtsextremismusprävention, kurz KompRex, für Anfang September nach Berlin zu unserer ersten Fachtagung ein, um uns mit allen Interessierten über die neuesten Entwicklungen im Rechtsextremismus auszutauschen sowie Ideen und Visionen für starke Allianzen in der Rechtsextremismusprävention zu schmieden.
Im Mittelpunkt stehen kluge Ideen und spannende Menschen: Vertreter*innen aus Kultur, Politik, Kirche, Gewerkschaften, Wissenschaft und natürlich der Rechtsextremismusprävention. Mit dabei sind Prof. Dr. Esther Lehnert, Gilda Sahebi, Franziska Schröter, Tijan Sila, Natascha Strobl und viele mehr."
August 2021
-
28.08.2021
In diesem Workshop steht deswegen die kritische Reflexion der eigenen Praxis und des eigenen Wissens im Vordergrund. Zu diesem Zweck stellen die Wissenschaftler Sindyan Qasem und Philippe A. Marquardt ihre kritischen Analysen zur gemeinsamen Diskussion. In angeleiteten interaktiven Arbeitsphasen werden die Kritikpunkte von allen Teilnehmenden sodann in die jeweils eigenen konkreten Praxiskontexte übertragen.
Für Jugendliche mit Fluchterfahrung sind Zugehörigkeit und Partizipation besonders bedeutend für die weitere Entwicklung. Geprägt von Erlebnissen im Herkunftsland und fehlenden familiären Strukturen nimmt die Arbeit von Ehrenamtlichen als Vertrauenspersonen einen grundlegenden Stellenwert ein.
Welche Unterstützungsangebote haben Sie für Jugendliche als besonders hilfreich erlebt? Wie sieht die Lebenssituation Jugendlicher in Gemeinschaftsunterkünften aus? Wie können die Eingliederung in die Schule und ein erfolgreicher Schulverlauf gelingen? Was bleibt in Ihrer Arbeit herausfordernd? Wie kann eine Vermittlung in Freizeitangebote erfolgen und welche Hürden haben Sie dabei erfahren?
Wie kann ich mit Jugendlichen oder jungen Erwachsenen Lern- und Reflexionsprozesse über den »Nahen Osten« in Gang setzen und dabei der Komplexität des Themas gerecht werden? Wie kann eine Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und mit der europäischen (Nahost-)Politik verbunden werden?
Das Lernmaterial »Fluchtpunkte. Bewegte Lebensgeschichten zwischen Europa und Nahost« zeigt anhand von sieben Lebensgeschichten Verflechtungen der deutschen und österreichischen Geschichte mit jener des arabisch-jüdischen "Nahen Ostens" auf. Der biografische Ansatz erleichtert Jugendlichen die Annäherung an die vielfältigen geschichtlichen Zusammenhänge und ermöglicht Diskussionen über geschichtliche und politische Prozesse sowie über Identitätsbilder und Geschichtserzählungen.
Die Fortbildung richtet sich an Lehrkräfte und Multiplikator*innen, die innerhalb oder außerhalb der Schule mit Jugendlichen oder jungen Erwachsenen ab 14 Jahren zu den Themen des Lernmaterials arbeiten wollen.
-
08.10.2021
Der Kurs vermittelt ein Handlungskonzept zum Umgang mit Phänomenen der Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit (GMF) und des Rechtsextremismus in der Jugendarbeit sowie zur Gestaltung partizipativer und diversitätsbewusster Jugendräume. Das Handlungskonzept wurde im Rahmen eines Modellprojekts gemeinsam mit Praxispartner*innen und Wissenschaftler*innen entwickelt und erprobt. Anhand eines 5-stufigen Interventionsplans und praktischer Beispiele der Teilnehmenden können situationsgerechte Strategien entwickelt werden, um präventiv, aber auch durch konkrete Interventionen abwertenden, menschenverachtenden und demokratiefeindlichen Haltungen bzw. rechtsextremen Äußerungen im eigenen Arbeitsfeld zu begegnen.
Die Module finden im 14-tägigen Turnus jeweils donnerstags und freitags online per Zoom statt. Inhalte werden in Inputs, gemeinsamen Diskussionen, Breakout-Sessions (Kleingruppenarbeit) sowie Einzelarbeit (Heimlektüre) vermittelt. Zusätzlich wird es einen online-Kursraum geben, in dem Literatur, Materialien, Arbeitsaufträge und Arbeitsergebnisse bereitgestellt werden. Ein Teilnahmezertifikat wird ausgestellt.
Das Quartier ist für das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen von zentraler Bedeutung. Aber: Wie sicher fühlen sich Kinder und Jugendliche in der Stadt eigentlich? Und wo? Und wieso gibt es kein Methodenset, um das Sicherheitsempfinden von Kindern und Jugendlichen – jenseits des Bauchgefühls der Fachexperten – tatsächlich adäquat zu erfassen?
Dieses Methodenset steht Ihnen ab sofort zur Verfügung: Zehn Instrumente wurden gezielt entwickelt und erprobt, um damit das Sicherheitsgefühl von Kindern und Jugendlichen im öffentlichen Raum zu erfassen. Seien Sie bei der Vorstellung des Handbuchs dabei!
Auf dieser Veranstaltung, beleuchten und diskutieren wir mit Ihnen:
- Was wissen wir über das Sicherheitsempfinden von Kindern und Jugendlichen im öffentlichen Raum? – Ein Forschungsfeld mit Wissenslücken.
- Welche Rolle spielt der öffentliche Raum für Kinder & Jugendliche? – Zwischen Nutzung, Aneignung, Verdrängung & Sicherheit im öffentlichen Raum.
- Wie kann das Sicherheitsempfinden von Kindern und Jugendlichen im öffentlichen Raum erfasst werden? – Methoden zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen zu Aspekten der urbanen Sicherheit.
- Wie kommen wir weiter auf einem Weg zu sicheren Städten für Kinder und Jugendliche? – Eine interdisziplinäre Diskussion.
Zur Anmeldung:
Zur Projektwebsite: www.inersiki.de
Der Umgang mit dem Verdacht auf eine Kindeswohlgefährdung stellt eine herausfordernde Situation für Mitarbeiter*innen in Unterkünften für Geflüchtete dar.
Dieses Online-Seminar soll Mitarbeiter*innen in ihrer Handlungssicherheit im Umgang mit diesem Thema stärken.
Zum einen geht es um das Erkennen von Gefährdungsmomenten für eine Kindeswohlgefährdung, zum anderen geht es um das Handeln auf der Grundlage der geltenden rechtlichen Grundlagen, wie zum Beispiel dem Bundeskinderschutzgesetz.
Kinderschutz im Kontext von Flucht und Migration erfordert zudem ein migrations- und kultursensibles Arbeiten mit den Familien.
Thematisiert werden auch die Kooperation mit den Eltern und ihren Kindern sowie die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt.
Eigene Fallbeispiele und Fragen können im Vorfeld gerne formuliert und anonymisiert per Mail eingesendet werden. Auch während des Seminars können über die Chatfunktion Fragen gestellt werden.
-
30.11.2021
Juli 2021
"Wir als BPOC (Black and People of Color) und Migrant*innen erleben täglich Rassismus auf der Straße, in der Schule, dem Arbeits- oder Ausbildungsplatz, bei der Wohnungssuche und bei Behörden. Die Frage für uns ist, wie wir uns als COMMUNITY selbstorganisieren, empowern und für uns Räume schaffen, in denen wir ohne Angst über unsere Situation sprechen können. Dafür laden wir euch am 31.07.2021 ab 11 Uhr zum Workshop mit Jugendliche ohne Grenzen (JoG) ein.
An dem Tag werden wir uns mit den Fragen beschäftigen:
- Was genau bedeutet eigentlich Rassismus?
- Was heißt es, Rassismus zu erleben?
- Wo kann ich Unterstütung bekommen und dagegen Stand halten?"
Menschen auf der Flucht sind besonders gefährdet, ausgebeutet zu werden. Betroffenen von Menschenhandel stehen in Deutschland besondere Schutzrechte zu, Menschenhandel kann auch im Asylverfahren eine Rolle spielen, unter anderem kann Menschenhandel ein Asylgrund sein. Doch nur, wenn sie auch als Betroffene von Menschenhandel erkannt werden, können sie Unterstützung erhalten und ihre Rechte wahrnehmen.
Mitarbeitende in Unterkünften und Beratungsstellen stehen vor der Herausforderung der Identifizierung und Unterstützung Betroffener.
Es konnte eine Referentin des KOK – Bundesweiter Koordinierungskreis gegen Menschenhandel e.V. und eine Referentin von Nadeschda, einer Mitgliedsorganisation des KOK gewonnen werden, die über die zugrundeliegenden Gesetze, Schutzrechte und Schutzformen informieren. Sie erläutern, welche Indikatoren auf das Vorliegen von Menschenhandel hindeuten und gehen auf die besondere Situation von Betroffenen ein. Sie berichten aus der Beratungspraxis und gehen anhand von Fallbeispielen auf Handlungsmöglichkeiten und das Unterstützungssystem bei Verdacht auf Menschenhandel ein.
Das Projekt Flucht & Menschenhandel – Prävention, Sensibilisierung und Schutz des KOK wird über die Diakonie Deutschland e.V. von der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration finanziert.
Die Fortbildung richtet sich vorrangig an Mitarbeiter*innen in kommunalen Gemeinschaftsunterkünften und Erstaufnahmeeinrichtungen sowie in kommunalen und Landesbehörden, wie auch an Mitarbeitende der Fachberatungsstellen.
Jan Üblacker will open the webinar with an urban sociological perspective: “Starting from a vacuum created by restructuring police authorities and their areas of responsibility, many major German cities established or expanded municipal public order services, which resemble the appearance of state police forces, but have different tasks, competences, and resources. As their practical orientation is influenced much more by local politics, public opinion and spatial distribution of disorder, questions arise on how these city-specific cultures of control are related to neighbourhood change.”
Afterwards Melanie Schlüter and Dr Anke Schröder will present INSIGHT, a tool which delves into subjective safety and security. Factors like public opinion or the spatial distribution of disorder in a neighborhood affect the perception of safety of citizens and create complex challenges for state and municipal actors. Subjective security in urban spaces requires knowledge about the emergence and effects of fear of crime and about the design and use of public space. Results are prepared for implementation in such a way that these can be used by crime prevention practitioners. Within the context of the international EU project Cutting Crime Impact (CCI), the INSIGHT tool was developed to enable these actors to measure and - if possible - mitigate citizens' feelings of insecurity and fear of crime. Following the human-centered design approach, the tool is intended to provide a holistic, spatial and systematic process for measuring perceptions of (in)security and focuses on the perspective and demands of the users.
Speakers:
- Melanie Schlüter is a sociologist and educational scientist. She currently works as a research associate at the Criminological Research (KFS) of the State Office for Criminal Investigation of Lower Saxony in the Cutting Crime Impact project. Here she works on measuring and mitigating citizens' feelings of insecurity and fear of crime. Her original background is in radicalisation and extremism research. Until mid-2020, she worked at the Institute for Interdisciplinary Research on Conflict and Violence at Bielefeld University on several projects on the topics of radicalisation and extremism, as well as on youth and socialisation.
- As an architectural sociologist Dr Anke Schröder is responsible for the Centre of Competence of Urban Security in the Criminological Research at the State Office for Criminal Investigation of Lower Saxony. She is involved in several international and national research projects in the field of crime prevention in urban design and planning. Her interest is to bring research approaches into daily practice of police and planning and abroad.
- Dr Jan Üblacker is Professor for Housing and Neighbourhood Development at the EBZ Business School, University of Applied Science in Bochum/Germany. His research focuses on urban sociology, social inequality, housing and gentrification.
[Fünftes Prävinar aus der englischsprachigen Reihe mit dem Projekt „Cutting Crime Impact“]
In der Nachbarschaft, in der Stadt, in der Gemeinde, in Institutionen.
- Räume für die wir als Fachkräfte und Bürger*innen Verantwortung übernehmen.
- Räume, in denen gleichberechtigte Teilhabe nicht länger durch Barrieren behindert wird.
- Räume, die wir immer wieder spielerisch, kreativ und humorvoll, mit Gelassenheit und mit Herz, ohne Perfektionismus gestalten.
-
16.07.2021
Rechtsextremismus und Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit sind eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, die sich nicht nur am Rand der Gesellschaft oder bei Jugendlichen verorten lässt. Deshalb wollen wir auf dieser Summer School die Lebensphasen Kindheit, Jugend und Erwachsenenalter hinsichtlich rechtsextremer Phänomene und Ausprägungen beleuchten sowie Handlungsansätze aus der jeweiligen Praxis vorstellen. Mit dieser erweiterten Perspektive möchten wir den fachlichen Austausch unter den Teilnehmenden anregen und Impulse für Ihre Arbeit geben.
Alle vier Veranstaltungstage haben einen thematischen Schwerpunkt, der vormittags durch einen Vortrag oder eine Panel-Diskussion eingeführt wird. Daran schließen sich am Nachmittag parallel stattfindende Online-Workshops zur Vertiefung des Tagesthemas an. Den Abschluss bildet das gemeinsame Outro, in dem die Ergebnisse aus den verschiedenen Workshops vorgestellt und diskutiert werden.
Die Summer School richtet sich an pädagogische Fachkräfte und Multiplikator*innen aus der Jugend(sozial)arbeit sowie der politischen Bildungsarbeit, die in der Prävention von Rechtsextremismus bzw. der Bearbeitung von Phänomenen Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit tätig sind. Neben dem Wissenstransfer liegt ein weiterer Fokus auf dem gegenseitigen Kennenlernen der Teilnehmenden, dem Austausch und der Vernetzung.
Juni 2021
"Resettlement als internationales Instrument trägt zur Lösung langanhaltender Fluchtsituationen bei. Es sollen Menschen dadurch Schutz finden, die weder in ihre Heimat zurück können noch in dem Land bleiben können, in das sie geflohen sind, weil dort ihr Leben, ihre Freiheit, ihre Sicherheit, Gesundheit gefährdet sind oder andere fundamentale Rechte nicht gewährt werden. Resettlement zielt auf eine dauerhafte „Neuansiedlung“ in einem sicheren Land.
Seit 10 Jahren beteiligt sich die Bundesrepublik Deutschland am weltweiten Resettlement für besonders schutzbedürftige Flüchtlinge in Zusammenarbeit mit dem UNHCR. Seit zwei Jahren gibt es das Pilotprogramm „NesT.Neustart im Team“ als zusätzliches staatlich-gesellschaftliches Aufnahmeprogramm. Nach coronabedingter Einschränkung und zeitweiser Aussetzung sollen im Sommer 2021 die Einreisen von besonders schutzbedürftigen Flüchtlingen wieder intensiviert werden.
Rebecca Einhoff vom UNHCR Deutschland, Berlin, wird über die globale Situation der Flüchtlinge, über Grundfragen des Resettlements (besonders zum Thema Schutzbedarf) und zu den aktuellen Herausforderungen referieren.
- Ben Mason, Mitarbeiter von Global Refugee Sponsorship Initiative (GRSI) bei der kanadischen Botschaft in Berlin, wird das deutsche „community sponsorship“ Programm NesT.Neustart im Kontext ähnlicher Programme in anderen Ländern betrachten.
- Katharina Nicole Mayr, Zivilgesellschaftliche Kontaktstelle in NesT.Neustart im Team, Freiburg, wird das Programm vorstellen und über den aktuellen Stand informieren
- Die Veranstaltung richtet sich an Menschen, die ehren- und hauptamtlich in der Flüchtlingsarbeit tätig sind, in Behörden, Beratungsstellen, Kommunen, Wohlfahrtsverbänden, Kirchen und Vereinen - oder in der Flüchtlingshilfe tätig werden wollen.
Wie können Veranstaltungen intersektional (also möglichst inklusiv und diskriminierungssensibel) gestaltet werden? Wie spreche ich die Menschen an, die ich erreichen will? Wen denke ich bei meiner Veranstaltungskonzeption bereits mit und wen habe ich noch nicht im Blick?
Die Veranstaltung lenkt den Blick auf die Wahrnehmungslücken, die wir alle besitzen, wenn es darum geht, Veranstaltungen inklusiv und diskriminierungssensibel zu gestalten. In einem ersten Teil geht es um das Konzept der Intersektionalität (die Anerkennung von Mehrfachdiskriminierungen) und um die Frage, was dies für die konkrete Veranstaltungsplanung bedeuten kann. In zweiten Teil des Seminars geht es um den Bezug zur eigenen Praxis und um eine Reflexion der eigenen Tätigkeit.
Low levels of security incidents can coincide with feelings of insecurity. These feelings of insecurity are relevant, as they can impact on everyday life. People that feel unsafe tend to isolate, to avoid common spaces and become consequently more unsafe. Authorities should tackle outbreaks that lead to feelings of insecurity regardless of the level of the incident. Low levels of subjective security constitute a public problem because it can cause cities to decline. It is important to understand the grounds that make people feel unsafe and how different societal groups are affected by it. Otherwise, authorities won’t be able to employ adequate measures.
In this webinar we will introduce two instruments devised to check the perceptions of insecurity in different areas/groups: We will look at the Ministry of Interior of Catalonia, within the framework of the Cutting Crime Impact (CCI) Project, who have created the toolkit “Perception matters”. It is a practical guide to orientate practitioners, firstly in the detection of the grounds of insecurity outbreaks and, secondly, to provide adequate responses that can tackle problems. It is based on the principle that everything that makes people unsafe should be tackled, regardless of if it is a crime, incivilities or disorders.
Speakers:
- Dr Francesc Guillén is Head of Projects and Organisation at the Catalan Ministry of Interior (as from 2004). He has been Executive Director of CIFAL Barcelona (2007-2009) and member of the Steering Committee of the Platform Police for Urban Development (January—December 2010). Lecturer on Constitutional Law at the Autonomous University of Barcelona and the Open University of Catalonia as from 1989 and 1999. Lecturer on “Police and Security” at the UAB Criminology Studies and the Open University of Catalonia from 2010 to 2019. Honoris Causa Doctor by the Mexican Society of Criminology. He has published numerous articles and books.
- Dr Macarena Rau is President of the International CPTED Association (ICA); Architect, Magister and PHD in Architecture and Urbanism. Has extensive experience leading Urban Security Projects and Initiatives, both public and private, in Chile and in various countries of Latin America and the Caribbean. Specialist in the CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design) methodology with proven success in diagnosis, design, execution and evaluation of Violence and Crime Prevention projects from an Environmental perspective.
[Viertes Prävinar aus der englischsprachigen Reihe mit dem Projekt „Cutting Crime Impact“]
-
09.06.2021
-
08.06.2021
Unter dem Titel „Familie extrem – Zugänge schaffen und Kinder stärken“ wird am 7. und 8. Juni 2021 die Online-Bundesfachtagung zum Umgang mit Eltern und Kindern radikalisierter Familien stattfinden. Der Fokus liegt auf dem Bereich des religiös begründeten Extremismus. Darüber hinaus wird es Einblicke in bereits vorhandene Erfahrungen und Arbeitsansätze aus verwandten Themenfeldern wie dem Rechtsextremismus und sogenannten Sekten geben. Zentral ist der Fachaustausch unterschiedlicher Akteur*innen und Institutionen, um die verschiedenen Perspektiven zusammenzubringen. Ausdrücklich eingeladen werden Fachkräfte aus dem Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, Jugendämter/ASD, Präventions- und Interventionsarbeit, Lehrkräfte und Schulsozialarbeiter*innen, sowie Vertreter*innen der Ministerien und Sicherheitsbehörden.
Die Teilnehmenden haben verschiedene Möglichkeiten, Herausforderungen im Umgang mit Eltern und Kindern aus radikalisierten Kontexten zu besprechen. Sie erhalten Handlungsoptionen zur konkreten Einschätzung von Kindeswohlgefährdung und können weitere Fragen zum Themenfeld klären. In Fachvorträgen, Panels und Workshops können sie unterschiedliche Zugangsmöglichkeiten zu entsprechenden Kindern und Familien sowie Arbeitsansätze mit diesen kennenlernen.
Rassismus und Antisemitismus lassen sich als strukturelles, gesellschaftliches Problem von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit verstehen. Für die betroffenen Personen sind die persönlichen Auswirkungen oft gravierend. Wir alle sind aufgefordert, uns zu solidarisieren und aktiv gegen Anfeindungen zu stellen.
Inhalt des Workshops:
Im Rahmen dieses Workshops werden Muster der „Feindbildkonstruktion“ verständlich erläutert und die Funktions- und Wirkungsweisen von Rassismus und Antisemitismus veranschaulicht.
Der Workshop beginnt mit einer kurzen Einführung in die Themen Rassismus und Antisemitismus. Unterschiede und Gemeinsamkeiten werden aufgezeigt, Beispiele für verwendete Symbolik, Codes oder (unterschwellige) Äußerungen gegeben und typische Muster anhand plastischer Beispiele erklärt.
Im zweiten Teil des Workshops werden Optionen mit den Teilnehmenden erarbeitet, wie jede/r von uns in bestimmten Diskriminierungssituationen im Alltag handeln kann.
Der Workshop wird interaktiv und methodisch aufbereitet, sodass Fragen, Unsicherheiten und eigene Erfahrungen mit eingebracht werden können.
Wie leben Menschen mit HIV heute? In welchen Bereichen erleben sie am meisten Diskriminierung? Spielt Diskriminierung im Gesundheitswesen immer noch eine so große Rolle? Hat „Schutz durch Therapie“ eine Entstigmatisierung von HIV mit sich gebracht? Welchen Einfluss haben andere Diskriminierungsmerkmale bei HIV-positiven Menschen? Welche Maßnahmen sollen ergriffen werden, um ein selbstverständliches Leben mit HIV zu fördern?
Diesen – und anderen – Fragen sind die Deutsche Aidshilfe (DAH) gemeinsam mit dem Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft (IDZ) im partizipativen Forschungsprojekt „positive stimmen 2.0“ nachgegangen. Im Rahmen des weltweiten PLHIV-Stigma-Index-Projekts wurden ca. 500 Menschen mit HIV von Peer-Forscher:innen befragt. Außerdem haben ca. 1.000 Menschen mit HIV an einer online-Umfrage teilgenommen. Ergänzt durch mehrere qualitative Fokusgruppendiskussionen hat das Gesamtprojekt „positive stimmen 2.0“ aktuelle Daten und viele Erkenntnisse zum Thema HIV-bezogene Diskriminierung und Stigmatisierung gewonnen.
Die Ergebnisse möchten wir auf einem Fachtag am 05.06.2021 vorstellen und mit Menschen mit HIV, Vertreter:innen aus Aids- und Drogenhilfe, Wissenschaft, Selbsthilfe, Politik, Verwaltung und Gesellschaft diskutieren und gemeinsam Handlungsempfehlungen erarbeiten, wie HIV-bezogene Diskriminierung abgebaut werden kann.
Praktisch begegnet der Übergang aber Hürden. Viele Schutzberechtigte finden keine Wohnung und bleiben in Gemeinschaftsunterkünften, Pensionen oder anderen Wohnformen. Neben teils angespannten Wohnungsmärkten mit hohem Wettbewerb erschweren fluchtspezifische Faktoren und die soziale Situation der Betroffenen das Anmieten einer eigenen Wohnung.
Auf der Fachtagung sollen Herausforderungen und Lösungen für einen besseren Übergang in Wohnungen aufgezeigt werden. Dabei soll auch auf Erfahrungen zurückgegriffen werden, die verschiedene Kommunen mit lokalen Vernetzungsstrukturen gesammelt haben.
Geflüchtete Menschen sind aufgrund ihrer Fluchtgeschichten und den Herausforderungen in ihrer aktuellen Lebenslage besonders mit der Bewältigung schwieriger Situationen konfrontiert. Diese können Risikofaktoren für die Entstehung von unangemessenen Aggressionen und von Gewalt sein. Neben den Risikofaktoren werden auch bestehende Schutzfaktoren in den Blick genommen.
Inwieweit aggressives Verhalten als unangemessen gesehen wird, hängt zudem von kulturellen Normen sowie der Situationsangemessenheit des Verhaltens ab.
Die Fortbildung richtet sich vorrangig an Mitarbeiter*innen in kommunalen Gemeinschaftsunterkünften und Erstaufnahmeeinrichtungen sowie in kommunalen und Landesbehörden
Es gibt viele Gründe, warum sich Jugendliche und junge Erwachsene von islamistischen Ideologien und Gruppierungen angezogen fühlen. Dabei spielen familiäre und lebensweltliche Erfahrungen genauso eine Rolle wie gesellschaftliche und politische Faktoren. Entsprechend vielfältig sind die Ansätze der Präventionsarbeit, die in den vergangenen Jahren in vielen Projekten entwickelt wurden.
Ein Großteil dieser Erfahrungen geht allerdings auf Projekte in Westdeutschland zurück: sie beziehen sich auf sehr unterschiedliche Bedingungen in städtischen, durch Migrationsgeschichten geprägten Stadtteilen mit einer Vielzahl an sozialen, kulturellen und religiösen Akteuren.
Im Mittelpunkt des Fachtags steht die Frage nach den besonderen Merkmalen der universellen Islamismusprävention in Sachsen-Anhalt und anderen ostdeutschen Bundesländern: Worin unterscheiden sich die lebensweltlichen Erfahrungen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen Ost und West – und wie lassen sich diese Unterschiede in der praktischen Arbeit aufgreifen? Welche Rolle spielen gesellschaftliche Diskurse vor Ort, beispielsweise über „den“ Islam oder Geflüchtete, für die Attraktivität von islamistischen Ideologien? Mit welchen Herausforderungen und Fragestellungen sind Lehrer*innen, Schulsozialarbeiter*innen und Fachkräfte aus anderen Bereichen in ihrem Berufsalltag konfrontiert? Und wie lassen sich Religion und Religiosität in einem gesellschaftlichen Umfeld thematisieren, in dem Religion ansonsten oft kaum eine Rolle spielt? Welche Akteure gibt es, die sich in die Präventionsarbeit einbinden lassen?
Mai 2021
Dastar, Kippa, Kopftuch – rein äußerliche Erkennungsmerkmale lassen uns schnell auf eine bestimmte Religionszugehörigkeit schließen und den Menschen dahinter in einer Schublade verschwinden.
Vielleicht hast auch du bereits die Erfahrung gemacht, dass es zu Irritationen, Missverständnissen oder sogar Konflikten kommen kann, wenn Menschen aufeinander treffen, die in ihren Kommunikations- und Verhaltensweisen, (Glaubens-)Vorstellungen und Werten unterschiedlich sozialisiert sind.
Genau da setzen die Diversity Trainerin Anna Cardinal und die Bildungsreferentin Sina Hätti an. Sie vermitteln dir praxisorientierte Handlungsstrategien zum professionellen und souveränen Umgang mit religiöser Vielfalt im sportlichen Vereinsalltag.
Das erwartet dich:
- Hintergrundwissen zu unterschiedlichen Religionen
- Reflexion eigener Prägung im Umgang mit Religion
- Thematisierung von Ängsten und Bedenken
- Diskussion darüber, welchen Einfluss und welchen Platz Religion im Sportverein haben kann
- Tipps für einen sensiblen Umgang mit Religiosität im Sportverein
- Erarbeiten lösungsorientierter Handlungs- und Kommunikationsstrategien
-
21.05.2021
In den vergangenen Jahren kamen zahlreiche Geflüchtete nach Deutschland — unter ihnen viele Kinder und Jugendliche. Lange Zeit lagen jedoch keine belastbaren Forschungsergebnisse zu ihrer Situation im deutschen Bildungssystem vor.
Die BMBF-geförderte Studie „ReGES — Refugees in the German Educational System“ untersucht, unter welchen Bedingungen die Integration von Geflüchteten in unser Bildungssystem gelingen kann.
Nach fünf Jahren Datenerhebung und sieben Befragungswellen soll nun im Rahmen einer virtuellen Konferenz mit empirischen Beiträgen zur Situation geflüchteter Kinder und Jugendlicher im deutschen Bildungssystemein Resümee gezogen werden.
Während sich in den vergangenen Jahren der Fokus der Unterstützungsarbeit verstärkt auf migrantische Frauen* gerichtet hat, wird in letzter Zeit die Frage präsenter, wie geschlechtersensibel und zugewandt mit migrantischen Männern* gearbeitet werden kann. Wie kann dabei ein offener und nachhaltiger Dialog über Männlichkeits*-Thematiken mit Männern* gestaltet werden? Das Webseminar bietet einen ersten Einblick in das Themenfeld der gendersensiblen Männerarbeit* und legt dabei einen besonderen Fokus auf die Lebenswirklichkeiten migrantischer Männer*.
Die Veranstaltung richtet sich an Interessierte und Einsteiger*innen im Themenfeld. Bitte melden Sie sich nur an, wenn Sie fest vorhaben, an der Veranstaltung teilzunehmen.
Abschlussveranstaltungen des Projekt „Zukunft für Geflüchtete in ländlichen Regionen Deutschlands“
Die starke Zunahme fluchtbedingter Zuwanderung ab 2014 hat auch ländliche Regionen in Deutschland vor Herausforderungen gestellt, die bis dahin eher Großstädte und Ballungsräume betrafen. Von einigen Kommunen und Landkreisen wurde diese fluchtbedingte Zuwanderung nicht nur als kurzfristige humanitäre Aufgabe, sondern auch als Chance im Kontext von Abwanderung, Alterung und Fachkräftemangel begriffen.
Ob, unter welchen Voraussetzungen und wie humanitäres Engagement und ländliche Entwicklung erfolgreich verbunden werden können, hat das Forschungsprojekt „Zukunft für Geflüchtete in ländlichen Regionen Deutschlands“ in den Bundesländern Bayern, Hessen, Niedersachsen und Sachsen in jeweils zwei Landkreisen untersucht.
Jetzt liegen die zentralen Ergebnisse vor, welche in der Veranstaltung vorgestellt werden.
Die interdisziplinäre Fortbildung richtet sich an pädagogische Fachkräfte aus den Bereichen Schule (Schulsozialarbeit, Beratungslehrkräfte, Schulpsychologie, Multiplikator*innen, Schulverwaltung, Schulleitung), Jugendhilfe, Kreis- und Stadtjugendpflege, sowie an Fachkräfte der kommunalen und polizeilichen Prävention (Beauftragte für Kriminalprävention, Beauftragte für Jugendsachsen und Präventionsstelle „Politisch motivierte Kriminalität“) und Fachkräfte der Familien- und Erziehungsberatung aus Niedersachsen.
Termine: Variante a): Eintägige Online-Veranstaltung am Freitag den 18. Juni 2021, von 09.00 – 15.00 Uhr Variante b): Zweitägige Präsenz-Veranstaltung am Freitag und Samstag, den 08. /09. Oktober 2021 in Hannover
Dozenten: Prof. Dr. Andreas Beelmann & Sebastian Lutterbach, Friedrich-Schiller-Universität Jena
Sie wollen die aktuellen Erkenntnisse aus über 1000 nationalen und internationalen Forschungsarbeiten zur Prävention von Radikalisierungsprozessen praxisorientiert und leicht verständlich aufbereitet vermittelt bekommen? Sich in interdisziplinär zusammengesetzten Gruppen über die praktische Umsetzung der daraus abgeleiteten Handlungsempfehlungen zu wirksamen Bildungs- und Präventionsmaßnahmen austauschen? Ihre eigenen Ideen zur Umsetzung in die Praxis wissenschaftlich reflektieren lassen? Dann empfehlen wir Ihnen eine Teilnahme.
Der Entwicklungspsychologe und Präventionsforscher Prof. Dr. Andreas Beelmann von der Friedrich-Schiller-Universität Jena hat mit seinem Team als Kooperationspartner des Landesprogramms für Demokratie und Menschenrechte vier Jahre lang aktuell vorliegende, empirische Erkenntnisse zur Entstehung und Prävention von Radikalisierung und Extremismus ausgewertet. Vorgestellt wird sowohl das auf diesen Erkenntnissen basierende Radikalisierungsmodell als auch die daraus abgeleiteten praxisorientierten Handlungsempfehlungen für eine wirksame Bildungs- und Präventionsarbeit.
Weitere Inhalte der Fortbildung sind: Konzeptionelle Grundlagen der Prävention, Definitionen und Abgrenzungen im Themenfeld, sozial- und entwicklungspsychologische Grundlagen von Radikalisierungsprozessen im Entwicklungsverlauf von Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden.
Verbindliche Anmeldung bis zum 10.06.2021 per Email an: kostlp@mj.niedersachsen.de
One of the main challenges in community policing (CP) relates to the need to build safer neighbourhoods through the establishment of effective and trustful relationships between police and citizens. The model of community policing in Lisbon, applied by the Lisbon Municipal Police (LMP) since 2009, has been built from the involvement of local partners and citizens in safety partnerships and their active participation in the planning process of putting in place CP projects in Lisbon neighbourhoods. This policing model is challenging both to the partnership as well as to police organization since it requires a long term engagement by community as well as the internal support from the police organisation to a model of policing often seen as social work rather than “real” police work.
The webinar will first provide an overview of typical challenges for community policing, framing the model used in Lisbon, in contrast to policing models throughout the Anglophone world, for its specificities in facing those challenges. Then, the webinar will focus on the results of the research carried out by the LMP under the EU-funded Project Cutting Crime Impact (CCI). The findings revealed the need for senior level police engagement in the planning process of CP, and the tool "Lisbon Community Policing - Safer Communities" was developed. This tool contains a set of specific communication and planning instruments designed to support and engage key decisionmakers in CP delivery.
Speakers:
- Simone Tulumello is assistant research professor at the University of Lisbon, Institute of Social Sciences. Simone's research interests span at the border between planning research, human geography and critical urban studies; security, fear and urban violence; housing policy and politics; austerity and neoliberal urban policy; Southern European and Southern US cities. In particular, Simone is interested on how local security policymaking - including approaches to policing - is shaped at the intersection of political traditions, neoliberalisation of policy and multilevel institutional arrangements. His first monograph, Fear, Space and Urban Planning: A Critical Perspective from Southern Europe, was published in 2017 by Springer.
- Mónica Diniz is a sociologist, Head of the Prevention, Security and International Relations of the Lisbon Municipal Police. Monica has a Masters in Sociology and Planning and has been developing her work in the area of Police-Citizen cooperation with a main focus on the implementation of bottom-up collective approaches for crime-prevention and community policing projects. Monica has been working on the methodological transferability of the community policing model both in national and international contexts, namely in cooperation with the Council of Europe. She participates in projects on international cooperation in the field of Community Policing, Crime Prevention through Urban Design & Planning and Intercultural approach on security and safety issues. Monica also trains CP officers and is co-author of several publications on Community Policing.
[Drittes Prävinar aus der englischsprachigen Reihe mit dem Projekt „Cutting Crime Impact“]
Viele Fachkräfte und Engagierte stehen vor der Herausforderung, Projekte gestalten zu wollen, die eine bestimmte Zielgruppe adressieren (wie beispielsweise Frauen* oder Männer* mit Migrationserfahrungen). Dabei ist es schwierig, einerseits nicht in genderstereotype und kulturalisierende Vorstellungen zu verfallen und andererseits keine Projekte zu konzipieren, die an der Lebenswirklichkeit der Zielgruppe vorbeigehen.
In der Online-Fortbildung wollen wir gemeinsam über dieses Spannungsfeld nachdenken und dazu einladen, den Blick auf die Bedürfnisse von marginalisierten Personen(gruppen) zu lenken. Die Veranstaltung bietet Ihnen mit Inputs der Referent*innen, Methodenbeispielen und Transferaufgaben Impulse und Gestaltungsmöglichkeiten für gender- und vielfaltssensible Projekte in Ihrem Wirkungsfeld.
Darüber hinaus werden Sie sowohl in Kleingruppen als auch in selbstreflexiver Einzelarbeit dazu eingeladen, Ihren Blick für die eigenen stereotypisierenden Vorstellungen zu öffnen sowie praktische Ideen für die eigene Praxis mitzunehmen.
Verschwörungserzählungen existieren nicht erst seit der Corona-Pandemie, erfahren jedoch seit vergangenem Jahr eine besonders große Aufmerksamkeit. So werden zunehmend radikalisierte Gruppierungen unter den Corona-Demonstrierenden festgestellt. Aber auch im Familien- und Bekanntenkreis, auf der Arbeit oder im Engagement kommen viele Menschen aktuell damit in Berührung und suchen nach konkreten Argumentations- und Handlungsmöglichkeiten.
Die meisten Verschwörungserzählungen gründen sich auf rassistischen und antisemitischen Weltbildern, fördern Extremismus und können Radikalisierungsprozesse verstärken und beschleunigen. Die konkrete Gefahr erkennt man beispielsweise am Anschlag von Halle; der Täter handelte im Glauben an eine jüdische Weltverschwörung.
Verschwörungserzählungen zu erkennen und zu widerlegen, ist von großer Bedeutung: Was tun, wenn man auf Verschwörungserzählungen trifft? Welche Möglichkeiten des Entgegenwirkens gibt es? Die Veranstaltung „Wir sehen was, was ihr nicht seht“ – Radikalisierung erkennen und entgegentreten widmet sich unter anderem diesen Fragen.
-
14.06.2021
-
11.05.2021
Große Veranstaltungen wie der jährliche Deutsche Präventionstag müssen in Zeiten der Corona-Pandemie ganz besonders auf präventive Sicherheit achten und größtmöglichen Infektionsschutz gewährleisten. Derzeit kann niemand wissen, wie die Situation im Mai 2021 sein wird, aber gewiss ist, dass der 26. Jahreskongress in jedem Fall ausgerichtet werden wird.
Der 26. Deutsche Präventionstag findet am 10. & 11. Mai 2021 im Congress-Centrum Ost Koelnmesse in Köln (Deutz-Mülheimer Straße 51) statt.
Der Kongress wird mit einer flexiblen Varianz von Präsenz- und Onlineformaten im sogenannten „Hybridkonzept“ geplant. Ziel ist es, die Präsenzanteile so groß wie möglich zu gestalten und verantwortungsvoll der aktuellen Lage entsprechend umzusetzen. Daneben wird es in jedem Fall ein attraktives Onlineangebot geben, so dass ein lohnender Kongressbesuch immer auch ohne Anreise möglich ist.
Das Schwerpunktthema lautet:
Prävention orientiert!
... planen ... schulen ... austauschen ...
Darunter verstehen wir eine Debatte über die zentrale Rolle der Prävention gerade in Krisenzeiten sowie über die Bedeutung von Bildung und lebenslangem Lernen in diesem Prozess.
Zum Schwerpunktthema werden Expertisen sowie Videostatements erstellt, die im Vorfeld des Kongresses veröffentlicht werden.
Nahezu alle Großunternehmen behaupten von sich, Diversität zu lieben und divers zu sein. Sie hissen Regenbogenfahnen, betonen die Diversität ihres Teams und bieten betriebsinterne Diversity-Awareness-Tage an.
Doch was ist das eigentliche Ziel dahinter? Geht es um den Abbau von diskriminierenden Gesellschaftsstrukturen oder letztlich doch nur um Profitmaximierung?
Gemeinsam wollen wir in diesem Webseminar einen kritischen und konstruktiven Blick auf Diversity-Konzepte von einigen Großunternehmen werfen. Gleichzeitig richten wir aber auch den Blick auf uns selbst: Was sind unsere Vorstellungen von Vielfalt? Welche Formen von Vielfalt haben wir vielleicht noch nicht im Blick? Wie können wir unseren Lebens- und Berufsalltag vielfaltsoffener gestalten?
-
05.05.2021
April 2021
-
30.04.2021
Im April 2021 lädt das Göttinger Teilinstitut zur Auftaktveranstaltung "Praxis und Zukunft des sozialen Zusammenhalts" ein.
Mit Gästen aus Wissenschaft und Praxis möchte das Göttinger FGZ-Team über die Frage des Zusammenhalts in Zeiten neuer gesellschaftlicher Verwundbarkeiten diskutieren. Im Mittelpunkt stehen die Forschungsthemen des Standorts Göttingen: Arbeit, Haushalt und öffentliche Güter.
Die Veranstaltung ist im Tagungs- und Veranstaltungshaus „Alte Mensa“ am Wilhelmsplatz in Göttingen geplant.
Beteiligte:
Prof. Dr. Berthold Vogel
Dr. Natalie Grimm
M. A. Ina Kaufhold
Dr. Jennifer Villarama
Effective community engagement is critical to neighbourhood policing: it provides scope for officers and staff to establish collaborative relationships with citizens and partners, gain knowledge of a local area and address its security issues. Officers and staff often work within the same neighbourhood for several years. During this time, they build key connections in their community and acquire unique knowledge of the local area, its residents, its issues and dynamics. When neighbourhood officers and staff move to another post and leave their local area, this unique resource of knowledge and relationships leaves with them. At frontline level, turnover can compromise local knowledge and jeopardise trust relationships with citizens and partners.
Following an overview of neighbourhood policing within the wider UK context, this webinar will focus on the experience of Greater Manchester Police (GMP), one of the police organisations involved in the EU-funded Cutting Crime Impact (CCI).
As part of the CCI, GMP has worked on researching and developing an evidence-based Tool in neighbourhood policing, by adopting a human-centred design approach. This webinar will discuss the research carried out by GMP and it will present the "Community Connect" Tool, a handover protocol specifically designed for neighbourhood policing roles.
The webinar will also share insights gained through the CCI experience into the challenges police forces face in ensuring continuity of community engagement and maintaining long-term commitment to neighbourhood policing.
Referentinnen: Dr Roberta Signori (Greater Manchester Police) & Dr Megan O’Neill (University of Dundee)
[Zweites Prävinar aus der englischsprachigen Reihe mit dem Projekt „Cutting Crime Impact“]
Oft stellt die Unterbringung Geflüchteter mit Behinderung und Pflegebedarf eine große Herausforderung für die Länder und Kommunen dar. Aber auch die Leistungen und Anschluss-versorgungen, die für die Geflüchteten mit Behinderung und schweren Krankheiten möglich sind, sind teilweise im Antragsverfahren und der Zugangsberechtigung nicht immer bekannt.
Das Online-Seminar „Unterbringung und Versorgung Geflüchteter mit Behinderung“ infor-miert und gibt Orientierung. Experten vermitteln den Teilnehmenden neben theoretischem Wissen auch Best Practice Beispiele und zeigen zukünftige Handlungsmöglichkeiten auf, die in der Unterbringungspraxis relevant sind. Auf diese Weise werden Hemmschwellen abgebaut, Kooperationen und Wissen von erfahrenen Partnern dieser Bereiche zu nutzen.
Wie lassen sich Sichtbarkeit und Hörbarkeit im urbanen Raum berechnen und darstellen? Der Vortrag zeigt ein exemplarisches Vorgehen zur Berechnung von Sichtbarkeits- und Hörbarkeitsmaßzahlen auf der Grundlage von 3D-Stadtmodellen. Jörg Finger und Arne Schilling stellen die in Stadtsicherheit-3D genutzten Verfahren vor, mit welchen man für festgelegte Punkte auf einer Karte Maßzahlen für Sichtbarkeit und Hörbarkeit erhält. Die Berechnungen nutzen Gebäudedaten aus einem 3D-Stadtmodell als Eingabe und können weitere Faktoren wie z.B. maximale Sichtweiten und Hintergrundlärm berücksichtigen. Hier fließen auch Ergebnisse aus den im Projekt durchgeführten Vor-Ort-Messungen mit ein. Die Berechnungen zu Sichtbarkeit und Hörbarkeit können direkt in einer Web-basierten Softwareanwendung gestartet und anschließend dort visualisiert werden.
In dem Webseminar werden diese Fragen aufgegriffen und wir tauschen uns darüber aus, wie gendersensibles Sprechen und Handeln im Alltag (besser) gelingen kann. Nach einem Input wird es die Möglichkeit zum Austausch in Kleingruppen geben. Wir freuen uns daher über Ihre aktive Teilnahme.
-
31.12.2021
März 2021
Zunächst richten wir den Blick auf Österreich und die Entwicklungen rund um die Einrichtung der Dokumentationsstelle Politischer Islam. Dabei sprechen wir sowohl über die ihr vorangegangenen Entwicklungen als auch über mögliche Folgen. Daran anschließend legen wir den Fokus auf den deutschen Kontext und nehmen die Auswirkungen der Diskussion auf Muslim*innen sowie die Arbeit muslimischer Verbände und Vereine in den Blick. Abschließend sollen die sowohl unterschiedlich als auch synonym verwendeten Begriffe gegeneinander abgegrenzt werden.
-
28.03.2021
Dass wir strafen, erscheint uns eine Selbstverständlichkeit. Manchmal erfüllt sie uns mit Unbehagen, aber wirklich in Frage stellen wir sie nicht. «Strafe ist die Wurzel der Gewalt auf unserem Planeten», schreibt der Begründer der Gewaltfreien Kommunikation, Marshall Rosenberg. Strafe ist ein Kern von Herrschaft: sie bedarf Institutionen, die sie ausführen, und bedeutet, dass sich ein Individuum über das andere erhebt. Um einer friedlicheren und freieren Gesellschaft näher zu kommen, ist daher die Infragestellung von Bestrafung notwendig.
Wie aber kann es anders gehen? Welche Alternativen gibt es?
Im ersten Teil erarbeiten wir gemeinsam, was Strafe eigentlich ist und warum wir sie einsetzen. Wir sprechen über unsere Erfahrung mit dem Strafen und Bestraft-werden, über die verschiedenen Kontexte des Strafens sowie über das Gefängnis und den gesellschaftlichen Strafapparat.
Im zweiten Teil geht es um Alternativen. Was braucht es, um ohne Gefängnis und ohne Strafe auszukommen? Verschiedene Modelle – Stichwort Restorative Justice, Transformative Justice – werden vorgestellt und je nach Zeitrahmen das ein oder andere in einfachen Übungen ausprobiert.
Wo liegen die Gründe der wachsenden Islamfeindlichkeit und des antimuslimischen Rassismus in Deutschland? Die Debatte um den Islam wird entweder im Kontext von „Integration“ und „Parallelgesellschaften“ oder „Islamismus“ und „Politischen Islam“ geführt. Es ist wichtig, Islamfeindlichkeit und antimuslimischen Rassismus in unserer Gesellschaft konkret zu benennen.
Ziel der Veranstaltung ist, mithilfe der Expert*innen zu informieren und zu sensibilisieren, um muslimisches Leben in Deutschland zu schützen und anzuerkennen.
Wir diskutieren mit:
- Aiman Mazyek (Vorsitzender Zentralrat der Muslime)
- Alioune Niang (Bildungsreferent Ufuq e.V.)
- Gabriele Boos-Niazy (Vorsitzende Aktionsbündnis muslimischer Frauen e.V.)
- Zuher Jazmati (Fachreferent VBRG)
- Moderation: Peter van Gielle Ruppe (Projektleiter @culture_coaches)
Aufgrund der Corona-Pandemie findet die Netzwerktagung in diesem Jahr mit einem verkürzten Programm online und eintägig statt.
-
26.03.2021
Wie können Veranstaltungen intersektional (also möglichst inklusiv und diskriminierungssensibel) gestaltet werden? Wie spreche ich die Menschen an, die ich erreichen will? Wen denke ich bei meiner Veranstaltungskonzeption bereits mit und wen habe ich noch nicht im Blick?
Die Veranstaltung lenkt den Blick auf die sogenannten „blinden Flecken“, die wir alle besitzen, wenn es darum geht, Veranstaltungen inklusiv und diskriminierungssensibel zu gestalten. In einem ersten Teil geht es um das Konzept der Intersektionalität (die Anerkennung von Mehrfachdiskriminierungen) und um die Frage, was dies für die konkrete Veranstaltungsplanung bedeuten kann. In zweiten Teil des Seminars geht es um den Bezug zur eigenen Praxis und um eine Reflexion der eigenen Tätigkeit.
Unser Thema ist dieses Mal das gleichermaßen spannende, irritierende aber auch unterhaltsame Gebiet der Verschwörungstheorien/-ideologien. Wir freuen uns, Mirko Bode, ehrenamtlicher Berater bei der Der goldene Aluhut gUG, begrüßen zu dürfen. Mirko Bode ist Vater von drei Kindern aus Berlin und hauptberuflich im Vertrieb tätig. Er ist selbst Angehöriger einer verschwörungsgläubigen Person und ist Ansprechpartner für alle Fragen rund um die Familie, Scheidungsfälle und den Umgang mit Behörden. Nebenbei kennt sich Mirko auch gut mit Ancient Aliens, evangelikalem Christentum, Impfgegnern und Rechtsesoterik aus.
Wir freuen uns auf einen interessanten und kurzweiligen Austausch zu einem Themenbereich, der uns insbesondere im Laufe der vergangenen US-Präsidentschaft und auch im Zuge der Corona-Pandemie begegnete und begegnet. Wir klären, was eigentlich Verschwörungstheorien definiert und warum man besser von Verschwörungsideologien spricht. Wie stehen diese im Bezug zu wirtschaftlichen Themen und was mache ich, wenn mein Chef Verschwörungsideologien verbreitet oder sich als Impfgegner entpuppt?
Mit den im Titel zitierten Worten beschreibt Dr. Stephan Dünnwald, Vorstandsmitglied der Bundesarbeitsgemeinschaft Pro Asyl, im Mai 2020 ein zentrales Problem für Geflüchtete in der COVID-19-Krise. Während in der Pandemie Bildung vielerorts digitalisiert und auf Onlineangebote umgestellt wird, werden sozial benachteiligte Gruppen dadurch eher abgehängt als einbezogen. Für Geflüchtete gilt dies in besonderem Maße. Am täglichen Sprachkurs über das Smartphone teilzunehmen, ist irgendwo zwischen unmöglich und unzumutbar. Zudem ist die oft und gerne wiederholter Tatsache, alle Geflüchteten hätten ein Smartphone, eher als Mythos einzuordnen. Und selbst wenn: Wer schon einmal an einem Zoom-Meeting über mobile Daten teilgenommen hat, der kann abschätzen, wie wenig Unterrichtsstunden man auch bei großzügig limitierten Handyverträgen im Monat absolvieren kann.
Auf dieser vollständig digital stattfindenden Fachtagung wollen wir uns mit dem Themenkomplex digitale Erwachsenenbildung für Geflüchtete auseinandersetzen. Welche Schwierigkeiten birgt das 'Allheilmittel' Digitalisierung in der Erwachsenenbildung für Geflüchtete, welche Exklusionsmechanismen werden auf- und ausgebaut? Welche Möglichkeiten bietet die Technik andererseits gerade für diese Zielgruppe? Durch eine Keynote, eine Reihe von Workshops und eine abschließende gemeinsame Diskussionsrunde werfen wir einen breiten Blick auf den Themenkomplex, der ebenso Hard- und Software, wie soziale und pädagogische Aspekte umfasst.
-
19.03.2021
Urbane Sicherheit ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wie können Bürger*innen die Lösungsentwicklung und in die Umsetzung einbezogen werden, wo liegen Chancen und Grenzen?
Kommunen sind häufig die ersten Ansprechpartner für Bürger*innen, wenn es um Fragen mangelnder Sicherheit oder ein subjektives Unsicherheitsgefühl geht. Urbane Sicherheit ist eine gesamt-gesellschaftliche Aufgabe und erfordert eine gute Zusammenarbeit der professionellen Sicherheitsakteure in den Kommunen sowie die Einbeziehung der Zivilgesellschaft. Insbesondere Frauen, Jugendliche, Senior*innen und Bevölkerungsgruppen, die von Marginalisierung und Diskriminierung betroffen sind, sollten nicht nur passive Ziele von Präventionsmaßnahmen sein, sondern eine aktive Rolle bei der Gestaltung von urbaner Sicherheitspolitik spielen.
Mittlerweile gibt es viele Ansätze zur Beteiligung der Bürger*innen bei der Lösung von Ordnungs- und Sicherheitsproblemen: Nachbarschaftsbegehungen, Sicherheitsbefragungen, Präventionsspaziergänge, Quartiersworkshops, Nachtwanderer, freiwilliger Polizeidienst und vieles mehr.
- Welche Möglichkeiten der Einbeziehung von Bürger*innen im Umgang mit Fragen von Ordnung und Sicherheit sowie der kommunalen Prävention gibt es?
- Wo liegen Grenzen der Beteiligung?
- Wie kann die Zusammenarbeit zwischen professionellen Sicherheitsakteuren und Zivilgesellschaft organisiert werden?
Das Seminar gibt einen Überblick über bestehende Ansätze und einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen mit Beiträgen aus Forschung und Praxis und bietet die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch.
Frauen* sind nach der Migration oder Flucht nach Deutschland häufig in einer besonders vulnerablen Situation. Sie sind hier einerseits von Mehrfachdiskriminierungen betroffen und ihr Zugang zu Bildung und Arbeitsmarkt ist häufiger viel beschränkter als für Männer*, andererseits eröffnen sich ihnen manchmal aber auch neue Freiheiten. Dies führt häufig zu Verunsicherungen der Rollenbilder, auch innerhalb von migrierten Familien.
Gleichzeitig gibt es in der Arbeit mit geflüchteten und migrierten Frauen* auch auf der Seite von Haupt- und Ehrenamtlichen viele offene Fragen, bspw. wie geflüchtete Frauen* besser erreicht werden oder auf welche Weise Projekte geschlechtersensibel gestaltet werden können.
Der Online-Workshop thematisiert diese Fragen und bietet Impulse und Gestaltungsmöglichkeiten für gender- und vielfaltssensible Projekte in Ihrem Wirkungsfeld. Durch eine vielfältige Auswahl an Methoden bekommen Sie die Möglichkeit, Ihre eigene pädagogische Arbeit zu reflektieren und einen Perspektivwechsel hinsichtlich der eigenen Vorstellungen von „Kultur“ und Geschlechterrollen vorzunehmen. Darüber hinaus werden Sie in Kleingruppen dazu eingeladen, Ihren Blick für die eigenen stereotypisierenden Vorstellungen zu öffnen sowie praktische Ideen für die eigene Praxis mitzunehmen.
Der Workshop findet in Kooperation mit der AEWB – Agentur für Erwachsenen- und Weiterbildung statt.
-
28.03.2021
Die Internationalen Wochen gegen Rassismus sind Aktionswochen der Solidarität mit den Gegnern und Opfern von Rassismus, die alljährlich um den 21. März, den Internationalen Tag gegen Rassismus, stattfinden.
Die Stiftung der Internationalen Wochen gegen Rassismus stellt verschiedene Materialien zur Verfügung – wie etwa mehrsprachige Infoflyer oder Postkarten und Plakate sowie „IMPULSE“ mit Ideen und Anregungen zur Beteiligung an den Aktionswochen. Ebenso empfiehlt sie Aktionen via Social Media inklusive Nutzung einschlägiger Hashtags wie #IWgR oder #IWgR21 und gibt einige Tipps zur Veranstaltungsplanung und Öffentlichkeitsarbeit in Corona-Zeiten.
Veranstaltungen werden in einem zentralen Online-Veranstaltungskalender dokumentiert und einem breiteren Publikum zugänglich gemacht. Die offizielle Auftaktveranstaltung findet am Montag, 15. März ab 17.00 Uhr statt und kann auf YouTube im Livestream verfolgt werden.
Am Sonntag, 21. März,dem Internationalen Tag gegen Rassismus, ist eine europaweite Fotoaktion in den sozialen Netzwerken zum Motto #solidarity geplant.
Während sich in den vergangenen Jahren der Fokus der Unterstützungsarbeit verstärkt auf migrantische Frauen* gerichtet hat, wird in letzter Zeit die Frage präsenter, wie geschlechtersensibel und zugewandt mit migrantischen Männern* gearbeitet werden kann. Wie kann dabei ein offener und nachhaltiger Dialog über Männlichkeits*-Thematiken mit Männern* gestaltet werden? Das Webseminar bietet einen ersten Einblick in das Themenfeld der gendersensiblen Männerarbeit* und legt dabei einen besonderen Fokus auf die Lebenswirklichkeiten migrantischer Männer*.
Die Veranstaltung richtet sich an Interessierte und Einsteiger*innen im Themenfeld. Bitte melden Sie sich nur an, wenn Sie fest vorhaben, an der Veranstaltung teilzunehmen.
Wie können wir die polizeiliche Kriminalprävention effektiv und bedarfsgerecht unterstützen? Das DPT-Institut für angewandte Präventionsforschung (DPT-I) bietet eine englischsprachige Prävinarreihe zu dem EU-Projekt Cutting Crime Impact (CCI) an.
Die Gewährleistung von Sicherheit scheint zunehmend von technologieorientierten Lösungen und technologiezentriertem Denken dominiert zu sein. Gleichzeitig gibt es einen Bedarf an humanen, gemeinschaftsorientierten und kollaborativen Ansätzen zum Erzeugen von Sicherheit. In dem Auftakt-Prävinar werden Prof. Caroline Davey und Andrew Wootton, Leiter des Design Against Crime Solution Centre, University of Salford, dieses Spannungsverhältnis in den Blick nehmen und von ihren Erfahrungen mit einem auf den Menschen ausgerichteten Design-Ansatz zur Bewältigung von Sicherheitsproblemen berichten. Bei dem EU-Projekt "Cutting Crime Impact" (CCI) wurden neue Tools entwickelt, um die polizeiliche Kriminalprävention zu unterstützen - von der Aus- und Weiterbildung, dem Briefing und dem Management von Polizeibeamten und -beamtinnen bis hin zu kriminalpräventiven Beratungsangeboten. Prof. Caroline Davey und Andrew Wootton werden diskutieren, wie ein stärker auf den Menschen ausgerichteter Ansatz ein Umdenken und ein Reframing von Problemen ermöglicht, die zuvor aus einer Top-Down-Perspektive beschrieben wurden. Ziel ist es, die Bedürfnisse der Endnutzer - sei es Polizei, Politik oder die Bürgerinnen und Bürger - besser zu erfüllen.
[Erstes Prävinar aus der englischsprachigen Reihe mit dem Projekt „Cutting Crime Impact“]
Februar 2021
«Restorative Justice» – ein Begriff, der nur schwer ins Deutsche übersetzbar ist – bezeichnet eine Theorie sowie eine weltweite Bewegung, deren Inhalt und Ziel es ist, mit schmerzhaften Konflikten und Unrecht einen anderen Umgang zu finden. Namentlich einen Umgang, der auf Strafe verzichtet, der keiner höheren Instanzen («Staat») bedarf, sondern «den Konflikt den Menschen als ihr Eigentum zurückgibt» (Nils Christie).
Wichtige Eckpunkte der RJ sind der gleichberechtigte Dialogprozess zwischen allen Konfliktbeteiligten, die Übernahme von Verantwortung für die Handlungen der Vergangenheit und für den Prozess der Konfliktklärung, das gegenseitige Zuhören und Verstehen, die Wiedergutmachung (oder eine Annäherung daran) sowie die Wahrung der Autonomie und der Respekt vor der Integrität aller. Es scheint für viele vielleicht zunächst unvorstellbar, dass sich Geschädigte, Beschuldigte und weitere Betroffene an einen Tisch setzen, um über zum Teil äußerst schmerzhaftes Geschehenes zu sprechen und dann eine gemeinsame Lösung auszuhandeln. Es ist aber, wenn es gelingt, ein für alle ermächtigender und heilsamer Prozess.
Viele Flüchtlinge haben im Herkunftsland, auf der Flucht und nach der Ankunft in Deutschland traumatische Erfahrungen gemacht. Einige von ihnen erkranken darüber langfristig psychisch.
Wir möchten ehrenamtlichen Unterstützerinnen mehr Sicherheit im Umgang mit traumatisierten Flüchtlingen geben – und zwar ganz unkompliziert in einem Online-Seminar. Dabei werden wir diesen und weiteren Fragen nachgehen: Was ist ein Trauma und wie entsteht eine Traumafolgestörung? Welche therapeutischen Möglichkeiten, Schutz- und Risikofaktoren gibt es? Wie können Ehrenamtliche die betroffenen Flüchtlinge unterstützen, stabilisieren und besser mit Krisensituationen umgehen?
Anmeldung bitte bis zum 18.02.2021 bei Maria Fechter unter ehrenamt2@frnrw.de
Was haben Harry Potter, Frodo Beutlin, Marty McFly und Luke Skywalker gemeinsam? Warum überrascht es ist nicht, dass die meisten Sitcoms sexistisch sind? Welche Darstellungen von Männerrollen in Film und TV sind auch für Männer gefährlich? Wie werden „fremde Männer“ dargestellt und wer profitiert von diesen Inszenierungen?
Diesen und weiteren Fragen wollen wir gemeinsam männlichkeitskritisch nachgehen. Zugleich schauen wir auf Stärken, die ein vielfaltssensibler und konstruktiver Blick auf diverse Formen von Männlichkeiten* für alle Menschen haben kann.
-
26.02.2021
Die meisten sexualisierten Gewalttaten werden überwiegend von Frauen und Mädchen erlitten und von Männern und Jungen verübt. Doch auch die Vergewaltigung von Männern und Jungen durch Männer und Frauen ist ein erkanntes Problem. Die WHO geht für Deutschland davon aus, dass eine Million Mädchen und Jungen sexualisierte Gewalt erlebt haben oder erleben. Das sind pro Schulklasse ein bis zwei betroffene Kinder. Doch nicht nur Kinder und Jugendlichen erleiden sexualisierte Gewalt, auch Erwachsene, insbesondere Frauen sind von sexualisierter Gewalt immens betroffen. Sexualisierte Gewalt wirkt sich einschneidend auf die physische und psychische Gesundheit ihrer Opfer aus. Sie führt nicht nur zu Verletzungen, sondern erhöht auch das Risiko einer Reihe von Problemen der sexuellen und reproduktiven Gesundheit, wobei die Folgen nur zum Teil sofort sichtbar werden, teilweise aber auch erst Jahre nach dem Übergriff zutage treten.
In dieser Fortbildung wird zum einen das Thema sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche beleuchtet. Um Kinder und Jugendliche vor sexuellem Missbrauch schützen zu können, brauchen pädagogische Fachkräfte ein fundiertes Wissen über dieses Thema. In der Fortbildung werden neben der Definition von sexualisierter Gewalt sowie Zahlen und Fakten auch Einblicke in die Dynamik des Missbrauchsgeschehens und in die Täterstrategien vermittelt. Denn diese Kenntnisse sind die Grundlage für eine erfolgversprechende präventive Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen sowie Intervention. Sexualisierte Gewalt ist eine Kindeswohlgefährdung und verpflichtet uns zum Handeln. Im Fokus der Fortbildung stehen somit auch unsere Handlungsoptionen, wenn wir Verdacht oder Kenntnis von sexualisierter Gewalt unter Kindern und Jugendlichen, durch Familienangehörige, Bekannte, das soziale Umfeld sowie durch Mitarbeiter*innen haben. Zudem geht es um die Unterstützung von Betroffenen und den Umgang mit Gewaltausübenden. Wir werden gemeinsam überlegen, was Sie dafür tun können, damit ihre Einrichtungen Schutzräume für Kinder und Jugendliche sind.
Zum anderen wird in dieser Fortbildung auf sexualisierte Gewalt gegen Erwachsene, insbesondere im Beziehungskontext eingegangen. Im Mittelpunkt stehen zum einen Hilfe- und Unterstützungsmöglichkeiten im Kontext der Arbeit in Unterkünften, zum anderen werden straf- und zivilrechtliche Möglichkeiten aufgezeigt. Nicht zuletzt werden Hinweise für die Erstellung eines sexualpädagogischen Konzeptes für die gesamte pädagogische Einrichtung gegeben.
Viele Fachkräfte und Engagierte stehen vor der Herausforderung, Projekte gestalten zu wollen, die eine bestimmte Zielgruppe adressieren (wie beispielsweise Frauen* mit Migrationserfahrungen). Dabei ist es schwierig, einerseits nicht in genderstereotype und kulturalisierende Vorstellungen zu verfallen und andererseits keine Projekte zu konzipieren, die an der Lebenswirklichkeit der Zielgruppe vorbeigehen.
In der Online-Fortbildung wollen wir gemeinsam über dieses Spannungsfeld nachdenken und dazu einladen, den Blick auf die Bedürfnisse von marginalisierten Personen(gruppen) zu lenken.
-
20.02.2021
Neun Menschen wurden am 19. Februar 2020 im hessischen Hanau bei einem kaltblütigen rechtsextremen Anschlag ermordet. Was die Opfer gemein hatten: ihr sogenannter Migrationshintergrund. Zum ersten Jahrestag dieser Ermordungen findet vom 18. – 20. Februar 2021 im Literaturhaus Frankfurt WIR SIND HIER. Festival für kulturelle Diversität statt. Ins Leben gerufen und kuratiert von Verlagsgründerin Selma Wels und Benno Hennig von Lange, Literaturhaus Frankfurt. Zu Gast sind Autor*innen, die sich in ihrer literarischen, journalistischen oder publizistischen Arbeit ausdrücklich oder hintergründig mit Rassismus beschäftigen. Außerdem sind zu Gast Redner*innen aus Wissenschaft und Seda Başay-Yıldız, Anwältin der Nebenklage im sogenannten NSU-Prozess.
Die Festival-Gäste sind:
Ferda Ataman, Mohamed Amjahid, Seda Başay-Yıldız, Sham Jaff, Idil Baydar, Alice Hasters, Michel Abdollahi, Hadija Haruna-Oelker, Deniz Utlu, Hengameh Yaghoobifarah, Miryam Schellbach, Fatma Aydemir, Max Czollek, Ronya Othmann, Senthuran Varatharajah und Benaissa Lamroubal.
WIR SIND HIER. befasst sich rückblickend und vorausschauend mit dem Zustand Deutschlands als Zuwanderungsland. Dem Narrativ einer belastenden Einwanderungsproblematik und der verbreiteten Gleichgültigkeit gegenüber rassistischer oder antisemitischer Gewalt werden positive, kritische und inklusive Narrationen entgegengesetzt. Denn längst hat sich eine diverse deutschsprachige Literatur als Abbild einer vielfältigen und offenen Gesellschaft etabliert, die mehr leistet und zu bieten hat, als jede Fernsehrunde zum Thema Populismus.
An den Festivaltagen – und natürlich darüber hinaus – ruft WIR SIND HIER. zudem zu einer Gedenkaktion an die Opfer der rassistischen Morde von Hanau auf. Diese Aktion findet bewusst online statt und will ein Zeichen gegen das Vergessen setzen und beruft sich auf Heinrich Heines berühmten Eingangsvers „Denk ich an Deutschland in der Nacht“ aus den „Zeitgedichten“. Mit dem Hashtag #denkichanhanau soll der Opfer von Hanau und weiterer Opfer rechter Gewalt gedacht werden. Alle sind eingeladen und aufgerufen, ihre eigene Perspektive zu formulieren und diese auf der Plattform ihrer Wahl online zu posten.
Wer profitiert von Feminismus? Kommt er letztlich nur weißen Frauen* aus der Mittelschicht zugute oder spiegeln sich darin auch die Bedürfnisse von migrantischen, armen, queeren Frauen* oder Frauen* of Color wider? Und… profitieren auch Männer* von der Auflösung sexistischer Machtverhältnisse?
Ein intersektionaler Feminismus hat sich zum Ziel gesetzt, Mehrfachdiskriminierungen anzuerkennen und Mehrfachzugehörigkeiten zu akzeptieren. Er steht damit einerseits für eine gerechtere Gesellschaft für Personen aller Geschlechter und gegen den Abbau von Sexismus, akzeptiert aber andererseits, dass es neben Sexismus andere wirkmächtige Diskriminierungsformen gibt, die ebenso abgebaut werden müssen.
In dem Webseminar schauen wir gemeinsam etwas tiefer in die Geschichte des intersektionalen Feminismus hinein und diskutieren über aktuelle politische Bewegungen und Entwicklungen.
In einem zweiten Teil bekommen die Teilnehmer*innen Möglichkeit, ihre eigenen Fragen einzubringen und sich in Kleingruppen über das Gehörte auszutauschen.
Fast jeder ehrenamtliche Helfer kommt im Laufe seiner Tätigkeit mit Geflüchteten in Kontakt, die stark unter den traumatisierenden Folgen ihrer Flucht leiden. Die Veranstaltung soll allgemeine Informationen und Hilfestellung für die Zusammenarbeit mit den Betroffenen liefern.
Das Netzwerk für traumatisierte Flüchtlinge in Niedersachsen bieten ein vielfältiges Angebot an Unterstützung und lässt mit der Referentin Sandra Steinkühler (Standortleitung Osnabrück) alle Interessierten einen Einblick in ihrer tägliche Arbeit gewinnen.
In dieser Online-Schulung vermitteln wir Ihnen ein Grundverständnis der rechtlichen Situation, in der sich Flüchtlinge während und nach dem Asylverfahren befinden. Dies ermöglicht es Ihnen, die Anliegen der Flüchtlinge besser einzuordnen und einzuschätzen, wann Beratung oder rechtliche Vertretung notwendig werden. Es besteht die Gelegenheit für Fragen und Austausch.
Anmeldung bitte bis zum 04.02.2021 bei Mira Berlin unter ehrenamt1@frnrw.de
-
13.04.2021
Die Online-Seminare für Jugendämter, Kinder- und Jugendhilfe, Vormünder, Polizei, BAMF u.w. vermittelt grundlegendes Wissen zu Handel mit Kindern und den Betroffenen. Sie lernen, welche Anzeichen es für Handel mit und Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen gibt und wie Sie Betroffene erkennen können. Außerdem beleuchtet werden spezielle Phänomene des Menschenhandels und besondere Vulnerabilitäten im Migrations- und Asylkontext sowie die aufenthalts- und asylrechtliche Relevanz von Menschenhandel.
Dienstag, 09.02.2021, 10:00 – 12:00 Uhr Anmeldung hier
Dienstag, 09.03.2021, 10:00 – 12:00 Uhr Anmeldung hier
Dienstag, 13.04.2021, 10:00 – 12:00 Uhr Anmeldung hier
An allen Terminen findet das selbe Online-Seminar statt!
"Wie wird die Gesundheit von Geflüchteten gewährleistet, die in Erstaufnahmeeinrichtungen untergebracht sind? Die Ärzt*innen Dr. Miriam Bitzer und Dr. Karl-Heinz Utescher werden von ihren Erfahrungen mit der Versorgung von Geflüchteten in zwei Unterkünften berichten. Gemeinsam mit Vertreter*innen der Politik und der Flüchtlingssozialarbeit wollen wir einen Blick auf die Gesundheitsversorgung von Geflüchteten werfen und dabei auch über körperliche und psychische Risiken sprechen, die von der CoronaPandemie ausgehen. Vorgestellt wird auch der Leitfaden unserer Mitarbeiterin Jenny Thomsen zum Umgang mit traumatisierten und psychisch erkrankten Geflüchteten in Aufnahmeverfahren. Moderation: Henning Röhrs, Kinder- und Jugendtherapeut, Vorstand NTFN e.V
Aufgrund der aktuellen Corona-Kontaktbeschränkungen haben wir uns entschieden, die Veranstaltung (ursprünglich geplant für den 27.11.) auf Freitag, den 5. Februar 2021 zu verschieben. Wir hoffen, diese dann als Präsenzveranstaltung mit Publikum durchführen zu können, planen aber auch digitale Teilnahmemöglichkeiten."
Januar 2021
(Anti-)Diskriminierung ist ein herausforderndes Thema für Mitarbeitende in Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete. Diese Veranstaltung soll Mitarbeitende in Gemeinschaftsunterkünften für verschiedene Formen von Diskriminierung sensibilisieren und auch dabei unterstützen, mögliche (unbeabsichtigte) Diskriminierungen in Abläufen und Strukturen aufzudecken. Weiterhin soll eine Abgrenzung und Unterscheidung zum Thema (Alltags-) Rassismus erfolgen. Es sollen Handlungsoptionen im Umgang mit rassistischen und diskriminierenden Äußerungen und Aktionen entwickelt werden, um den Mitarbeiter*innen Handlungssicherheit und Strategien zu wirkungsvollen Interventionen in diesen Situationen zu vermitteln.
Welche Maßnahmen können in Einrichtungen ergriffen werden, um die Gefahr von Diskriminierung zu verringern? Was können Mitarbeiter*innen und Betreiberorganisationen tun, um eine diskriminierungs- und rassismusfreie Umgebung in den Unterkünften zu schaffen?
Antisemitismus ist in Deutschland wieder präsenter geworden. Für Juden und Jüdinnen gehören antisemitische Anfeindungen längst zum Alltag. Als Ideologie mit „vielen Gesichtern“ ist Judenhass in allen gesellschaftlichen Schichten und in allen politischen Spektren sichtbar. Wodurch zeichnen sich die gegenwärtigen Erscheinungsformen des Antisemitismus aus? Vor welche Herausforderungen stellen uns die aktuellen Entwicklungen? Und wie kann Antisemitismus entschlossen entgegengetreten werden?
Die Veranstaltung findet online auf einer interaktiven Veranstaltungsplattform statt und ist kostenlos.
Sie können die Veranstaltung gern über den Youtube-Livestream des IDZ Jena verfolgen
-
02.06.2021
Das Angebot richtet sich an Lehrkräfte und Schulsozialarbeiter*innen an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen.
Im ersten Durchgang der Weiterbildung 2021 ist das Einzugsgebiet Norddeutschland (Brandenburg, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein) – die weiteren Bundesländer folgen im Herbst 2021 und Frühjahr 2022.
Auf dieser Veranstaltung wird es thematisch darum gehen, wie zivilgesellschaftliche Organisationen (zgO) mit den Themen Migration und Diversität sowie der Partizipation und Repräsentation von Migrant*innen in den eigenen Strukturen umgehen.
Das Projekt „ZOMiDi- Zivilgesellschaftliche Organisationen und die Herausforderung von Migration und Diversität“ kommt damit zu einem Abschluss. 3 Jahre lang haben das Max-Planck-Institut in Göttingen, die Ludwig-Maximilian Universität München sowie das Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung (BIM) an der Humboldt-Universität den migrationsbezogenen Wandel in ausgewählten zivilgesellschaftlichen Organisationen untersucht.
Inhaltlich erwartet Sie ein abwechslungsreiches Programm: Die Teilprojekte präsentieren Ihnen relevante Ergebnisse aus der Forschung zu den einzelnen zivilgesellschaftlichen Organisationen. Zudem wird es spezifischer um die Frage der migrantischen Repräsentation und Partizipation gehen. Es wird diskutiert, mit welchen Herausforderungen zivilgesellschaftliche Organisationen konfrontiert sind und welche Spannungsfelder sich innerorganisational dadurch ergeben. Natürlich werden Sie auch selbst die Möglichkeit haben, sich mit Fragen und Diskussionsbeiträgen einzubringen.
Am 14. Januar 2021 findet die zweite Veranstaltung der neuen Online-Forum Serie zum Thema "Öffentlichkeitsarbeit mit sozialen Medien" statt. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen konkrete Handlungsempfehlungen für einen professionellen Einstieg in Facebook und Instagram.
Warum und wie machen Law Clinics gute Lehre? Welche zusätzlichen Kompetenzen werden durch die Beratungstätigkeit erlernt? Antworten darauf geben Mailin Loock, als zukünftige Dozentin der RLC Hamburg und Sophie Greilich.
Dabei beziehen sie sich auf das Teaching Manuel der RLC Hamburg, an welchem Sophie Greilich als Wissenschaftliche Mitarbeiterin maßgeblich mitgewirkt hat.
-
30.06.2021
Kostenlose Fortbildung für transkulturellen Austausch und gesellschaftliche Teilhabe für Menschen mit und ohne Migrationshintergrund
Die Fortbildung befähigt Sie einen Einstieg in verschiedene Bereiche des gesellschaftlichen Lebens in Deutschlands zu finden und Ihre eigenen Kompetenzen zu stärken. Durch die interaktiven Formate erhalten Sie bereits während der Fortbildung verstärkt die Möglichkeit, sich am sozialen Leben zu beteiligen.
Die diverse Ausrichtung der Teilnehmer*innen trägt zusätzlich zu neuen Begegnungen und Austausch bei. Gleichzeitig werden durch Exkursionen Zugänge zum städtischen Raum ermöglicht.
Die kostenlose Fortbildung richtet sich explizit sowohl an Menschen mit – als auch an Menschen ohne Migrationshintergrund.
Dezember 2020
Das Online-Training vermittelt mit interaktiven Methoden Medienkompetenzen für folgende Fragestellungen:
• Wie begegne ich Angriffen und Aggression im Netz?
• Wie treten extremistische Gruppen im Internet auf?
• Wie erkenne ich Fake News?
• Wie kann ich selbst aktiv gegen Hass und Hetze vorgehen? Wie ist die rechtliche Situation in Österreich?
• Wie kann ich Opfer von Hass im Netz unterstützen?
• Wo und wie bekomme ich als Opfer Hilfe?
Ziele:
• Sensibilisierung für die Auswirkungen von Hass und Hetze im Internet
• Wissenstransfer rund um den Themenbereich Digitale Medien und Hass im Netz
• Erweitern der Kommunikations- und Handlungskompetenzen und der rhetorischen Fähigkeiten
-
10.12.2020
Diskriminierung und Rassismus sind fester Bestandteil der Lebensrealität von jungen Menschen mit Fluchterfahrung. Ihre Unterstützung im Umgang mit Diskriminierung und Rassismus muss daher auch Teil unserer Arbeit sein. Wie jedoch diese Aufgabe genau zu bewerkstelligen ist, stellt nicht selten eine Herausforderung dar, nicht zuletzt da hier große Unsicherheiten bestehen.
Wie können wir junge Menschen im Umgang mit Diskriminierung und Rassismus unterstützen und empowern? Die Online-Tagung nähert sich dieser Frage aus verschiedenen Perspektiven und verschafft damit einen Überblick über Handlungsmöglichkeiten auf der rechtlichen, pädagogischen und zivilgesellschaftlichen Ebene.
Neben mehreren Vorträgen sind außerdem verschiedene interaktive Formate vorgesehen, die einen Austausch über Erfahrungen und (Best-)Practices sowie Diskussion und Vernetzung ermöglichen.
Das wichtige Engagement im Ehrenamt stößt nicht nur auf Verständnis. In dieser digitalen Kurzeinführung gibt es einen Überblick zu Umgangsmöglichkeiten mit Hass im Netz oder sogenannten Stammtischparolen. Was macht sie aus und was kann man als Einzelperson oder als Organisation on- und offline tun, um sich den Anfeindungen zu widersetzen? Neben einem inhaltlichen Teil und der Vorstellung der App Konterbunt gibt es Hinweise, an wen man sich wenden kann, wenn man sich tiefergehend mit dem Thema auseinandersetzen möchte und welche Organisationen Hilfe bieten. Im Anschluss ist Platz für Fragen und Diskussion.
Das Online-Forum wird über Edudip angeboten. Die Webinar-Software ist browserbasiert und ohne vorherige Installation sofort einsatzbereit. Für eine uneingeschränkte Teilnahme empfiehlt es sich jedoch, den Browser Google Chrome zu nutzen.
Viele Menschen würden sich engagieren, wenn sie denn für eine interessante Tätigkeit angesprochen werden. Zugleich melden immer mehr Vereine und Initiativen, dass sie Schwierigkeiten haben, (passende) Freiwillige zu finden, z.B. als Patin in Integrationsprojekten. In einem knappen Input erhalten Sie Tipps, wie Sie Interesse an einem Engagement in Ihrer Organisation/Initiative wecken und wie das Matching zwischen potenziellen Engagierten und passender Tätigkeit gelingen kann.
Die Online-Foren werden über Edudip angeboten. Die Webinar-Software ist browserbasiert und ohne vorherige Installation sofort einsatzbereit. Für eine uneingeschränkte Teilnahme empfiehlt es sich jedoch, den Browser Google Chrome zu nutzen.
Sie sind Amtsvormund oder im ASD für UMF (UMA)/ junge volljährige Geflüchtete zuständig? Oder Sie arbeiten in einer Jugendhilfeeinrichtung mit UMF (UMA)? Sie stehen / Ihr Team steht immer wieder vor (neuen) Fragen bezüglich asyl- oder aufenthaltsrechtlicher Regelungen und weiterer Themengebiete und Sie möchten Antworten finden? Sie fragen sich vielleicht, „wie machen das andere Kolleg*innen“ oder „wie wird das anderswo in Thüringen gemacht“?
Um Erfahrungen auszutauschen, Antworten und Lösungen zu finden oder auch (anonymisiert) Einzelfälle zu besprechen, soll der thüringenweite, trägerübergreifende Austausch zwischen interessierten Fachkräften gefördert werden.
Das Forum eröffnet mit einem Blick auf erfolgreiche Beispiele aus den verschiedenen sozialen Netzwerken. Es liefert einen kurzen Input zu Twitter, Facebook und Instagram mit dem Schwerpunkt: Welche Themen eignen sich für die verschiedenen Kanäle? Was poste ich wann? Die Referentin erklärt u.a. die Rolle der Algorithmen und gibt erste Impulse für die Besonderheiten der einzelnen digitalen Netzwerke.
Das Online-Forum wird über Edudip angeboten. Die Webinar-Software ist browserbasiert und ohne vorherige Installation sofort einsatzbereit. Für eine uneingeschränkte Teilnahme empfiehlt es sich jedoch, den Browser Google Chrome zu nutzen.
-
03.12.2020
November 2020
Im öffentlichen Bewusstsein sind extremistische Milieus auf den ersten Blick eines: Sie sind männlich! Die Realität ist indes eine andere, denn schon immer übernehmen Frauen in der salafistischen und rechtsextremistischen Szene zentrale Aufgaben. Bereits seit Jahren widmet sich die Forschung daher insbesondere der Rolle von Mädchen und Frauen in der rechtsextremistischen oder völkischen Szene. Aber auch für die salafistische Szene treten weibliche Akteurinnen in der Zwischenzeit verstärkt in den Vordergrund wissenschaftlicher Untersuchungen. Welche Rolle spielen Frauen in rechtsextremen oder salafistischen Gruppen tatsächlich?
Auf der Grundlage von Fachvorträgen wird zunächst über Frauen in salafistischen und rechtsextremistischen Milieus informiert, um anschließend mit den Referentinnen zu diskutieren. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart, dem Demokratiezentrum Baden-Württemberg der Türkischen Gemeinde in Baden-Württemberg (TGBW e.V.) und mit Unterstützung des Kompetenzzentrums gegen Extremismus in Baden-Württemberg (konex) statt.
Die meisten Asylerstanträge in der Altersgruppe der 18 bis unter 25-Jährigen werden von Männern gestellt. Die spezifischen Bedarfe von jungen geflüchteten Männern finden in den Strukturen der Unterbringung und der Angebotslandschaft hingegen wenig Berücksichtigung. Zugleich werden junge geflüchtete Männer im öffentlichen Diskurs oftmals als Problemgruppe und Sicherheitsrisiko dargestellt.
Das diesjährige Netzwerktreffen der Bundesinitiative „Schutz von geflüchteten Menschen in Flüchtlingsunterkünften“ widmet sich dem Themenfeld Männlichkeit und Flucht. Ziel ist, ein differenziertes Bild der Herausforderungen und Bedarfe für junge geflüchtete Männer zu zeichnen, das zum einen kriminologische Erkenntnisse zu Schutz- und Risikofaktoren, zum anderen Praxiserfahrungen in der psychosozialen Arbeit mit jungen geflüchteten Männern berücksichtigt.
Schätzungen von Handicap International zu Folge liegt bei 10 bis 15 Prozent der in Deutschland lebenden Geflüchteten eine Behinderung vor. Obwohl viele dieser Schutzsuchenden bereits Leistungen aus dem Unterstützungssystem für Menschen mit Behinderungen beziehen, belegen Berichte aus der Praxis einen zunehmenden Beratungsbedarf. Immer wieder kommt es zu Verzögerungen in der Leistungsbewilligung und Unterversorgung. Die Ursache liegt unter anderem in den voneinander getrennten Versorgungs- und Kooperationsstrukturen, die Menschen mit Behinderungen und Geflüchtete unterstützen.
Der Fachtag beschäftigt sich mit der Situation geflüchteter Menschen mit Behinderungen und im Besonderen mit der Schnittstelle zwischen den verschiedenen Unterstützungssystemen. Nach grundlegenden Informationen zur Situation von geflüchteten Menschen mit Behinderungen in Deutschland sowie zu den Leistungsansprüchen dieser Personengruppe stellen sich verschiedene Netzwerke aus den Bereichen Behinderung, Flucht sowie Integration, die im Süden Niedersachsens tätig sind, vor. Der Fachtag richtet sich an Fachkräfte und ehrenamtliche Engagierte aus den Bereichen der Verbandsarbeit für Menschen mit Behinderungen, der Behindertenhilfe sowie dem Unterstützungssystem für geflüchtete Menschen.
Peer Education ist ein bewährter Ansatz der politischen Bildung zur Entwicklung einer demokratischen Haltung und Prävention menschenverachtenden Denkens. Dabei sollen die Bildungsprozesse durch junge Teamende partizipativ und mit der nötigen Fach-, Methoden- und Medienkompetenz gestaltet werden. Doch welche Fach-, Methoden- und Medienkompetenz und welche (strukturellen) Rahmenbedingungen sind erforderlich, um Teamende für ihre Rolle zu qualifizieren? Welche Rolle kommt der Reflexion der eigenen Haltung und der jeweils eigenen Privilegien und Wertvorstellungen zu? Worauf sollte bei der inhaltlichen und methodischen Begleitung geachtet und welche Prioritäten sollten dabei gesetzt werden?
Der Fachtag richtet sich insbesondere an Projekte der universellen Islamismusprävention, die mit dem Peer-Education-Ansatz arbeiten bzw. perspektivisch arbeiten wollen. Der Fachtag bietet Raum für den Austausch über Herausforderungen und Gelingensbedingungen in der Qualifizierung von Teamenden und leistet einen Beitrag zur Entwicklung von Leitlinien der Qualifizierung.
-
26.11.2020
-
26.11.2020
Empowermentkonzepte und -ansätze sind seit einigen Jahren fester Bestandteil der pädagogischen Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Es werden Strategien angewendet und / oder Maßnahmen durchgeführt, welche dazu beitragen, junge Menschen in ihrer Autonomie und Selbstbestimmtheit zu fördern. Im Sinne einer Selbstermächtigung soll die junge Zielgruppe befähigt werden, Interessen eigenverantwortlich wahrzunehmen. Derartig wird Empowerment als ein Baustein primärer Präventionsarbeit gegen demokratiefeindliche Einstellungen und Verhaltensweisen verstanden.
Ebenso sind Kursleiter*innen an Volkshochschulen sowie Fachkräfte der Kinder-und Jugendhilfe Zielgruppe solcher Arbeitsansätze – sehen sie sich doch auch konfrontiert mit radikalen, teilsextremistischen Äußerungen im vhs-Kurs oder in öffentlichen Veranstaltungen. Indem vorhandene Fähigkeiten gekräftigt und bestehende Ressourcen freigesetzt werden, wird eine Stärkung der Pädagog*innen hinsichtlich ihrer Sprech- und Handlungsfähigkeit verfolgt.
Empowermentprozesse fokussieren somit sowohl junge Menschen als auch das pädagogische Personal von Bildungseinrichtungen. Zusätzlich müssen analoge und digitale Plattformen des Austausches einbezogen und auf die spezifischen Rahmenbedingungen eingegangen werden. Beide Zielgruppen sollten Möglichkeiten des Umgangs mit diskriminierenden Kommentaren im Netz und in Präsenz erlernen, wobei jede*r Einzelne als Multiplikator*in andere Personenstärken kann.
Im Rahmen des DVV-Fachaustausches werden unterschiedliche Ansätze des Empowerments exemplarisch thematisiert – hierbei werden sowohl die jeweiligen zielgruppenspezifischen Anforderungen als auch die entsprechenden digitalen und / oder analogen Kommunikationsmuster hervorgehoben.
-
26.11.2020
Die Veranstaltung wird vom Projekt "Prävention und Gesellschaftlicher Zusammenhalt" des Deutschen Volkshochschul-Verband e. V. organisiert. Sie richtet sich an Fachkräfte, die mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen arbeiten.
Wie können belastete Jugendliche durch traumapädagogische Interventionen, die gut in den Gruppen- oder Pflegefamilienalltag zu integrieren sind, unterstützt und stabilisiert werden? Welches Hintergrundwissen brauche ich, um bestimmte Verhaltensweisen richtig einordnen zu können und reflektiert und für den Jugendlichen förderlich auf die jeweiligen Situationen reagieren zu können? Wie sorge ich gut für mich selbst im täglichen Umgang mit traumatischen Erfahrungen und deren Folgestörungen?
Diesen und vielen weiteren, auch Ihren Fragen, widmet sich dieses Seminar.
-
19.11.2020
-
28.11.2020
Am 13./14. und / oder am 27./28.11.2020 findet in den Räumen des Landespräventionsrates in Hannover eine Fortbildung zum Programm PARTS (Programm zur Förderung von Akzeptanz, Respekt, Toleranz und sozialer Kompetenz) statt. Sie wird durch den Entwickler Prof. Dr. Andreas Beelmann von der Universität Jena selbst durchgeführt. Die Fortbildung wird in Kooperation mit dem Landespräventionsrat in Niedersachsen angeboten. Das Programm wurde über mehrere Jahre wissenschaftlich untersucht und erzielt vergleichsweise sehr gute Ergebnisse und Langzeitwirkungen. Nähere Informationen sind den Anlagen zu entnehmen.
Der Kurs richtet sich an Grundschullehrer*innen, Schulpsycholog*innen und Schulsozialarbeiter*innen aus Niedersachsen in dem Primarbereich (3. und 4. Klasse). Diese werden darin qualifiziert, das Programm eigenständig durchzuführen.
-
14.11.2020
Duldung "light", Beschäftigungsperspektiven und Bleiberechte, Abschiebehindernisse und Handlungsoptionen
Durch das sog. „Migrationspaket“, insgesamt neun verschiedene Gesetze im Bereich des Asyl-, Aufenthalts-und Migrationssozialrechts, sowie weitere Gesetze u.a. zu den Familienleistungen, sind auch für die Beratungsstellen, Frauenhäuser und die kommunale Sozialarbeit erhebliche Anforderungen an die Kenntnisse und die Handhabung im Bereich des Migrationsrechts entstanden. In der Praxis sind Konzepte erforderlich, die in komplexen und zugleich bedrohlichen Aufenthaltssituationen mehr Sicherheit in der Herangehensweise vermitteln. Anderseits müssen die verschiedenen Handlungsalternativen erkannt und abgewogen werden. Dazu gehört es auch, mögliche Strategien außerhalb der Rechtsschutzverfahren einzubeziehen. Das Seminar setzt grundlegende Kenntnisse in der Migrationssozialarbeit voraus und entwickelt an Hand vieler Lebenskonstellationen von geflüchteten Frauen Handlungsmöglichkeiten, aber auch Risiken in der Beratungsarbeit. In diesem Seminar wird ein besonderer Schwerpunkt auf interaktive Unterrichtsformen gelegt.
-
14.11.2020
Wie sehe ich mich selbst? Wie sehen mich andere? Wer möchte ich in Zukunft werden? Wo ist es mir wichtig, dazuzugehören? Und auf welche Zuschreibungen könnte ich gut verzichten?
Im Rahmen des anderthalbtägigen Workshops beschäftigen wir uns mit verschiedenen Bildern – Bilder, die ihr von Euch selbst habt und Bilder, die sich andere von Euch machen. Wir reden darüber, was diese Bilder bei uns bewirken, ob sie uns einengen oder beflügeln und wie wir diskriminierende, negative Bilder verändern können. Dann seid ihr gefragt: Im Verlauf des Workshops setzt ihr eigene künstlerische Ideen selbständig um – ob mit einer professionellen Kamera, Stift und Papier, Sprache oder dem Handy – und erstellt dadurch selbst neue Wunschbilder von Euch und anderen. Auf dem Weg werdet ihr begleitet von professionellen Fotograf*innen (Cameo Kollektiv e.V.) und Trainer*innen (G mit Niedersachsen, VNB e.V.). Den Abschluss bildet eine gemeinsam organisierte Wanderausstellung mit den Ergebnissen des Workshops, die in Lüneburg, Hannover und Göttingen zu sehen sein wird. Die Teilnahme ist kostenfrei.
Diskriminierende Parolen begegnen uns heute überall. Für pädagogische Kräfte ist dies eine besondere Herausforderung, weil es sie in vielfacher Weise treffen kann:
Kursteilnehmende provozieren Sie mit demokratiefeindlichen Parolen? Es gibt diskriminierende Sprüche unter Ihren Teilnehmenden? In der Dienstbesprechung fallen abschätzige Bemerkungen über die Ethnie bestimmter Kursteilnehmender? Sie selbst werden von Familienangehörigen für Ihr Engagement in der Arbeit mit Geflüchteten angegriffen? Im Freundeskreis äußert jemand offen seine Sympathie für rassistische Übergriffe? Sie gehören selbst einer von Rechten missachteten Gruppe an und sind häufig Beleidigungen ausgesetzt?
Wenn Sie sich in solchen Momenten sprachlos fühlen und sich nachher am meisten über sich selbst ärgern – nämlich darüber, dass Sie nichts gesagt oder getan haben – dann sind Sie in diesem interaktiven Workshop richtig.
Zunächst werden kurz Hintergründe diskriminierenden Denkens erläutert und typische Kommunikationsmuster dieser Parolen analysiert. Anschließend werden verschiedene Gesprächstechniken vorgestellt und ausprobiert. So können Sie für sich selbst passende Reaktionen entwickeln.
-
13.01.2021
Bildungsstätten und soziale Einrichtungen treten mit dem Anspruch an, Teilhabe und Partizipation zu erreichen. Tatsache ist aber, dass Exklusion dort besonders sichtbar wird. So zeigt die erziehungswissenschaftliche Migrationsforschung, dass Kita, Schule, Ausbildung und selbst Hochschule Unterschiede verstärken und konstruieren. Soziale Ungleichheitsverhältnisse werden so über Generationen hinweg gefestigt. Das gleiche Phänomen beobachten die Migrationsforschung sowie haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter/-innen in Beratungsstrukturen und sozialen Einrichtungen wie der Altenhilfe. Mit ihrem Engagement arbeiten sie dagegen an.
Themen & Termine:
11.11.2020
Ordnung-Macht-Bildung. Migrationspädagogische Sondierungen
Prof. Dr. Paul Mecheril, Universität Bielefeld
18.11.2020
Migration und Mehrsprachigkeit in der (frühen) Kindheit
Prof. Dr. Julie A. Panagiotopoulou, Universität zu Köln
25.11.2020
Schule in der Migrationsgesellschaft - Perspektiven auf die (Re-)Produktion institutioneller Ungleichheit
Aylin Karabulut, Universität Duisburg-Essen
09.12.2020
Das autorisierte Lehramt und Dokumente des Rassismus in der Lehrer*innenbildung
Dr. Aysun Doğmuş, Helmut-Schmidt-Universität Hamburg
06.01.2021
Soziale Arbeit in stationären Einrichtungen der Altenhilfe im Kontext von Migration
Domenica Licciardi, Supervisorin, Mediatorin | Moderation: Arthur Drewniok, HS Niederrhein
13.01.2021
Migrationsgesellschaftliche Differenzen am Übergang in die berufliche Bildung im Spannungsfeld von Diversity und Exklusion
Prof. Dr. Marc Thielen, Leibniz Universität Hannover
„Weltweit erstarken sowohl rechtspopulistische als auch extremistische Gedanken. Sowohl im Westen als auch im Osten herrscht ein gegenseitiger Hass auf die andere Seite. Viele Menschen fühlen sich dadurch verunsichert und bedroht in ihrer eigenen Freiheit. Statt Dialoge und Kommunikation, gibt es Ausgrenzungen, Hass und leider auch Gewalt. Es wirkt wie eine neue Ära des Rassismus.
Diesem tragischen Trend möchten wir, die Ahmadiyya Muslim Jamaat mit unserem Format einer Podiumsdiskussion Einhalt gebieten. Namhafte Gäste aus der Gesellschaft kommen virtuell zusammen, um über mögliche Lösungswege zu diskutieren, wie die Gesellschaft vom Rassismus befreit werden kann.
Gehört das schon zum Alltag in Deutschland? Jüdische Einrichtungen müssen besonders geschützt und von der Polizei bewacht werden. Wir denken auch an die schrecklichen rechtsextremen Gewalt- und Terrorakte in Halle, Hanau oder Kassel. Dazu kommen verstörende Ereignisse direkt vor unserer Haustür, wie jüngst der Vorfall bei der Heidelberger Burschenschaft Normannia, der viele Zweifel aufwarf, wie eng und wie tief deren Vernetzung in rechte Kreise tatsächlich ist. Nicht zu vergessen Drohschreiben des NSU 2.0 und kürzlich aufgedeckte rechtsextreme Chatgruppen in der Polizei in Nordrhein-Westfalen oder in der Polizeihochschule Villingen-Schwenningen.
Diese Ereignisse und Strukturen machen eines sehr deutlich: Vom Rechtsextremismus und rechten Netzwerken geht ein Gefahrenpotential aus, gegen das entschlossen vorgegangen werden muss. Das heißt: Die Sicherheit der Bürger*innen und der Schutz unserer demokratischen Verfassungsordnung vor rechter Gewalt und rechten Umtrieben muss Richtschnur allen staatlichen Handelns sein. Um diesen Schutz zu gewährleisten, braucht es eine "Kultur des Hinschauens" von jedem einzelnen und von staatlicher Seite.
-
07.11.2020
Das BfDT lädt Sie in Kooperation mit der Stadt Mainz herzlich ein, sich über diese und weitere Fragen auf der zweitägigen bundesweiten Veranstaltung im Stadthaus Mainz auszutauschen und Möglichkeiten des zivilgesellschaftlichen Engagements in der Radikalisierungsprävention zu erarbeiten."
Für die mehr als fünf Millionen jungen Neuzugewanderten in der Altersgruppe von 16 bis 25 Jahren, die in den vergangenen fünf Jahren in die EU bzw. innerhalb der Union migriert sind, stellt der Zugang zu Bildung eine entscheidende Weiche für den weiteren Lebensweg dar. Insbesondere die Berufsausbildung kann für die Zielgruppe zum Motor für Integration werden. Doch nicht selten gleicht der Weg in die Ausbildung einem Labyrinth aus komplexen Regularien, unterschiedlichen Zuständigkeiten und undurchschaubaren Unterstützungs-angeboten.
Aus diesem Grund hat der SVR-Forschungsbereich in einer groß angelegten Studie vergleichend untersucht, wie die Zugänge in die Berufsbildung in vier ausgewählten EU-Mitgliedsstaaten – Deutschland, Österreich, Slowenien und Spanien – gestaltet sind und verbessert werden können. Ein Fokus liegt auf der Situation in den Kommunen vor Ort und dem Handeln der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Behörden, Bildungsstätten und beratenden Organisationen. Diese übernehmen häufig die Rolle eines Wegweisers durch das Labyrinth und tragen letztendlich dazu bei, die Integration in die berufliche Bildung zu erleichtern. In der Studie werden Empfehlungen gegeben, wie sowohl Neuzugewanderte als auch Gatekeeper zielführend unterstützt werden können, um die Ausbildungsintegration zu erleichtern. Im Rahmen des Forschungsprojekts wurde bereits im Januar 2020 der Policy Brief „Zugang per Zufallsprinzip? Neuzugewanderte auf dem Weg in die berufliche Bildung“ veröffentlicht.
Die Ergebnisse der Anfang November erscheinenden Studie möchten wir Ihnen bei der digitalen Veranstaltung „Heraus aus dem Labyrinth! Wie kann die Integration von neuzugewanderten Jugendlichen und jungen Erwachsenen in das Berufsbildungssystem gelingen?“ vorstellen, zu der wir Sie herzlich einladen.
-
04.11.2020
Oktober 2020
-
31.10.2020
Neben dem geplanten Rahmenprogramm aus Workshops, Lesungen & Dialogen mit Politiker*innen, werden die Teilnehmenden genug Raum haben, um ihre eigenen Themen einzubringen. Platz dafür ist in den sogenannten Sessions. Hier können sie eigene Themen und/oder Formate anbieten. Ob Diskussion über Fridays for Future, Rassismus, globale Ungleichheit oder die Europäische Union - den Teilnehmenden stehen alle Themen frei!
-
27.10.2020
-
23.10.2020
Das Seminar richtet sich an Fachkräfte aus den psychosozialen Arbeitsfeldern, die mit traumatisierten Frauen mit Fluchterfahrung arbeiten und sich mit Störungen und Konflikten konfrontiert sehen.
Es gibt Situationen, wo eine Beratung oder Begleitung ins Stocken gerät. Innere und/oder äußere Störungen, die gerade in der Arbeit mit traumatisierten Frauen als sehr belastend erlebt werden, wie z.B. Wut oder Lärm werden nicht ernst genommen und führen zu einem Konflikt. Oder es gibt (Meinungs-)verschiedenheiten, die zu Konflikten führen können, wenn Sie nicht beachtet oder gar negiert werden. Jede, die arbeitet, kennt Störungen und Konflikte. Sie gehören zum Alltag dazu, treten in angespannten Situationen aber vermehrt auf.
In diesem Seminar gehen wir der eigenen „Störanfälligkeit“ auf die Spur. Wenn ich diese kenne, kann ich Störungen ernst nehmen und bearbeiten, und somit vermeiden, dass sie zu innerlichen oder äußerlichen Konflikten werden.
-
10.10.2020
Gut oder böse? Wahrheit oder Fake? „Männlich” oder “weiblich”? Mit oder ohne “Migrationshintergrund”? Hinter dem Stichwort „Ambiguitätstoleranz“ (auch: Widerspruchstoleranz) verbirgt sich die Fähigkeit, Mehrdeutigkeiten auszuhalten und anzuerkennen. Menschen, die das gut können, fällt es leichter, unterschiedliche politische, religiöse oder gesellschaftliche Überzeugungen und Lebenseinstellungen anzuerkennen. Sie kommen besser damit klar, dass es keine absoluten Wahrheiten gibt, sondern viele unterschiedliche Perspektiven, die sich zwar teilweise widersprechen können, aber doch mit gleicher Wahrscheinlichkeit gültig sind. Merkmale für eine auffallend geringe Ambiguitätstoleranz sind hingegen u. a. Wahrheitsobsession, Geschichtsverneinung und Reinheitsstreben.
Im IDA-Training möchten wir mit den Teilnehmenden die Fähigkeit trainieren, mit Widersprüchen und Uneindeutigkeiten in der eigenen Bildungsarbeit umzugehen. Im Mittelpunkt steht dabei die Gesprächsmethode und Haltung Mahloquet. Sie ist der jüdischen Tradition entnommen und wurde für den deutschen Kontext von Leah Carola Czollek und Gudrun Perko weiterentwickelt. Mittlerweile wird sie erfolgreich in Bereichen der Konfliktlösung, der Mediation, der Erwachsenenbildung und Lehre sowie im Social Justice und Diversity-Training angewandt. Mit Hilfe dieser Methodik widmen wir uns folgenden Fragen: Wie lässt sich Ambiguitätstoleranz erkennen? Was bedeutet sie für die eigene Kinder- und Jugendarbeit? Wie lässt sich das Konzept vermitteln? Wie hängt Ambiguitätstoleranz mit Diskriminierung sowie rechtsextremen und -populistischen Einstellungen zusammen und was bedeutet das für deren Prävention?
-
11.10.2020
Sie arbeiten mit (jungen, d.h. unter 30–jährigen) Geflüchteten, Migrant*innen und Asylbewerber*innen und/oder engagieren sich ehrenamtlich in diesem Kontext? Sie sind so aktiv eingebunden, dass Sie oft keine Zeit haben, gezielt über Ihre Arbeit nachzudenken? Sie würden sich gerne mit anderen austauschen, neue Ideen und Ansätze kennenlernen und sich Zeit zur Reflexion nehmen? Dann ist unser Trainingsangebot genau das richtige für Sie!
Mit den Wochenendseminaren zum Thema »Arbeit mit Geflüchteten, Migrant*innen und Asylbewerber*innen« möchte JUGEND für Europa Organisationen und Personen, die mit dieser Zielgruppe arbeiten, unterstützen und den fachlichen Austausch fördern. Die Trainingsreihe knüpft an das europäische Netzwerkprojekt »Becoming a part of Europe« an.
Die nationalen Trainings finden in unterschiedlichen Regionen Deutschlands statt und beschäftigen sich mit folgenden Inhalten:
- Gelegenheit zum Austausch mit anderen Menschen, die ebenfalls mit der Zielgruppe arbeiten
- Reflexion der eigenen Rolle und Motivation
- Eigene Grenzen besser einschätzen und mit schwierigen Situationen besser umgehen lernen, u.a. Reflexion der Arbeit mit der Zielgruppe unter den aktuellen Bedingungen (COVID-19)
- Neue Ressourcen und Unterstützung für diese Arbeit finden; Netzwerke knüpfen und nutzen
- Transfer in die Praxis: ggf. Ideen und lokale/regionale Projekte gemeinsam planen und umsetzen
- Interkulturelle Sensibilisierung
Persönliche und gesellschaftliche Krisen beeinträchtigen die individuelle Entwicklung und den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Sie beeinflussen das Selbstverständnis und begünstigen polarisierenden Einstellungen und Orientierungen.
Kinder erleben ebenso wie erwachsene Menschen Krisen. Aktuell sind es zum Beispiel die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie, die tief in die Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen eingreifen. Abrupte Veränderungen führen zu erhöhten gesellschaftlichen Anforderungen und gehen oftmals mit diversen Belastungen einher. Gerade Kinder und Jugendliche in benachteiligten Lebenslagen sind davon betroffen.
Resilienz ist eine notwendige Ressource zur Krisenbewältigung. Für eine gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen ist das Erlernen und Ausprobieren von Krisenbewältigungsstrategien ein wichtiger Schritt. Der Fachtag stellt die Lebensrealitäten rassismuserfahrener und sozialbenachteiligter Kinder und Jugendlicher in den Fokus und fragt nach den besonderen Herausforderungen, die sich in der rassismuskritischen Bildungsarbeit stellen. Er konzentriert sich auf Resilienzförderung im Schulkontext und bietet Raum für den Erfahrungsaustausch von Fachkräften.
Wie kann Resilienzförderung in der Schule gestaltet werden und welchen Einfluss hat das Lehrer*innen-Schüler*innen-Verhältnis auf die Entwicklung von Resilienz? Welche Rolle spielt Resilienzförderung in der Präventionsarbeit und beim Umgang mit Polarisierung? Wie kann mit Krisen im Schulkontext umgegangen werden und wie können Betroffene begleitet werden?
Diesen Fragen geht der Fachtag auf den Grund. Er wendet sich an Multiplikator*innen aus der schulischen und außerschulischen Praxis sowie an Akteur*innen aus Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft und wird von der ufuq.de-Fachstelle für Pädagogik zwischen Islam, antimuslimischem Rassismus und Islamismus durchgeführt.
-
09.10.2020
Fachtag zu Geschichte, Stereotypen, Kultur und Verstärkung von Roma und Sinti in Dresden und Sachsen
Wie leben Sinti und Roma heute? Die Lebenssituation von Roma und Sinti ist sehr unterschiedlich und ihr Alltag hat viele Gesichter. In Deutschland leben sie seit mehr als 600 Jahren. In Sachsen stehen sie meist vor den Herausforderungen, welche die Migration aus der Europäischen Union und den ehemaligen jugoslawischen Staaten mit sich bringt.
EU-Bürger*innen aus der Slowakei, Rumänien, Bulgarien und Tschechien ziehen nach Sachsen und arbeiten hier oft unter prekären Bedingungen. Sie treffen auf Behörden und Verwaltung, ihre Kinder werden Teil von Schule und Vereinslandschaft. Roma aus dem ehemaligen Jugoslawien suchen dagegen Schutz und leben unter den Bedingungen des Asylrechts. Auch sie sind Teil der Gesellschaft, aber mit der Angst und Realität von Abschiebungen konfrontiert. Alle Roma und Sinti erfahren Diskriminierung und werden mit Stereotypen konfrontiert.
Daher ist der Fachtag "SEHEN und SPRECHEN auf AUGENHÖHE" ein Anfang, Herausforderungen zu benennen, Fragen zu beantworten, Wissen zu vermitteln um dem spezifischen Rassismus gegenüber Roma und Sinti zu begegnen. Eingeladen sind lokale und überregionale Expert*innen. Durch die Kooperation mit den Selbstvertretungen der Roma und Sinti ist fachliche, aber auch persönliche Expertise Teil des Fachtags. Das zweitägige Programm wendet sich an Multiplikator*innen aus der Verwaltung und der Sozialen Arbeit, an Lehrer*innen, Erzieher*innen, Studierende der Dresdner Hochschulen, außerdem an Journalist*innen und Lokalpolitiker*innen.
-
08.10.2020
Am 8. Oktober 2020 findet der gemeinsame Fachtag „Antisemitismus 2.0 – Hass. Hetze. Handeln.“ des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg und der Israelitischen Religionsgemeinschaft Baden in der Jüdischen Gemeinde in Mannheim statt.
Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl vor Ort wird der Fachtag live auf dem YouTube-Kanal der Polizei Baden-Württemberg gestreamt, um allen interessierten Personen auf diesem Wege eine Teilnahme zu ermöglichen.
-
08.10.2020
Die Veranstaltung wird durch das Projekt Prävention und Gesellschaftlicher Zusammenhalt organisiert. Der Fokus der Projektarbeit liegt auf der Vermittlung von Methoden der Radikalisierungsprävention. Veranstaltungen richten sich hauptsächlich an Fachkräfte, die mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen arbeiten.
Zielgruppe der Veranstaltung sind vhs-Mitarbeiter*innen, Respekt Coaches und Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe.
-
07.10.2020
Das Online-Seminar möchte sich mit der Bedeutung des Kindeswohls im Spannungsfeld der Jugendhilfe und des Ausländerrechts auseinandersetzen. Zentral soll es um die Fragen gehen: Welche Kindeswohlaspekte müssen von wem berücksichtigt werden? Was ist zu beachten, wenn eine „freiwillige“ Ausreise oder gar Abschiebung von Minderjährigen im Raum steht? Unter welchen Voraussetzungen können unbegleitete Minderjährige (UMA) abgeschoben werden? Welche Rollen und Aufgaben haben die involvierten Fachkräfte der Jugendhilfe? In welchem rechtlichen Rahmen dürfen Jugendhilfeeinrichtungen durch Polizei betreten und/ oder durchsucht werden?
Referentin: Susanne Achterfeld, LL.M./ Referentin für Kinder- und Jugendhilferecht/ Asyl- und Ausländerrecht beim Deutschen Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e. V. (DIJuF)
Zielgruppe sind vorrangig Vormund*innen und Fachkräfte der Träger der freien und öffentlichen Jugendhilfe in Thüringen sowie weitere Fachkräfte und Interessierte aus Thüringen.
-
06.10.2020
Aufgrund der aktuellen Situation und der Covid19-Hygienevorschriften wird die diesjährige BKMO als „Hybridveranstaltung“ stattfinden. Das bedeutet, dass alle aktiv digital teilnehmen können – über einen Live-Stream und über Chat und eigenes Video/Mikrofon. Gleichzeitig gibt es eine begrenzte Anzahl an Plätzen vor Ort im VKU-Forum in Berlin. Wir hoffen, so möglichst vielen von Euch und Ihnen eine Teilnahme ermöglichen zu können!
Die 5. BKMO steht im Lichte der anstehenden Wahlen zum neuen Vertreter*innenrat (VR) und der Berichte darüber, was im letzten Jahr auf der politischen und inhaltlichen Ebene alles gelaufen ist: Die Arbeit innerhalb der AGs genauso wie die politischen Interessenvertretung des VR. Insgesamt konnte sich die BKMO verstärkt als Ansprechpartnerin gegenüber Politik und Verwaltung etablieren – das gibt viel Mut und Motivation für unsere weitere gemeinsame Arbeit und wir freuen uns auf das Wiedersehen – ob digital oder sogar persönlich in Berlin!
-
06.10.2020
Fünf Jahre ist es her, dass eine große Zahl von Menschen auf der Flucht nach Deutschland kam. Neben Fragen des Zugangs zu Bildung, Arbeitsmarkt und Wohnraum, geht es nun verstärkt um die weitere Ausgestaltung der Einwanderungsgesellschaft im Sinne gleichberechtigter Teilhabe. Eine Zäsur war die Corona-Pandemie Anfang diesen Jahres, die die Sollbruchstellen im Integrationsprozess und die prekäre Lage vieler Geflüchteter sehr deutlich gemacht hat.
Während den digitalen Fachtagen wollen wir die Herausforderungen gelingender Partizipation nachzeichnen. Außerdem laden wir zum Netzwerken und Zusammenfinden mit Fachleuten und Engagierten aus Deutschland und anderen europäischen Ländern ein.
-
02.10.2020
Wer hat die Macht im Netz und wie können wir selbstbestimmt in einer digitalisierten Gesellschaft leben? Wie beeinflussen Plattformen wie YouTube und deren Algorithmen unser Leben und politische Meinungen? Wie schreiben sich diskriminierende Muster im Digitalen fort? Welche Auswirkungen hat Rassismus auf Demokratie und digitale Beteiligungsmöglichkeiten? Die Digitalisierung wirft viele gesellschaftliche Fragen auf, doch wie kann und muss sich politische Bildung auf diesen Wandel einstellen?
Die Niedersächsische Landeszentrale für politische Bildung und die Bundeszentrale für politische Bildung laden zu einer zweitägigen Veranstaltung ein. Gemeinsam möchten wir die wechselvollen Beziehungen zwischen politischer Bildung und digitaler Gesellschaft mit ihren Höhen und Tiefen erkunden und durchleuchten. Im Mittelpunkt steht die außerschulische Jugend- und Erwachsenenbildung, wobei Beiträge und Perspektiven von Gästen aus unterschiedlichen (Fach-)Kontexten eine möglichst diversitätssensible Annäherung ermöglichen – ganz nach dem Motto: verstehen. hinterfragen. gestalten. Die Tagung greift verschiedene Themenschwerpunkte und Beispiele aus der Bildungs- und Medienpraxis auf, um Zusammenhänge zwischen Politik, Medien, Medienkompetenz, Bildung und (digitaler) Gesellschaft sichtbar zu machen.
Die Veranstaltung findet entsprechend der aktuellen Coronaauflagen in Niedersachsen als Präsenzveranstaltung vor Ort statt. Eine digitale Teilnahme an der Veranstaltung ist ebenfalls möglich.
September 2020
"Im Rahmen des Kooperationsprojekts "Kinder schützen - Strukturen stärken! Kinderschutzstandards in Unterkünften für geflüchtete Menschen" haben Save the Children und Plan International das Heidelberger SOCLES Institut mit der Erstellung einer Expertise zur bundesweiten Situation von Kindern in Unterkünften für geflüchtete Menschen beauftragt.
Anlässlich der Publikation der Expertise möchten wir mit Vertreter*innen aus Verwaltung und Politik sowie aus der Praxis der Kinder- und Jugendhilfe bestehende Handlungskonzepte und -empfehlungen reflektieren. Zugleich wollen wir gemeinsam neue Handlungsideen für die Zukunft entwickeln.
Sie sind herzlich eingeladen mit dem Autor Herrn Dr. Thomas Meysen und den Teilnehmer*innen der Gesprächsrunde mitzudiskutieren."
-
29.09.2020
-
02.10.2020
Auch bereits vor der gesetzlichen Verpflichtung haben zahlreiche zuständige Landesbehörden oftmals im Zusammenwirken mit Trägern der Freien Wohlfahrtspflege, zivilgesellschaftlichen Akteuren und engagierten Praktiker*innen vielfältige Maßnahmen für den Schutz von geflüchteten Menschen in Flüchtlingsunterkünften erprobt und implementiert. Immer mehr Bundesländer und Kommunen bündeln Schutzmaßnahmen in Schutzkonzepte, die den Anspruch haben, Gewaltschutz fest im tagtäglichen Umgang mit geflüchteten Menschen in Unterkünften zu verankern.
Doch wie steht es aktuell tatsächlich um den Gewaltschutz in Unterkünften für geflüchtete Menschen? Welche konkreten Maßnahmen zur Umsetzung des Gewaltschutzes wurden auf Landes- und kommunaler Ebene auf den Weg gebracht, welche haben sich bewährt? Welche weiteren Handlungsbedarfe und Anknüpfungspunkte auf kommunaler und Länderebene bezüglich des Gewaltschutzes in Unterkünften für geflüchtete Menschen lassen sich erkennen?
Auf der Fachveranstaltung nehmen wir die jüngsten Entwicklungen und gewonnenen Erfahrungen seit Einführung der neuen Regelungen im Asylgesetz in den Fokus. Ziel ist es, Vertreter*innen der zuständigen Behörden, der Praxis und der Zivilgesellschaft in einen konstruktiven Austausch zu bringen.
In NRW gibt es eine breite Arbeit im Kontext Migration: Von den Kommunalen Integrationszentren über die Integrationsagenturen, den Migrationsberatungsstellen oder dem vielfältigen haupt- oder ehrenamtlichen Engagement in Selbstorganisationen migrantischer und rassismuserfahrener Menschen.
Menschen mit Rassismuserfahrung, Migrationsbiografie und Fluchterfahrung erleben Verletzungen und Ausschlüsse durch ihre multiplen Identitäten. Es kommt zu Mehrfachdiskriminierungen, d.h. Menschen erleben z.B. Diskriminierungen aufgrund von Herkunft, sexueller Identität, sozialem Geschlecht, Körperform und Be_hinderungen. Diese Mehrfachdiskriminierungen müssen in den Queeren Strukturen mitgedacht werden.
-
29.09.2020
Passend zum Schwerpunktthema und den Entwicklungen der Corona-Pandemie geschuldet wird der 25. DPT-Jubiläumskongress am 28. & 29. September 2020 eine rein digitale Onlineveranstaltung sein. Das umfangreiche Kongressprogramm der ursprünglich im Kasseler Kongress Palais geplanten Präsenzveranstaltung wird in vier unterschiedlichen Formaten dargeboten.
Hintergrund zum Schwerpunktthema: Die Digitale Revolution verändert unseren Alltag und das Zusammenleben der Menschen grundlegend. Direkte Auswirkungen auf die Gewalt- und Kriminalprävention sind offenkundig. Neue Phänomene entstehen, die neuer Antworten bedürfen. Etablierte Einschätzungen – von der strafrechtlichen Einordnung bis hin zur passenden Präventionsstrategie – stehen an vielen Stellen (noch) nicht zur Verfügung. Vieles ist offen, womit Unsicherheiten und Ängste einhergehen. Auch diverse Chancen ergeben sich, die es zu erkennen und zu nutzen gilt. Somit ist es spürbar an der Zeit, dass sich der Deutsche Präventionstag der Prävention in der digitalen Welt ausführlich widmet, um sich einer Vision von „Smart Prevention“ anzunähern.
-
29.09.2020
Für junge Geflüchtete, die nach Deutschland kommen, hat sich in den letzten Jahren viel verändert. Ankunftszahlen, Hilfelandschaft und die rechtlichen Voraussetzungen unterliegen einem starken Wandel. Besonders in Hinblick auf die veränderten gesetzlichen Regelungen zur Identitätsklärung stehen die Betroffenen und Fachkräfte in Jugendhilfe und Asylsozialberatung vor Herausforderungen. Mit einem gemeinsamen Fachtag wollen der Bundesfachverband unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die Münchner Mentoren und der Münchner Flüchtlingsrat einen Überblick über die neue Situation geben und Austausch zu Problemen sowie eine stärkere Vernetzung der Akteur*innen ermöglichen.
-
05.11.2020
Am 22.09.2020 findet im Rahmen des Projektes DeBUG die erste von vier Online-Fortbildungen zum Thema "Häusliche Gewalt im Kontext von Flucht" statt. Die Fortbildung wird in Kooperation der Kontaktstelle DeBUG Niedersachsen und Bremen und BIG e.V. durchgeführt. Sie richtet sich insbesondere an Mitarbeiter*innen in den Gemeinschaftsunterkünften und Erstaufnahmeeinrichtungen in Niedersachsen und Bremen.
Darüber hinaus findet am 05.11.2020 eine Online-Fortbildung zum Thema "Geflüchtete mit Behinderung – ihre Rechte, Zugang zu Gesundheitsversorgung, Arbeit und Bildung" statt. Die Fortbildung wird von der Kontaktstelle DeBUG Niedersachsen und Bremen in Zusammenarbeit mit dem Caritasverband für die Diözese Osnabrück und dem IvAF-Projekt Netwin 3 angeboten. Sie richtet sich vorrangig an Mitarbeiter*innen in Erstaufnahmeeinrichtungen, Gemeinschaftsunterkünften und Beratungsangeboten für Geflüchtete in Niedersachsen und Bremen.
-
22.09.2020
Im August 2019 trat das sogenannte "Geordnete Rückkehr-Gesetz" in Kraft. Ausweislich der Gesetzesbegründung wollte der Gesetzgeber damit „im Bereich der Rückkehr eine stärkere Durchsetzung des Rechts“ erreichen, da eine große Zahl ausreisepflichtiger Personen weiterhin in der Bundesrepublik bleibe. Nach gut einem Jahr ist es an der Zeit für eine erste Bilanz: Neben der Ausweisung von Straftätern werden die Auswirkungen der neuen Duldung bei ungeklärter Identität und die Neuordnung der Vorbereitungs-, Sicherungs- und Abschiebungshaft diskutiert.
Die Tagung blickt zudem über die zahlreichen Neuregelungen des "Zweiten Gesetzes zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht" hinaus und wendet sich den allgemeinen rechtlichen Grundfragen der Aufenthaltsbeendigung zu. Dabei wird auch der Frage nachgegangen, ob und inwieweit die gesetzlichen Regelungen geeignet sind, um die Ausreisepflicht durchzusetzen, scheitert diese doch oftmals an fehlenden Kapazitäten - sei es in den für die Umsetzung zuständigen Behörden, sei es bei der Organisation der Ausreise als solcher.
Derzeit planen wir mit einer Vor-Ort-Durchführung der Tagung in Speyer, bieten aber auch die Möglichkeit an, sich online zuzuschalten. Eine Umstellung auf eine vollständige Online-Durchführung bleibt für den Fall einer pandemiebedingten Notwendigkeit vorbehalten.“
-
19.09.2020
Wie sehe ich mich selbst? Wie sehen mich andere? Wer möchte ich in Zukunft werden? Wo ist es mir wichtig, dazuzugehören? Und auf welche Zuschreibungen könnte ich gut verzichten?
Bald ist es soweit und der erste Workshop des Modellprojekts me, myself and the others startet in Lüneburg. In diesem setzen sich junge Menschen mit und ohne Flucht-/Migrationserfahrungen mit Selbst- und Fremdbildern, Diskriminierungen und (rassistischen und geschlechtlichen) Zuschreibungen auseinander, fotografieren, schreiben und gestalten Graphiken unter der Begleitung von Trainer*innen des cameo kollektivs und G mit Niedersachsen (VNB e.V.). Die entstandenen Werke münden in einer Wanderausstellung, die in Hannover, Göttingen und Lüneburg zu sehen sein wird.
-
27.11.2020
Was ist Rechtspopulismus? Was Neonazismus? In der Workshopreihe wird sich mit Organisationen sowie deren politischen Zielen, Aktionsformen und Strategien, sich im öffentlichen Raum Gehör zu verschaffen beschäftigt, inkl. einem Blick auf Aktivitäten der extremen Rechten in der Corona-Pandemie. Zudem
Sachsen hat ein massives Problem mit rechten, asyl- und menschenfeindlichen Einstellungen. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ermutigt ihre Mitglieder sich auch in Ausbildung, Studium, Unterricht oder Kollegium als Teil der Zivilgesellschaft aktiv und offen für Demokratie, Zivilcourage und Gleichberechtigung aller Menschen und gegen Diskriminierungen zu positionieren.
Im Nachgang der Landtagswahlen wurde die letztjährige Workshopreihe „Sicher Argumentieren gegen Rechts“ überarbeitet und eine neue, nun digitale Weiterbildungsreihe zusammengestellt, um Aktive und Interessierte im Umgang mit Rechtspopulismus und Neonazismus insbesondere in Schule, Kita und Kollegium sowie bei öffentlichen Veranstaltungen fit zu machen.
-
19.09.2020
-
12.09.2020
Wie sehe ich mich selbst? Wie sehen mich andere? Wer möchte ich in Zukunft werden? Wo ist es mir wichtig, dazuzugehören? Und auf welche Zuschreibungen könnte ich gut verzichten?
Bald ist es soweit und der erste Workshop des Modellprojekts me, myself and the others startet in Lüneburg. In diesem setzen sich junge Menschen mit und ohne Flucht-/Migrationserfahrungen mit Selbst- und Fremdbildern, Diskriminierungen und (rassistischen und geschlechtlichen) Zuschreibungen auseinander, fotografieren, schreiben und gestalten Graphiken unter der Begleitung von Trainer*innen des cameo kollektivs und G mit Niedersachsen (VNB e.V.). Die entstandenen Werke münden in einer Wanderausstellung, die in Hannover, Göttingen und Lüneburg zu sehen sein wird.
-
10.09.2020
An Religion scheiden sich die Geister: Sie ist Ressource, Identität und Gemeinschaft, aber auch Ausdruck von Differenz. Pluralistische Gesellschaften setzen sich in vielfältigen Aushandlungsprozessen mit Religion auseinander. Die sich dabei ergebenden Konflikte sind an sich nichts Negatives, werfen aber wichtige Fragen für den Zusammenhalt der Gesellschaft auf. Gleichzeitig stehen sie für erweiterte Möglichkeiten, die Gesellschaft zu gestalten.
Die Veranstaltung verbindet wissenschaftliche Diskurse von Demokratie und Religion in pluralistischen Gesellschaften mit (Streit-)Gesprächen über lebensweltliche Facetten von Religiosität, um schließlich über praktische Erfahrungen aus der Bildungsarbeit, interreligiösem Dialog und Prävention ins Gespräch zu kommen. Sie wendet sich an Praktiker*innen aus der schulischen und außerschulischen Bildungs- und Jugendarbeit sowie an Haupt- und Ehrenamtliche aus Gemeinden und interreligiösem Dialog und versteht sich als Beitrag zum Fachaustausch zur Bildungsarbeit im Kontext von Grundrechten, Demokratie, Diversität, Polarisierung und religiösem Extremismus.
Rassismus und Kolonialismus sind aufs Engste miteinander verwoben. Die deutsche Kolonialherrschaft über Teile Afrikas, Chinas und Ozeaniens wurde – wie koloniale Fremdherrschaft insgesamt – durch eine rassistische Ideologie gerechtfertigt. Dass eine wirklich kritische Auseinandersetzung mit unserem kolonialen Erbe mitsamt dessen Denktraditionen bisher weitestgehend vermieden wurde, bildet einen Nährboden für Rassismus bis heute. Eine echte Dekolonisierung ist Voraussetzung dafür, dass wir Rassismus verlernen.
Gemeinsam mit unseren Gästen wollen wir einen Blick auf die Wirkmächtigkeit (post-)kolonialer Strukturen werfen. Neben einem kritischen Umgang mit (post-)kolonialen Spuren im öffentlichen Raum wollen wir dabei auch der zeithistorischen Entwicklung des Rassismus nachgehen, der von den Kolonialmächten als moralische Legitimierung der Ausbeutung, Vertreibung und Ermordung der Kolonisierten entwickelt wurde. Wir wollen fragen, wie diese (post-)kolonialen Strukturen auch heute rassistische Denkmuster unterfüttern und sogar befeuern. Wo bestehen Lücken in der Aufarbeitung des kolonialen Erbes und wie können wir nachhaltig (post-)koloniale und rassistische Denkmuster erkennen, aufbrechen und verändern? Denn eine kritische, multiperspektivische und intersektionale Auseinandersetzung mit dem kolonialen Erbe ist ein zentraler Baustein einer wirksamen antirassistischen Politik.
-
04.09.2020
Das Psychoziale Zentrum für MigrantInnen in Sachsen-Anhalt lädt zu einem Fachforum zur Versorgung psychisch erkrankter Geflüchteter in Magdeburg ein.
Die Veranstaltung ist in zwei Teile gegliedert:
Teil I: Herausforderungen, Meilensteinen und Chancen transkultureller, dolmetschergestützter Therapie
Vortrag von und Diskussion mit Frau Gülay Akgül (leitende Ärztin des Zentrums für transkulturelle Psychiatrie und Psychotherapie am Klinikum Wahrendorff)
Teil II: Moderiertes Austausch-Forum
zu vorgebrachten Umsetzungsbedarfen, wie z.B. den Besonderheiten der „Therapie zu Dritt“, der Akquise geeigneter Dolmetscher*innen und der Kostenübernahme
-
03.09.2020
August 2020
-
29.08.2020
Wie sehe ich mich selbst? Wie sehen mich andere? Wer möchte ich in Zukunft werden? Wo ist es mir wichtig, dazuzugehören? Und auf welche Zuschreibungen könnte ich gut verzichten?
Bald ist es soweit und der erste Workshop des Modellprojekts me, myself and the others startet in Lüneburg. In diesem setzen sich junge Menschen mit und ohne Flucht-/Migrationserfahrungen mit Selbst- und Fremdbildern, Diskriminierungen und (rassistischen und geschlechtlichen) Zuschreibungen auseinander, fotografieren, schreiben und gestalten Graphiken unter der Begleitung von Trainer*innen des cameo kollektivs und G mit Niedersachsen (VNB e.V.). Die entstandenen Werke münden in einer Wanderausstellung, die in Hannover, Göttingen und Lüneburg zu sehen sein wird.
In einem Onlineseminar wollen wir rechtliches Hintergrundwissen zur Begleitung von Personen bei Behördengängen vermitteln, die Rolle der begleitenden Person reflektieren und über den Umgang mit Wut und Ohnmacht diskutieren. Daraus werden wir einige Ansatzpunkte zum überlegten Handeln in Begleitsituationen ableiten und Handlungsstrategien erarbeiten.
Das Webinar richtet sich an Fachkräfte, die im Bereich Flucht und Migration tätig sind und ihre eigene Arbeit reflektieren wollen. Ziel ist es einen Austausch über bestehende rassistische Strukturen in unserer Gesellschaft anzuregen und die hieraus resultierenden Auswirkungen auf die Arbeit mit Geflüchteten aufzuzeigen.
Anfang 2020 brachte ufuq.de die Broschüre „Anregungen für eine diversitätsorientierte Pädagogik im Kontext von Islam in der Grundschule“ heraus.
In diesem Webtalk stellen sie die Publikation vor und diskutieren praxisnahe Anregungen: Wie können Eltern als Akteur*innen in den Schulalltag eingebunden werden? Welche Ideen gibt es für den Umgang mit Diversität, und welche Rolle spielt Religion in Alltag und Unterricht? Abschließend können Fallbeispiele aus der Rubrik „Und wenn’s mal knirscht …“ besprochen werden. Ziel des Webtalks ist es, Grundschullehrkräfte und pädagogische Mitarbeiter*innen in ihrem diversitätsorientierten Handeln bei (schulischen) Herausforderungen zu stärken.
Anmeldung bis 10.08.2020: julia.schwieder@ufuq.de
Juli 2020
-
30.07.2020
-
07.08.2020
Seit 1983 findet in Dachau jeden Sommer die Internationale Jugendbegegnung statt. Sie wurde von jungen Menschen aus Dachau und Umgebung gegründet. Jugendliche aus verschiedenen Ländern beschäftigen sich dort mit der Geschichte des Konzentrationslagers Dachau, dem Nationalsozialismus und heutigen Formen von Ausgrenzung, Rassismus und Diskriminierung. Am Ort des früheren Konzentrationslagers suchen sie gemeinsam nach Antworten auf Fragen der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.
Begleitet werden die Jugendlichen von einem Team meist ehrenamtlicher Mitarbeiter. Viele Überlebende der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft berichten in persönlichen Gesprächen über ihre Erfahrungen während der Verfolgung, in Konzentrations- und Arbeitslagern oder im Widerstand.
Die 38. Internationale Jugendbegegnung Dachau findet statt vom 25. Juli – 07. August 2020 im Max Mannheimerhaus in Dachau.
Die Teilnahme ist im Alter zwischen 16 und 26 Jahren möglich. Die Sprache während des Programms der Internationalen Jugendbegegnung ist Englisch. Die Teilnahmegebühren betragen 300,-€. Die Unterbringung erfolgt im Max Mannheimer Haus Dachau.
In der Online-Podiumsdiskussion werden drei Expertinnen miteinander über Ausprägungen und Auswirkungen des Antiziganismus in verschiedenen historischen Zeiträumen in der BRD und der DDR aber auch über seine heutige Aktualität ins Gespräch kommen. Anlass ist die Veröffentlichung des 7. Bandes der Schriftenreihe „Wissen schafft Demokratie“ mit dem Schwerpunkt „Kontinuitäten“. In diesem Band haben Katharina Lenski den Beitrag „Stereotype im Langzeitnarrativ: Sinti in der DDR zwischen Ausgrenzung und Selbstbehauptung“ und Laura Hankeln den Artikel „Antiziganistische Kontinuitäten in der Debatte um eine baden-württembergische „Landfahrerordnung“ nach 1945“ beigetragen. Sie werden kurz jeweils zentrale Punkte ihrer historischen Analysen vorstellen. Anja Reuss wird als politische Referentin des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma kurz zur aktuellen Situation referieren. Daniel Geschke vom IDZ wird das Gespräch und die anschließende Diskussion von Fragen aus der Zuhörer*innenschaft moderieren.
-
10.07.2020
-
07.07.2020
Es geht um die Vermittlung von Basiswissen zum Thema Sucht und Substanzen, verbunden wird dies mit einem Blick auf die Besonderheiten der Lebensverhältnisse von Menschen mit Fluchterfahrung und einem transkulturellen Verständnis. U.a. beschäftigt sich der Workshop mit folgenden Fragen:
- Wann fängt Sucht an?
- Welche gängigen Subtanzen werden konsumiert und wie können diese wirken?
- Wie verhalte ich mich kultursensibel und Grenzen wahrend als Unterstützer*in?
- Welche Anlaufstellen gibt es?
Juni 2020
How do cities manage the arrival and settlement of immigrants? This question is discussed by the Canadian journalist Douglas Saunders in his book “Arrival City: How the largest Migration in History is Reshaping Our World”, published in 2011. In his book, Saunders lays out the conditions for success and failure of immigration-defined neighbourhoods around the world. He argues that “arrival city” districts are self-contained economic and social structures intimately tied to their “sending” villages and neighbourhoods, defined by low housing costs and communities of mutual support. In his current work in Europe, he is examining how housing and labour markets can transform these districts into “social-mobility traps” in successive generations, and how communities can organize to improve their outcomes.
In his lecture, jointly organized by the Leibniz Institute for Research on Society and Space and the Humboldt-Universität zu Berlin, Saunders discusses policy and community implications of this work.
-
23.06.2020
Das diesjährige Symposium findet digital statt und steht im Zeichen dreier Ereignisse:
Die Europäische Menschenrechtskonvention wird 70 Jahre alt und steht erheblich unter Druck. Sie ist im Flüchtlingsschutz, aber auch für Demokratie und Minderheitenrechte in ganz Europa unverzichtbar, was es umfassend zu würdigen gilt. Dabei werden auch die derzeitigen Herausforderungen in Umsetzung der Urteile und Reformbestrebungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte beleuchtet.
Weiterhin steht die deutsche EU-Ratspräsidentschaft kurz bevor: Im finnischen Tampere fiel der „Startschuss" für eine gemeinsame europäische Asylpolitik. Heute, mehr als 20 Jahre später, wird Deutschland ab Juni 2020 zum 13. Mal die EU-Ratspräsidentschaft innehaben. Die Erwartungen sind hoch, eine Einigung beim angekündigten Asyl- und Migrationspakt der Kommission zu erzielen. Die Mitgliedstaaten können sich bisher nicht auf eine Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems verständigen. Die Bundesregierung steht daher vor der großen Aufgabe und Chance, den Geist von Tampere wieder zu beleben.
Hinzu kommt die Corona-Pandemie, in der es auch im Flüchtlingsschutz eminent wichtig ist, ob und wie lange etwaige Einschränkungen verhältnismäßig sind. Die Rechte der besonders Verwundbaren müssen hierbei vor allem berücksichtigt werden – beim Umgang mit Fristen bis zur zivilen Seenotrettung.
Beim diesjährigen Symposium wird durch die neue Partnerschaft mit Brot für die Welt und Misereor außerdem ein weiterer Schwerpunkt bei den Auswirkungen der Migrationskontrolle auf die Entwicklungszusammenarbeit liegen.
Das Symposium bietet Vertreter*innen aus Politik und Verwaltung, Justiz, Anwaltschaft, Wissenschaft und Nichtregierungsorganisationen, Menschen mit Fluchtgeschichte und freiwillig Engagierten ein Forum für intensiven Austausch. Wie in den Vorjahren werden die Diskussionen im Plenum durch Arbeitsforen zu aktuellen Brennpunkten des Flüchtlingsschutzes ergänzt.
Millionen von Menschen sind gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. Einmal im Jahr, am 20. Juni, würdigen wir ganz besonders die Stärke, den Mut und die Widerstandsfähigkeit, die Flüchtlinge, Binnenvertriebene und Staatenlose täglich aufbringen.
Am 20. Juni finden weltweit in etwa hundert Ländern Veranstaltungen statt, mit denen die Teilnehmenden ihre Solidarität mit Flüchtlingen zum Ausdruck bringen. Der Weltflüchtlingstag bietet staatlichen und zivilgesellschaftlichen Akteuren sowie Einzelpersonen – ob berühmt oder nicht – die Gelegenheit, sich für die Ziele des Flüchtlingshochkommissariats der Vereinten Nationen (UNHCR) einzusetzen: bessere Lebensbedingungen für die Betroffenen und ein bestmögliches Zusammenleben von Vertriebenen und einheimischer Bevölkerung.
Zum Weltflüchtlingstag veröffentlicht UNHCR auch jährlich die globalen Flüchtlingszahlen – in den letzten Jahren haben sie traurige Rekorde erreicht. Gewalt, Verfolgung und Menschenrechtsverletzungen in vielen Regionen der Welt haben zu Höchstständen bei Binnenvertriebenen, Flüchtlingen und Asylsuchenden geführt. Hinter den Zahlen und Fakten stehen viele Millionen einzelne Menschen und ihre Geschichten; Geschichten von Gewalt und Verlust, aber auch von Mut und Hoffnung. Ihre Stimmen sollen am Weltflüchtlingstag ganz besonders im Mittelpunkt stehen.
-
16.06.2020
-
22.07.2020
Die Online-Weiterbildung startet am *15. Juni* und richtet sich an Migrant*innen, die bereits ehrenamtlich in Politik und Zivilgesellschaft tätig sind und daran interessiert sind, sich z.B. auf Ratsmandate, Vorstandstätigkeiten und andere ehrenamtlich leitende Funktionen zu bewerben.
In der Weiterbildung erweitern die Teilnehmer*innen ihre Schlüsselkompetenzen für Leadershipaufgaben in Politik und Zivilgesellschaft. In sechs Workshops mit hervorragend qualifizierten Referent*innen bekommen die Teilnehmer*innen Impulse, wie sie ihre Position innerhalb der eigenen Organisation verändern können. Alle Workshops haben einen ausgeprägten Praxisbezug und bieten die Möglichkeit, eigene Fragestellungen und Fallbeispiele einzubringen. Ein begleitendes Coaching ermöglicht es allen Teilnehmer*innen, individuelle Fragestellungen zu bearbeiten.
-
09.06.2020
Referenten: Dr. Oskar J. Gstrein und Dr. Sebastian J. Golla.
-
12.06.2020
Nicht erst seit den heftigen Diskussionen und politischen Ereignissen der letzten Zeit ist es im Bewusstsein: Das friedliche Miteinander der Kulturen und Religionen ist eine der gesellschaftspolitischen Schlüsselfragen, die auch den Alltag jedes Einzelnen von uns betrifft. Ob in Behörden, beim Sozialen Dienst, im Schul- oder Sprach-Unterricht, im Krankenhaus oder im (multinationalen) Wirtschafts-Unternehmen - der Umgang mit Menschen aus anderen Kulturkreisen ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Jedoch reichen guter Wille und Toleranz für das Verständnis eigener und fremder kultureller Eigenheiten oft nicht aus: Gefragt ist vielmehr „interkulturelle Kompetenz“, eine Kombination aus sozialen Fertigkeiten und einschlägigem Fachwissen sowie der achtsame interreligiöse Dialog.
In dieser Intensivwoche wollen wir über unseren interkulturellen Umgang in der Praxis reflektieren und entscheidende Grundlagen zum erfolgreichen Handeln zwischen den Kulturen schaffen. Die Wahrnehmung eigener und fremder Kultur wird uns genauso beschäftigen wie die Frage des angemessenen interreligiösen Miteinanders. Auch für das erfolgreiche Agieren zwischen den Kulturen im eigenen Handlungsfeld vermitteln diese Seminar-Tage Einblicke. Gemeinsam erarbeiten wir uns Wissen für bessere multinationale Kommunikation und unser Agieren zwischen den Religionen und Kulturen.
„Sportvereine (und -verbände) haben eine elementare gesellschaftliche Rolle. Dies sollten wir anerkennen und die Sportvereine dabei unterstützen, die Aufgabe auch meistern zu können, ohne sie zu überfordern. Die Sportvereine sollten diese Rolle weiter annehmen und selbst gestalten, aber auch Stopp signalisieren, wenn es ihre eigenen Möglichkeiten übersteigt und die Aufgaben eigentlich durch andere umgesetzt werden sollten.“, betonte Nina Reip in dem Webinar. Welche Fallstricke und Lösungsmöglichkeiten es hierbei geben kann, wurde von den Gesprächspartner*innen konkret diskutiert. Und auch die stets aktuelle Frage, „wie politisch der Sport sein kann, darf und muss“, wurde näher besprochen und es wurde festgestellt, dass es keine „Parteipolitik betrieben werden darf“, aber wohl klar gesellschaftliche Verantwortung auf Basis der Werte im Sport übernommen werden muss.
The psychologist Felicia Lazaridou will introduce the topic through an input. Afterwards there will be the possibility to ask the speaker questions, exchange experiences and discuss possible ideas to minimize this pressure and find a good way to deal with it.
The event is aimed at people who experience racism (BIPoC = Black, Indigenous & People of Color).
Mai 2020
-
28.05.2020
-
17.05.2020
Schon seit vielen Jahren ist Deutschland ein Einwanderungsland, nicht erst, seit die Zuwanderung geflüchteter Menschen Medien und Gesellschaft beschäftigt. Angeworben durch die Wirtschaft, aber auch angezogen von unserem demokratischen Rechtsstaat, kamen Menschen bereits über Jahrzehnte. Mehr noch: Migration ist ein allgegenwärtiges Thema, das die Menschheitsgeschichte begleitet.
Dennoch ist das Ankommen in einer Gesellschaft kein selbstverständlicher, einfacher Prozess. Ressentiments und Hürden vieler Art gilt es zu überwinden, wenn Menschen aus unterschiedlichen Ländern und Kulturen miteinander leben, lernen und arbeiten. Kompetente Beratung kann dazu einen wichtigen Beitrag leisten.
In Vorträgen und Workshops werden verschiedene Aspekte einer Beratung für zugewanderte Menschen in Deutschland beleuchtet, die deren Integration in Bildung und Arbeit zum Inhalt hat.
Die Heinrich-Böll-Stiftung Brandenburg lädt zur Abschlusstagung „Typisch Deutsch? – Auseinandersetzungen um Nation, Identität und Zugehörigkeit“ des Projekts MIT:MENSCHEN am 15.05.2020 in Potsdam ein.
Die Tagung setzt sich mit den aktuellen Diskussionen, wer dazu gehört und mitsprechen darf – und wer nicht, auseinander. Konstruktionen von Nation, Identität und Zugehörigkeit werden kritisch hinterfragt und Perspektiven auf ein „Deutsch-Sein“, das jenseits biologistischer Ideen steht, versammelt.
Aufgeworfene Fragestellungen gehen dahin, wie ethnisierende Vorstellungen des „Deutsch-Seins“ entstanden sind, weshalb und auf welche Weise diese in der aktuellen Debatte wieder zu Tage treten und ob es eine kollektive Identität des „Deutsch-Seins“ überhaupt braucht.
Auf der Tagung erwarten Sie produktive wie auch spannende Diskussionen und Workshops genauso wie die Möglichkeit, sich mit anderen Akteuren zu vernetzen.
-
13.05.2020
Was ist, wenn die Hilfe für junge Volljährige endet, jungen Geflüchteten aber der Übergang in ein selbstständigen Leben noch nicht möglich ist? Was ist, wenn sie noch die allgemeinbildende Schule besuchen oder eine Ausbildung machen und weiter auch sozialpädagogische Unterstützung und Unterkunft benötigen? Wer ist zuständig und trägt die Kosten?
Im Webinar soll auf die rechtlichen Grundlagen der Jugendberufshilfe eingegangen werden und ein Austausch der Teilnehmenden zu ihren Erfahrungen und Lösungsideen vor Ort stattfinden.
-
06.05.2020
April 2020
-
30.04.2020
-
28.04.2020
-
04.06.2020
Die Ringvorlesung der Refugee Law Clinic Hannover e. V. geht im folgenden Sommersemester 2020 in eine neue Runde. Wir freuen uns auf verschiedene und spannende Vorträge zu migrationspolitischen und -rechtlichen Themen. Jede*r ist sehr herzlich eingeladen, daran teilzunehmen!
In dieser doch für allen neuen Zeit haben auch wir uns die Frage stellen müssen, wie wir das Konzept unserer Ringvorlesungen in den nächsten Wochen und ggf. Monaten realisieren können.
Wir haben uns nach eingehender Überlegung dazu entschieden, die Vorträge online über die Plattform "Zoom" stattfinden zu lassen. Dazu werden wir kurz vor der Veranstaltung (1-2 Tage) einen Link per Mail verschicken, über den jede*r an dem "Meeting" teilnehmen kann. Ihr braucht keine Kamera o.Ä. Meldet euch dafür bitte unten in der jeweiligen Veranstaltung kurz unverbindlich an.
-
17.06.2020
Neue Wege beschreitet das Internationale Bildungs- und Begegnungswerk e. V. in Dortmund: Erstmals bietet das IBB e.V. im Rahmen des auf zwei Jahre ausgelegten Projektes fokus³ berufsbegleitend eine Reihe zum kultursensiblen Management als Blended Learning an. Neben zwei Präsenzseminaren in Dortmund sowie einer halbtägigen Einführung, werden drei Seminareinheiten online im virtuellen Klassenzimmer vermittelt.
Die Fortbildung richtet sich an Haupt- und Ehrenamtliche aus dem Sozial- und Gesundheitswesen, die mit Geflüchteten oder schon vor längerer Zeit Zugewanderten arbeiten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten Basiswissen zu Migrationsverläufen, neuen Zuwanderungsgruppen, Aufenthaltsfragen und Kulturmodellen. An praxisnahen Beispielen geht es sodann um Fragen rund um Gesundheit, Krankheit und Tod. Einen weiteren Schwerpunkt bilden schließlich Strategien zur Umsetzung des Gelernten im eigenen Arbeitsbereich.
Angesichts der Probleme auf dem Wohnungsmarkt entwickeln sich Gemeinschaftsunterkünfte für Geflüchtete in vielen Landkreisen und kreisfreien Städten zu Dauereinrichtungen.
Viele Kommunen machen sich daher Gedanken, wie sie – neben Maßnahmen zur Förderung eines Auszugs aus Wohnheimen – Anstrengungen unternehmen können, um in Gemeinschaftsunterkünften die Lebensbedingungen zu verbessern: Es geht um die Gewährleistung einer Privatsphäre der Bewohner und Bewohnerinnen, um Maßnahmen zum Schutz von sog. vulnerablen Geflüchteten, um die Staffelung von Gebühren und die Integration der Geflüchteten in ihr Lebensumfeld.
Mit der Fachtagung „Trautes Heim? Wohnen und Leben in niedersächsischen Flüchtlingsunterkünften“ soll eine Diskussion um diese Fragen angestoßen werden. Der Hannoversche Oberbürgermeister Belit Onay hat für diese Veranstaltung die Schirmherrschaft übernommen und wird ein Grußwort sprechen.
In diesem Webinar wird ein Überblick über die wichtigsten Gesetzesänderungen im Bereich des Asyl- und Aufenthaltsrechts gegeben. Dazu gehören die neue Beschäftigungsduldung und Änderungen bei der Ausbildungsduldung, im Bereich Abschiebungen und Erstaufnahme, im Asylbewerberleistungsgesetz und beim Arbeitsmarktzugang. Das Webinar richtet sich in erster Linie an ehrenamtlich Engagierte in der Flüchtlingsarbeit.
Die Teilnahme am Webinar erfolgt am PC. Sie benötigen dazu einen gängigen Internetbrowser, eine stabile Internetverbindung und einen Kopfhörer bzw. Lautsprecher.
-
07.04.2020
Eine Reise durch das Portal gibt Ihnen einen Einblick u.a. in die Themen Asylrecht, Deutschlernen, Strategien gegen Diskriminierung, Engagement von Geflüchteten im Ehrenamt u.v.m. Entdecken Sie die Einsatzmöglichkeiten des Portals in Ihrer Arbeit und tauschen Sie sich mit anderen Akteur*innen und Expert*innen aus.
Unter anderem mit dabei:
- Speed-Dating mit Jens Dieckmann, Rechtsanwalt für Asylrecht
- Prof. Dr. Cornelia Rosebrock mit einer Einführung in Unterstützungsmöglichkeiten im Bereich Alphabetisierung und Grundbildung durch Ehrenamtliche
- Dr. Oliver Piecha, unser Experte für Fluchtursachen und die Herkunftsländer Syrien und Irak
- Negin Behkam, Journalistin aus dem Iran
- die UNO-Flüchtlingshilfe, der Paritätische NRW, das Migrationszentrum Göttingen, die Servicestelle Antidiskriminierungsarbeit des Caritasverbandes Paderborn, etc.
Darüber hinaus geben wir Ihnen einen Ausblick auf zukünftige Inhalte und Schwerpunkte des Ehrenamtsportals, wobei das Thema Alphabetisierung und Grundbildung (Unterstützungsmöglichkeiten beim Lesen, Schreiben, Rechnen) im Ehrenamtskontext eine Rolle spielen wird. Und Sie lernen unseren neuen Bereich Online-Community kennen, in dem Sie schon bald andere Ehrenamtliche, Koordinator*innen und Expert*innen sowie weitere Akteur*innen kennenlernen und sich online mit Ihnen austauschen können.
-
09.04.2020
Die Antworten auf diese und weitere Fragen werden wir gemeinsam an vierTagen entdecken:
- Welche Behörden sind wofür zuständig?
- Wo und wie kann ich was beantragen?
- Was kann ich machen, wenn ich mit der Entscheidung einer Behörde nicht einverstanden bin?
- Wo bekomme ich Beratung, wenn ich z. B. Probleme mit meinem/meiner Vermieter*in oder auf der Arbeit habe?
-
03.04.2020
Ziele der Tagung sind die Vorstellung neuer Forschungsergebnisse zur Integration von Geflüchteten in die Arbeitswelt und der Austausch mit Praktikerinnen und Praktikern aus Betrieben, Kammern, Behörden und Gewerkschaften.
Zentrale Themen und Fragestellungen:
- Wie und wo kommen Geflüchtete in den Arbeitsmarkt? Wie erfolgreich sind Unterstützungs- und Fördermaßnahmen etwa der Arbeitsagenturen und der Kammern?
- Wie finden sich Geflüchtete in der deutschen Arbeitswelt zurecht? Wie kommen sie und andere Beschäftigte, Vorgesetzte, Ausbilder und Betriebsräte miteinander klar? Welche Umstände sind der Integration förderlich oder hemmen diese?
Einen besonderen Fokus legt die Tagung darauf, Möglichkeiten zu diskutieren gegen Ausbeutung und Arbeitsunrecht, Rassismus und Diskriminierung vorzugehen. Wie können aus politischen Regelungen und Verwaltungsvorgaben entstehende Hürden für die Integration überwunden werden? Ausgehend von aktuellen wissenschaftlichen Forschungsergebnissen sollen Handlungsempfehlungen und Erfahrungen aus der Praxis diskutiert werden.
-
02.04.2020
Die Veranstaltung wird durch das Projekt Prävention und Gesellschaftlicher Zusammenhalt organisiert. Der Fokus der Projektarbeit liegt auf der Vermittlung von Methoden der Radikalisierungsprävention. Veranstaltungen richten sich hauptsächlich an Fachkräfte, die mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen arbeiten.
Zielgruppe der Veranstaltung sind vhs-Mitarbeiter*innen, Respekt Coaches und Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe.
März 2020
-
01.04.2020
-
03.04.2020
In der Politikstunde beschäftigt sich die Bundeszentrale für politische Bildung mit allem, was so los ist in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Täglich von 11 bis 11:45 Uhr.
Ziel für die kommenden Wochen, in denen alle Bürgerinnen und Bürger wegen des Corona-Virus' zu Hause bleiben müssen: mehr Politik, Gesellschafts- und Wirtschaftswissen vermitteln! Sich einmal mit Themen beschäftigen, die sonst oft zu kurz kommen.
Das vollständige Programm ist online zu finden. Die Veranstaltungen werden aufgezeichnet und sind ebenfalls online zu finden.
Unterschiedliche Entwicklungen der letzten Jahre zeigen: Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit. Sie muss gelebt und weiterentwickelt werden. Das geschieht nicht irgendwo in Sonntagsreden oder Talkshows, sondern dort, wo die Menschen leben: in der Nachbarschaft, im Quartier.
Die Förderung von demokratischen Strukturen ist darum ein Kernauftrag von Gemeinwesenarbeit und Quartiersmanagement. In den „Qualitätsstandards der Gemeinwesenarbeit“ steht als Ziel des ersten Standards „Bewohner*innen im Zentrum“: „durch gelebte lokale Demokratie, allgemein das Vertrauen in die Demokratie erhöhen.“
- Wie sieht das in der Praxis aus?
- Was funktioniert?
- Was funktioniert nicht?
Diese Fragen wollen wir im ersten Teil der Veranstaltung, anhand von Praxisbeispielen aus der Modellförderung, vertiefen.
Im zweiten Teil wagen wir ein neues Format:
Demokratie kann nur gelingen, wenn die unterschiedlichen Akteure miteinander reden. Genau das wollen wir tun: Miteinander reden. Darum richtet sich die Veranstaltung nicht nur an Gemeinwesenarbeiter* innen, sondern auch an Bewohner*innen, Kommunal- und Landespolitik.
Wir bitten also die Gemeinwesenarbeiter*innen und Quartiersmanager*innen: ladet Bewohner*innen, kommunale Politik und eure Landtagsabgeordneten ein und kommt zusammen nach Hannover. Hier wollen wir gemeinsam überlegen, wie wir Demokratie vor Ort verbessern können.
-
20.04.2020
Fridays for Future organisiert die kommenden Tage und Wochen Livestreams zur Klima-Gesellschafts-Krisen-Bildung! Verfügbar für alle Interessierten, jung und alt, aus jeder Ecke des Landes.
Obwohl Aktivist*innen inzwischen seit 15 Monaten auf den Straßen stehen und in Reden auf Streiks, in Plena, beim Sommerkongress, im Radio und im Fernsehen täglich übers Klima gsprochen wird, versagen die Schulen auf ganzer Linie darin, ausreichend über die Klimakrise und die Lösungen zu unterrichten. Gleichzeitig versuchen Klimawandelleugner*innen falsche Informationen zu verbreiten und dadurch zu verunsichern. Dabei gibt es die Forscher*innen und Expert*innen, die genau wissen, was das Problem mit dem Klima ist. Dabei gibt es die Lösungsansätze und Ideen, wie Deutschland aus der Kohle aussteigen kann, wie wir unsere Landwirtschaft nachhaltiger gestalten können, wie ein gut funktionierender ÖPNV aussehen kann.
Und über genau diese Themen will Fridays for Future in den kommenden Tagen und Wochen mehr erfahren. Gemeinsam mit Expert*innen wollen sie Mythen der Energiewende aufklären, hinterfragen, wer eigentlich die Kohlebagger finanziert, lernen, wie man Klimawandelleugner*innen enttarnt, über Aktivismus und Journalismus in Krisenzeiten sprechen und vieles mehr.
Das Programm für die kommenden Tage findet man immer auf der Website. Die Webinare werden immer als Live-Stream auf dem Youtube-Kanal live übertragen.
-
06.04.2020
Wenn es ein Thema gibt, das derzeit alle Medien bestimmt, dann sind es Grenzen. Seien es die gesellschaftlichen und nationalen Grenzen, mit den damit verbundenen Fragen der Migration und der Ausgrenzung, seien es die persönlichen Grenzen der Meinungsfreiheit und der Privatsphäre. Der Jahrestag des Mauerfalls hat gezeigt, wie unterschiedlich Grenzen bewertet werden: Wo gestern noch der Fall von Grenzen bejubelt wurde, können morgen ebenso schnell neue Grenzen errichtet werden - nach außen und nach innen.
2020 fragt der Kunstwettbewerb der Bildungsstätte Anne Frank nach dem Sinn und Unsinn von Grenzen. Vor allem geht es um Deinen Umgang mit Grenzen. Seien es Grenzen, die Dir im Alltag begegnen. Grenzen die Du bei anderen beobachtest. Grenzen, die nicht existieren, die Du dir aber vielleicht wünschst. Grenzen können überwunden, verschoben oder akzeptiert werden. Welche sind Dir wichtig?
Über Grenzpolitik kann man in den verschiedenen Medien viel erfahren, von Deinem persönlichen Umgang mit Grenzen jedoch nicht. Das wollen wir ändern! Gestalte ein Plakat, indem Du uns zeigst, welche Grenzen Du überwinden möchtest oder wo Du sie ziehst.
Einsendeschluss: 06. April 2020
Benachrichtigung der Gewinner*innen: 11. Mai 2020
Sie sind Amtsvormund*in, im ASD des Jugendamtes für UMA/ junge volljährige Geflüchtete zuständig oder arbeiten in einer Einrichtung der Jugendhilfe mit jungen Flüchtlingen. Sie kommen hierbei oft mit asyl- oder aufenthaltsrechtlicher Regelungen und gesetzlichen Änderungen in Kontakt, die in der praktischen Arbeit Fragen aufwerfen können. Um Antworten zu finden oder Lösungswege aufzuzeigen, bietet die Fachberatungsstelle die Möglichkeit der Teilnahme an trägerübergreifendem und überregionalem Austausch für o.g. Fachkräfte an.
Themen können sein:
- Pflicht zur Asylantragstellung?
- Aufenthaltsrechtliche Perspektiven ohne Asylantrag oder nach negativ abgeschlossenem Asylverfahren (u.a. Ausbildungsduldung, Bleiberecht § 25a);
- Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis;
- Identitätsklärung und Mitwirkungspflichten;
- Widerrufsverfahren (Widerruf des Schutzstatus);
- Niederlassungserlaubnis (unbefristete Aufenthaltserlaubnis),
- umA (umF) in Pflegefamilien,
- und andere Themen der Teilnehmenden
-
06.06.2020
In der Fortbildung werden die Teilnehmer*innen eingeladen, sich intensiv und selbstreflexiv mit den Themen Gender, Migration und Diversität zu beschäftigen und eine größere Handlungssicherheit in diesem Themenfeld zu erwerben. Es geht dabei um den Erwerb von Gender- und Diversitykompetenz für das Berufs- und Privatleben sowie um die Entwicklung einer machtkritischen, diskriminierungssensiblen Perspektive. Der Fokus wird insbesondere auf der Reflexion der eigenen Haltung sowie geschlechts- und kulturspezifischen Vorstellungen liegen. Zudem bekommen die Teilnehmer*innen die Möglichkeit, diversitätsbewusste Handlungsmöglichkeiten zu erforschen und auf methodisch vielfältige Weise transkulturelle Kompetenzen zu entwickeln.
Diese Schulung richtet sich an Haupt- und Ehrenamtliche der Arbeitsfelder Migration, Gleichstellung und Teilhabe, Fachkräfte aus der Bildungs- und Beratungsarbeit sowie weitere Interessierte. Die Teilnehmer*innen-Anzahl ist auf 16 Personen begrenzt.
-
29.03.2020
Über die Stiftung können Informationsmaterialien bestellt werden.
-
13.03.2020
DJANE Yeliz kommt aus Hannover und bringt einen Mix Dance Hits aus unterschiedlichen Ländern mit.
Die internationale Frauenparty ist für alle Frauen verschiedenster Kulturen. Dort sind auch spezifische Angebote und Hinweise für Beratungsstelle für zugewanderte Frauen vorzufinden. Deutsche Frauen sind im Sinne der Integration aber natürlich nicht ausgeschlossen, es soll für alle Frauen sein, unser Fokus liegt dabei aber auf dem internationalen Charakter.
Die Neue Mitte-Studie zeigt, dass ein Großteil unserer Bevölkerung eine demokratische und vielfältige Gesellschaft befürwortet. Gleichzeitig äußert ein Drittel der Bevölkerung Zustimmung zu menschenfeindlichen Einstellungen und Vorurteilen. Unsere Antwort auf diese Herausforderung ist der Anti-Bias Ansatz! Er eröffnet für die pädagogische Praxis in der Kinder- und Jugendhilfe einen Möglichkeitsraum Vielfalt zu fördern, für Diskriminierung zu sensibilisieren und die Mechanismen von
Vorurteilen kritisch zu reflektieren. Somit können wir Diskriminierungen besser erkennen und den Abbau von Benachteiligungen fördern.
- Wie kann Vorurteilen und menschenfeindlichen Haltungen entgegen gewirkt werden?
- Was benötigen pädagogische Fachkräfte, um in analogen und digitalen Räumen eine bessere Positionierung gegen Vorurteile und menschenverachtende Äußerungen einzunehmen?
- Wie können Handlungsstrategien für eine vorurteilsreflektierte Praxis und das eigene Umfeld entwickelt werden?
-
10.03.2020
Im Präventionsprogramm der Bundesregierung (NPP) wird das Internet als einer der "Orte der Prävention" herausgestrichen. Aber auch für grundständige lebensweltlich orientierte politische Bildung und Soziale Arbeit liegen in der digitalen Lebenswelt mannigfaltige Potentiale und Herausforderungen.
Doch welche Angebote digitaler Bildungs- und Präventionsarbeit gibt es und wie können sie dabei helfen, neue Zielgruppen zu erreichen, Partizipation zu fördern und Pluralität abzubilden? Welche Strategien verfolgen antidemokratische Akteur/-innen im Netz und welche Möglichkeiten gibt es für Eltern, Pädagog/-innen, politische Bildner/-innen, Sozialarbeiter/-innen und Lehrkräfte, junge Menschen so zu fördern, dass sie tolerant und wertschätzend mit der gesellschaftlichen Vielfalt umgehen und sich resilient gegenüber antiemanzipatorischer, rassistischer und demokratiefeindlicher Agitation im Internet zeigen können?
Diese und viele weitere Fragen sollen im Rahmen der Tagung "Präventionsarbeit in digitalen Lebenswelten" thematisiert und diskutiert werden. Wir wollen uns mit den diesbezüglichen Gefahren sowie dem Potenzial des Internets auseinandersetzen und den Fokus auf Digitale Bildung, Webvideos und Online-Streetwork als präventive Vermittlungsformen legen.
-
08.03.2020
Zuwanderung war, ist und bleibt urbane Tatsache!
Dies stellt Herausforderungen an das Wohnen und Zusammenleben in den Quartieren und Nachbarschaften. Integrative Wohnprojekte für und mit neuzugewanderten Menschen leisten dabei Pionierarbeit.
Zum Abschluss des Forschungsvorhabens „Zusammenhalt braucht Räume – Integratives Wohnen mit Zuwanderern“ werden im Rahmen der Abschlusstagung Forschungsergebnisse präsentiert und gemeinsam reflektiert. Dabei werden die Erkenntnisse aus sechs bundesweiten Fallstudien zu integrativen Wohnprojekten in einen umfassenderen Forschungs- und Politikkontext gestellt und kommunale Handlungsspielräume für die Beförderung dieser Wohnformen ausgelotet.
Mit dem Pilotprojekt „Mädchen. Machen. Mut“ will SCDE die Selbstwirksamkeit und Resilienz von geflüchteten Mädchen und jungen Frauen in Erstaufnahmeeinrichtungen in Deutschland stärken. Hierzu wurde mit Projektpartnern und geflüchteten Mädchen und jungen Frauen in Erstaufnahmeeinrichtungen in zwei Bundesländern zusammengearbeitet und es wurden Mikroprojekte zur psychosozialen Unterstützung entwickelt und umgesetzt.
Im Rahmen des Abschlussfachtages „Psychosoziale Unterstützung für geflüchtete Mädchen – Besonderheiten und Herausforderungen“ am Freitag, den 06. März 2020 von 09.30-16.30 Uhr möchten wir gemeinsam mit Ihnen - Praktiker*innen der Psychosozialen Arbeit und Entscheidungsträger*innen aus Verwaltung und Politik - der Frage nachgehen, welche besonderen Bedarfe geflüchtete Mädchen und junge Frauen haben, welche Ansätze sie in ihrem Alltag effektiv unterstützen und vor welchen Herausforderungen wir dabei stehen.
-
05.03.2020
-
01.03.2021
Das Netzwerk Unternehmen integrieren Flüchtlinge bietet verschiedene Webinare an, bei denen Expertinnen und Experten zu unterschiedlichen Aspekten der Beschäftigung von Geflüchteten zu Wort kommen.
Die vergangenen Webinare sind zudem online aufrufbar.
Februar 2020
Das Bündnis "Niedersachsen packt an" veranstaltet gemeinsam mit dem Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser und in Kooperation mit dem Integrationsmanagement der Stadt Hameln einen Poetry-Slam Abend im Kultur- und Kommunikationszentrum Sumpfblume in Hameln.
Eine Bühne, vier Dichterinnen und Dichter, zwei Runden, ein Thema und ein Ziel: die Herzen der Zuschauerinnen und Zuschauer für sich und seinen Text zu gewinnen. Das sind die Grundzutaten beim Poetry Slam „Gemeinsam stark sein!". Das Besondere: die Poetinnen und Poeten stellen sich einem echten Worte- und Themen-Mehrkampf und lesen in einer Pflicht- und einer Kür-Runde.
In der „Pflicht" stellen sie sich nachhaltig bis augenzwinkernd rasant ihren eigenen Erfahrungen und Wünschen in puncto zivilgesellschaftlichem Engagement und demokratisch aufgeklärter, politischer Haltung und treten dabei unter anderem in einen intensiv-nachhaltigen Dialog mit den Themen Ehrenamt und Flüchtlingsarbeit.
In der „Kür" öffnen die Slammerinnen und Slammer schließlich ihre funkelnden ABC-Schatzkisten und präsentieren einen fulminanten Einblick in ihre besten Bühnen-Texte. Von Kurzgeschichten bis zur literarischen Comedy, von Lyrik bis Rap und Performance-Prosa sind dem Vortrag keinerlei Grenzen gesetzt.
Die Art und Weise, wie in einem heterogenen Umfeld untereinander kommuniziert wird, hat starke Auswirkungen darauf, ob und wie das Miteinander gestaltet und gelebt wird. Sprache ist ein sehr machtvolles Instrument, wenn es darum geht, der Welt eine Bedeutung und einen Sinn zu geben. Sprache ist nicht ausschließlich ein Instrument, um Dinge zu benennen - durch sie wird die Möglichkeit eröffnet, eine ganz eigene Welt zu "erschaffen".
Viele Menschen erleben heute häufig sprachliche Diskriminierungserfahrungen entlang von Merkmalen, die ihre Identität betreffen wie Geschlecht, Behinderung, Familienkultur, Sprachen und Ethnien. Ein diskriminierender Sprachgebrauch in Alltagssituationen, in den Medien und in Büchern findet vielfach statt, wird bewusst oder unbewusst übernommen und weitergegeben.
Ziel der Fortbildung ist es, den eigenen Sprachgebrauch zu reflektieren und konkrete Handlungsmöglichkeiten anhand verschiedener Alltagssituationen zu erarbeiten.
Aufgrund gesellschaftlicher und demographischer Entwicklungen spielt Transkulturelle Kompetenz in der Praxis der Akteure eine immer größere Rolle. Daraus ergibt sich die Frage: Braucht ein Vormund transkulturelle Kompetenz?
In dieser Fachtagung wollen wir uns mit rechtlichen, kulturspezifischen und kulturübergreifenden Themen beschäftigen.
Was braucht es, um das „Fremde“ zu verstehen? Ziel der Veranstaltung ist es, ein erweitertes Wissen und Verständnis zu vermitteln und für die Praxis nutzbar zu machen.
Folgende Aspekte werden in diesem Zusammenhang näher beleuchtet:
- Was ist transkulturelle Kompetenz?
- Wie wirkt sich die Migrationsbiografie der Betroffenen aus?
- Welche Herausforderungen entstehen diesbezüglich in der Praxis von VormünderInnen?
- Welche rechtlichen Grundlagen sind zu beachten?
- Welche Bedeutung hat die Migrationsbiografie für die Bildungsperspektive des Betroffenen?
- Was bedeutet Transkulturalität für den beruflichen Alltag sowohl aus Sicht der Betroffenen als auch aus Sicht der Helfenden?
- Woraus ergibt sich das Spannungsverhältnis zwischen professionellen Akteuren und den Familien und Mündeln?
Die Fachtagung bietet die Möglichkeit, Einblick in verschiedene Ansätze zum Thema zu erhalten und sich über die Relevanz in der praktischen Tätigkeit auszutauschen. Zudem werden Handlungsansätze für die Praxis erarbeitet und besprochen
Medien bieten wichtige Ansatzpunkte für die Präventionsarbeit. Gerade soziale und audiovisuelle Medien eignen sich, um Jugendliche zu einer reflektierten und aktiven Mediennutzung zu motivieren und ihre Urteilsfähigkeit zu fördern. Medienpädagogische Ansätze unterstützen die Persönlichkeitsentwicklung und zeigen Handlungsmöglichkeiten auf, um sich in gesellschaftliche Debatten einzubringen.
Das von der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien (BKM) geförderte Präventionsprojekt „RISE – Jugendkulturelle Antworten auf islamistischen Extremismus“ ist im März 2019 gestartet und verbindet aktive Medienarbeit mit einem Peer-to-Peer-Ansatz. Im ersten Jahr entstanden sieben Filme, welche die Perspektive von jungen Menschen auf die Themen Pluralität, Rassismus, Werte & Religion, Gender und Gesellschaftskritik aufgreifen. Die Filme sind ergänzt mit pädagogischem Material und Hintergrundinformationen für Multiplikator*innen für den Einsatz in der Präventionsarbeit und auf einer Online-Plattform zugänglich.
Der Fachtag richtet sich an pädagogische Fachkräfte und bietet einen Einblick in erste Ergebnisse des RISE-Projektes. Die Veranstaltung verbindet wissenschaftlichen Input und Praxiserfahrungen und bietet die Möglichkeit, sich mit anderen Akteur*innen aus Präventionsarbeit, Politik, Wissenschaft und Jugendarbeit auszutauschen und zu vernetzen.
Die Anmeldung ist kostenfrei und noch bis 31. Januar möglich.
Januar 2020
Die Fortbildung wird von Rechtsanwältin Claire Deery gehalten. Sie legt den Fokus auf die Mitwirkungspflichten bei Personen mit Duldung und Gestattung. Dabei sollen die Möglichkeiten der Passbeschaffung einzelner Herkunftsländer vermittelt werden. Insbesondere folgende Themen werden Bestandteil der Fortbildung sein:
- Einführung/Systematik der Mitwirkungspflichten und Passbeschaffung
- Mitwirkungspflichten im Asylverfahren
- Mitwirkungspflichten zur Identitätsklärung/Passbeschaffung im AufenthG, insbesondere bei Duldung
- Mitwirkung bei §60b AufenthG (Duldung für Personen mit ungeklärter Identität)
- Sanktionsmöglichkeiten bei Nichtmitwirkung im AsylG/AufenthG
- Dokumentation der Mitwirkung
- Möglichkeiten der Identitätsklärung am Beispiel §25a AufenthG (Zeitpunkt/Sanktionen)
- Möglichkeiten der Passbeschaffung einzelner Herkunftsländer: (z.B. Afghanistan, Äthiopien, Elfenbeinküste, Eritrea, Mali, Somalia)
With retirement rates outpacing workforce growth in communities across regional and rural Canada, smaller cities and towns are looking for new ways to bolster the local economy. For many, that means investing in strategies for the reception and integration of immigrant entrepreneurs. Whether running a small business or investing in a new start-up, entrepreneurship has always been a route for immigrants to establish and sustain themselves in new communities. Research suggests that local communities that are willing to invest in entrepreneurism are investing in strategies that will advance innovation and spur creativity for the benefit of all residents.
Immigrants face the same challenges in starting a new business as entrepreneurs anywhere. Additional roadblocks can include language, limited knowledge of local markets, regulatory issues, access to credit or vital business networks. What can smaller cities do to support aspiring immigrant entrepreneurs and ensure they lay down the roots for a successful business and new life in the community?
Learn how the cities of Fredericton (NB) and Peterborough (ON) are providing inroads to entrepreneurism and economic inclusion for newcomers.
Die Diakonische Flüchtlingshilfe im Kirchenkreis Salzwedel lädt alle Interessierten, Haupt- und Ehrenamtliche der Integrationsarbeit zum Fachtag „Inner Safety- Einführung in die Psychotraumatologie“ am 11.01.2020 (Samstag) ein.
Folgende Themen werden im Rahmen des Fachtags besprochen:
- Was ist ein Trauma? (Traumadefinition)
- Was passiert während einer Traumatisierung im Gehirn? (Neurologie)
- Was ist eine Posttraumatische Belastungsstörung?
- Traumatisierung bei Kindern und Jugendlichen
- Transgenerationale Weitergabe von Traumata
- Was hilft? (Stabilisierung)
- Umgang mit traumatisierten Menschen
- Burn-out Prophylaxe
Alle Punkte werden im Hinblick auf die besondere Situation von traumatisierten Flüchtlingen geschildert und vertieft und auf den Bedarf der jeweiligen Zielgruppe abgestimmt. Fallbesprechungen sind ebenfalls möglich.
-
30.08.2020
Dezember 2019
Das Ethno-Medizinisches Zentrum lädt zum Fachtagung „Für ein faires Miteinander!“ ein, um den Diskurs über Geschlechtergerechtigkeit und demokratische Teilhabe bei Geflüchteten und Migrant*innen voranzubringen. Die Tagung wird von der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration gefördert.
Neben Plenumsdiskussionen und Workshops bietet die Tagung Gelegenheit, professionelle Netzwerke und Selbsthilfestrukturen auszubauen. Expert*innen stellen Herausforderungen und Konzepte zur Gewaltprävention und Integration im Kontext von häuslicher Gewalt, Erziehungsfragen sowie migrations- und genderspezifischen Anpassungsprozessen vor. Zur Sprache kommen auch die digitale Gewalt und Hassrede gegen Migrant*innen im Internet. Die Radiomoderatorin Shelly Kupferberg und Michael Stempfle vom ARD-Hauptstadtstudio werden durch das Programm führen.
Die Gesellschaft zeigt sich in ihren Einstellungen gegenüber der Zuwanderung von Geflüchteten und Menschen aus Ost- und Südosteuropa derzeit gespalten, die Politik positioniert sich nicht immer eindeutig gegen Fremdenfeindlichkeit und rechte Gewalt. Dies führt zu allgemeinen Verunsicherungen und kann Spaltungstendenzen in der Gesellschaft sowie das Erstarken populistisch-autoritärer Strömungen in der Politik befördern. Um Vorbehalte und Ängste in der Bevölkerung abzubauen und Akzeptanz zunehmender gesellschaftlicher Vielfalt zu erhöhen, scheint eine umfassende Öffentlichkeitsarbeit im Sinne einer auf Transparenz angelegten Kommunikationsstrategie auf kommunaler Ebene notwendig.
Im Rahmen des Seminars sollen die Bedeutung von Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit im politischen Dialog mit der Bürgergesellschaft reflektiert, Beispiele gelungener Kommunikationsstrategien vorgestellt und der kommunale Erfahrungsaustausch ermöglicht werden.
Die Gesellschaft zeigt sich in ihren Einstellungen gegenüber der Zuwanderung von Geflüchteten und Menschen aus Ost- und Südosteuropa derzeit gespalten, die Politik positioniert sich nicht immer eindeutig gegen Fremdenfeindlichkeit und rechte Gewalt. Dies führt zu allgemeinen Verunsicherungen und kann Spaltungstendenzen in der Gesellschaft sowie das Erstarken populistisch-autoritärer Strömungen in der Politik befördern. Um Vorbehalte und Ängste in der Bevölkerung abzubauen und Akzeptanz zunehmender gesellschaftlicher Vielfalt zu erhöhen, scheint eine umfassende Öffentlichkeitsarbeit im Sinne einer auf Transparenz angelegten Kommunikationsstrategie auf kommunaler Ebene notwendig.
Im Rahmen des Seminars sollen die Bedeutung von Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit im politischen Dialog mit der Bürgergesellschaft reflektiert, Beispiele gelungener Kommunikationsstrategien vorgestellt und der kommunale Erfahrungsaustausch ermöglicht werden.
Sie sind Amtsvormund oder im ASD für UMF (UMA)/ junge volljährige Geflüchtete zuständig? Oder Sie arbeiten in einer Jugendhilfeeinrichtung mit UMF (UMA)? Sie stehen / Ihr Team steht immer wieder vor (neuen) Fragen bezüglich asyl- oder aufenthaltsrechtlicher Regelungen und weiterer Themengebiete und Sie möchten Antworten finden? Sie fragen sich vielleicht, „wie machen das andere Kolleg*innen“ oder „wie wird das anderswo in Thüringen gemacht“?
Um Erfahrungen auszutauschen, Antworten und Lösungen zu finden oder auch (anonymisiert) Einzelfälle zu besprechen, soll im Rahmen der "Fachberatungsstelle UMA/ Care Leaver der thüringenweite, trägerübergreifende Austausch zwischen interessierten Fachkräften gefördert werden.
Zum Inhalt: Bei dieser Fachtagung werden wir uns schwerpunktmäßig mit asyl- und aufenthaltsrechtlichen Perspektiven für unbegleitete (minderjährige) Geflüchtete befassen. Neben der Begleitung im Asyl- und Klageverfahren wird ein Schwerpunkt auf aufenthaltsrechtliche Perspektiven außerhalb des Asylverfahrens gelegt, worunter insbesondere das Bleiberecht für gut integrierte Jugendliche und junge Heranwachsende sowie die (neue) Ausbildungsduldung fallen. Darüber hinaus werden wir uns auch mit dem Thema der Identitätsklärung im Kontext der Aufenthaltssicherung befassen sowie auf Problemfelder und Möglichkeiten im Rahmen der Familienzusammenführung eingehen. Dabei werden wir auch die Neuerungen im Rahmen des sog. „Migrationspaketes“ und dessen Auswirkungen auf die Rechte und Handlungsoptionen junger Geflüchteter in den Blick nehmen. Die Themen werden überwiegend in Workshops bearbeitet, so dass neben inhaltlichen Inputs auch Raum für (Erfahrungs-)Austausch und Fragen vorhanden ist.
Zum Hintergrund: Die Entwicklung von (Zukunfts-)Perspektiven ist grundsätzlich ein Anliegen junger Menschen. Der Alltag junger Geflüchteter ist jedoch vielfach dominiert von Ängsten und Unsicherheiten hinsichtlich ihrer langfristigen aufenthaltsrechtlichen Situation in Deutschland. Viele befinden sich insbesondere aufgrund langwieriger Asylverfahren, hoher Fehlerquoten in der Entscheidungspraxis des BAMF sowie jahrelangen Gerichtsverfahren nach wie vor in einem prekären und ungesicherten Aufenthaltsstatus. In Anbetracht der teils mehrjährigen Aufenthalte in Deutschland, des hier zurückgelegten Bildungsweges und aufgebauter sozialer Netzwerke können sich aufenthaltsrechtliche Möglichkeiten auftun, die frühzeitig in den Blick genommen werden sollten. Die Entwicklung möglicher Bleibeperspektiven ist ein wichtiger Bestandteil der Unterstützung von jungen Geflüchteten – während, im Übergang sowie auch nach Ende der Jugendhilfe.
Diskussionen über den Zustand unserer Gesellschaft werden – ob in den sozialen Medien oder im unmittelbaren Zusammentreffen – zunehmend polarisierend und polemisch geführt. Dies führt zu einer Verrohung des politischen Diskurses. Oft ist es auch Wasser auf die Mühlen extremistischer und zum Teil gewaltbereiter Kräfte. Die Ermordung des Regierungspräsidenten Walter Lübcke aus Kassel – ein großer Freund der Otto Benecke Stiftung e.V. – durch einen rechtsextremistischen Täter stellt eine dramatische Zäsur dar. Der gottlob gescheiterte Mordanschlag auf jüdische Mitbürger in der Synagoge zu Halle (Saale) mit zwei Todesopfern im benachbarten Umfeld verweist erneut auf die Brisanz der aktuell extremistischen Tendenzen in Deutschland.
Rechtsextremismus und religiös bedingter Extremismus sind zwar unterschiedliche Phänomene, weisen allerdings in ihren aggressiven Verhaltensweisen und Aktivitäten Parallelen auf. Gemeinsam ist ihnen die Verachtung und Ablehnung der Demokratie, der Pluralität und der Gleichheit und Gleichberechtigung aller in unserer Gesellschaft lebenden Menschen. Unsere Werte und vor allem rechtsstaatliche Grundsätze als Fundament unserer freiheitlich demokratischen Gesellschaftsordnung werden von ihnen bekämpft.
Die Hintergründe dieser Entwicklungen möchten wir im 1. Teil unseres Forums vorrangig wissenschaftlich beleuchten.
Im 2. Teil befassen wir uns mit den Möglichkeiten präventiver Maßnahmen sowie den gesellschaftlichen Anforderungen zur Bekämpfung des Extremismus.
Can the Subaltern speak? Die postkoloniale Wissenschaftlerin und Autorin Gayatri Chakravorty Spivak beantwortet diese Frage ganz klar mit Nein! – Unterdrückte gesellschaftliche Minderheiten können nicht sprechen. Auch migrantische Frauen in Deutschland können nicht (für sich selbst) sprechen – nicht aber aus Unfähigkeit, sondern weil sie in einer Gesellschaft leben, die sie sprachlos und damit häufig auch handlungsunfähig macht.
Vielen von ihnen werden strukturell gesellschaftliche Zugänge verweigert, sei es durch fehlende KiTa-Plätze oder ungleiche gesetzliche Regelungen, die ihren jeweiligen Ehemann bevorzugen. Gleichzeitig gibt es Widerstand und Aktivismus von migrantischen Frauen in Projekten, Vereinen oder Migrantischen Selbstorganisationen.
In der Podiumsdiskussion wollen wir über die aktuelle Lage von geflüchteten und migrierten Frauen in Niedersachsen und insbesondere im Raum Hannover sprechen. Ein Augenmerk wird dabei auf ihrer rechtlichen und gesellschaftlichen Lage, sowie ihrem Aktivismus und auf Möglichkeiten zur Veränderung des gesellschaftlichen Mehrheits-Blicks liegen.
Diskutieren werden Leyla Ercan (Agentin für Diversität am Niedersächsischen Staatstheater), Duygu Sipahioğlu-Sery (Projektleiterin des Projekts Speak UP!, Mitarbeiterin im Mädchenhaus KOMM e.V.) und Dina Cavcic (Mitarbeiterin im Flüchtlingsbüro, kargah e.V.), Asrin Askendery (Künstlerin, Philosophie- und Informatikstudentin).
Ziel der Berlin Lecture ist es, auf der Grundlage jüngster Erkenntnisse der Forschung gemeinsam mit Gästen aus Wissenschaft, Politik, Medienlandschaft und Zivilgesellschaft zu diskutieren, welche Herausforderungen und Folgen sich aus dem Zusammenwirken von Klimawandel und globalen Migrationsprozessen für Ökonomie, Politik und Gesellschaft ergeben. Welche direkten und indirekten Auswirkungen der Klimakatastrophe sind nach derzeitigem Stand der Wissenschaft auf globale Migrationsprozesse zu erwarten? Wie wirkt sich das Verhalten in den westlichen Industrieländern auf Migrationsprozesse selbst, sowie auf lokale Minderungs- und Anpassungsprozesse aus? Welche Rolle spielt Klimawandel für Migrationspolitiken auf internationaler, europäischer und nationaler Ebene?
Prof. Frédéric Docquier, Ph.D., wird die Berlin Lecture mit einem Vortrag zu den Folgen des Klimawandels auf lokale, interregionale und internationale Migrationsbewegungen sowie die globale Einkommensungleichheit einleiten. Prof. Frédéric Docquier lehrt an der Universität Louvain-la-Neuve in Belgien und der Universität Luxemburg. Seine Arbeiten zur neuen Ökonomie des Brain Drain sowie den Ursachen und Folgen der Migration aus der Perspektive der Sende- und Zielländer haben ihn zu einem der renommiertesten und meistzitierten Migrationsökonomen in Europa und weltweit gemacht.
Auf dieser Grundlage werden auf einer Podiumsdiskussion Cem Özdemir (Die Grünen), I.E. Maria Dizon-De Vega (Botschafterin der Philippinen), Caterina Lobenstein (Die Zeit) und Richard Anders (Extinction Rebellion) die politischen, ökonomischen und sozialen Folgen diskutieren. Prof. Dr. Herbert Brücker (BIM) führt als Moderator durch den Abend.
November 2019
-
29.11.2019
Resilienz ist die seelische Widerstandsfähigkeit oder gewissermaßen das Immunsystem der Seele. Resiliente Menschen haben die innere Stärke, Konflikte, Lebenskrisen, Unfälle, etc. oder traumatische Erfahrungen in ihrem Leben zu meistern und werden somit zum Sinnbild des Stehaufmännchens.
Es gibt Menschen, die schon in ihrer Kindheit mit schwierigen Lebensbedingungen und großen Belastungen wie Armut, Gewalt, Verfolgung und Krieg konfrontiert wurden.
Trotz dieser Entwicklungsrisiken werden sie oftmals erstaunlich stabile Persönlichkeiten. Andere dagegen, die in „wohlbehüteten“, überwiegend westlichen Nationen, aufwachsen, leiden immer mehr an psychischen Erkrankungen wie Angststörungen und Depressionen.
Wie kommt es, dass Menschen so unterschiedlich mit schwierigen Situationen umgehen? Wie können betreuende Fachkräfte ihre eigene Resilienz und die ihrer Klient*innen fördern und stärken?
Angesprochen sind vor allem Fachkräfte, die mit traumatisierten Flüchtlingen arbeiten.
-
28.11.2019
Mädchen geraten in den Fachdiskursen um unbegleitete minderjährige Flüchtlinge wie auch in der Praxis häufig aus dem Blick. Dabei stellen sich Hintergründe und Umstände der Flucht sowie Lebenssituationen der Mädchen in Deutschland häufig anders dar als bei Jungen.
Wie können sie traumatisierende Fluchterfahrungen, die Abwesenheit von Eltern und Familie verarbeiten? Sie sehen sich differenzierten Anforderungen des Schul- und Bildungssystems in Deutschland gegenüber, leben oftmals in einer rechtlich ungesicherten Perspektive – bei gleichzeitig hohem gesellschaftlichen „Integrationsdruck“. Dabei sind sie vor allem auch Mädchen mit einem Entwicklungsbedarf wie andere Mädchen auch.
Wie können erzieherische Hilfen hier bedarfsgerecht und unter Beachtung der Genderperspektive mädchengerecht wirken? Welcher Fachkompetenz der Mitarbeitenden und welcher Strukturen der Kinder- und Jugendhilfe bedarf es, mädchengerechte Arbeit zu realisieren?
Die Tagung richtet sich an Mitarbeiter_innen aus den erzieherischen Hilfen, die mit unbegleitet geflüchteten Mädchen arbeiten, sowie Mitarbeiter_innen öffentlicher Träger. Sie möchte zu den angesprochenen Fragen grundlegende Informationen vermitteln und eine Plattform bieten, sich auszutauschen, bestehende Arbeitsansätze und Konzepte zu reflektieren sowie fachliche Anforderungen und Bedingungen für eine gelingende Arbeit mit den Mädchen zu formulieren.
Deutschland ist ein vielfältiges Land. Darin liegen Chancen für die zukünftige Entwicklung in einer globalisierten Welt, aber auch Herausforderungen für das Zusammenleben der Menschen. Zudem wird spätestens seit dem „Flüchtlingsjahr 2015“ immer wieder die Frage gestellt, ob zunehmende Vielfalt den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft gefährdet. Welchen Zusammenhang also gibt es zwischen Vielfalt und gesellschaftlichen Zusammenhalt? Wie gehen die Deutschen mit Menschen eines anderen Lebensalters oder Geschlechts, mit sozial Schwachen oder Behinderten und mit der Vielfalt an sexuellen Orientierungen, Ethnien und Religionen um? Und wie lässt sich die Akzeptanz von Vielfalt stärken? In dem Webinar wird das Forschungsvorhaben „Zusammenhalt in Vielfalt: Das Vielfaltsbarometer der Robert Bosch Stiftung“ vorgestellt und wir diskutieren Antworten auf diese Fragen.
Paris, London, Madrid, Brüssel, Berlin – terroristische Anschläge auf Menschen in den Metropolen Europas haben unsere Städte verändert und stellen Politik und Gesellschaft vor neue Aufgaben. Gemeinsam mit internationalen Gästen wollen wir diskutieren, wie Metropolregionen den Herausforderungen von Radikalisierung und islamistisch motivierten Anschlägen effizient begegnen können – und zwar ohne dabei die Grundwerte von Vielfalt und Freiheit aufzugeben! Dabei vergessen wir auch nicht über die Ursachen von Radikalisierung zu sprechen und über Präventionsmaßnahmen, mit denen ihnen begegnet werden kann.
Die Förderperiode der Partnerschaft für Demokratie Stuttgart 2017-2019 geht zu Ende!
Die durch die Stadt Stuttgart (Abteilung Integrationspolitik) und den Stadtjugendring Stuttgart e.V. ins Leben gerufene Partnerschaft für Demokratie ist ein langfristig angelegtes Kooperations- und Unterstützungsnetzwerk, das seit August 2017 als starkes Bündnis aus Akteur*innen der Stadtgesellschaft ein sichtbares Zeichen für eine starke Demokratie und gegen Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in unserer Stadt setzt. Es ist in Aussicht, dass die Partnerschaft für Demokratie Stuttgart in der neuen Förderperiode 2020-2024 fortgesetzt werden soll.
In den Jahren 2017-2019 war es uns möglich, über unseren Aktionsfonds mehr als 25 sowie über den Jugendfonds mehr als 16 Projekte und Veranstaltungen zu unterstützen. Wir konnten ein Netzwerk von 30 aktiven Partner*innen etablieren und zweimal im Jahr Demokratiekonferenzen veranstalten. Ein besonderes Schlüsselelement der Partnerschaft für Demokratie sind die Aktionswochen HEIMAT – Internationale Wochen gegen Rassismus Stuttgart, die jährlich im März stattfinden, und an denen viele Netzwerkpartner*innen beteiligt sind.
-
21.11.2019
Die Fachtagung „Die Organisation des friedlichen Zusammenlebens im Spannungsfeld Migration, Integration und Sicherheit“ will zielorientiert ausloten wie Integration und Sicherheit zusammenhängen und wo sie unnötig verknüpft sind. Dabei soll die Rolle von Kommune und Polizei bei Fragen der Integration reflektiert werden und gemeinsam strategisch überlegt werden, wie das friedliche und respektvolle Zusammenleben in Zukunft in Städten und Gemeinden weiter gut gelingen kann und was es dafür in Zukunft braucht.
-
21.11.2019
Im Fokus des Fachaustauschs stehen kommunale Ansätze im Bereich der Radikalisierungsprävention. Die Veranstaltung bietet die Möglichkeit, Einblick in etablierte Projekte und Strukturen kommunal verankerter Präventionsarbeit zu gewinnen, sich über Anknüpfungspunkte und Potentiale im Bereich Radikalisierungsprävention auf kommunaler Ebene auszutauschen und die weitere Vernetzung von Akteuren aus der Radikalisierungsprävention zu befördern. Zielgruppe der Veranstaltung sind interessierte Mitarbeitende der Volkshochschulen, Respekt Coaches sowie Träger und Projekte aus der Radikalisierungsprävention.
Die Bedrohung durch islamistischen Terrorismus ist ebenso ungebrochen wie der Zulauf zur extremistischen salafistischen Szene. Der Rechtsextremismus modernisiert seine Stile und Formen, er bedroht unsere Demokratie nach wie vor.
Trotz unterschiedlicher politischer Kontexte: Freund-Feind-Denken, die Betonung von Ungleichwertigkeit, die Ablehnung von Rechtsstaat und Demokratie, ein vehementer Antisemitismus und Antiamerikanismus sowie der Hang zu Verschwörungstheorien lassen sich als ideologische Grundzüge sowohl beim Islamismus als auch beim Rechtsextremismus ausmachen. Beide Ideologien stellen Gegenentwürfe zu einer offenen und vielfältigen Gesellschaft dar.
Die Veranstaltung „Einstiegsprozesse in den Rechtsextremismus und Islamismus. Gemeinsamkeiten–Unterschiede–Gegenmodelle“ nimmt den Beginn der Lebenswege in extremistischen Szenen in den Blick.
-
20.11.2019
Papilio-Integration bestärkt Erzieher in der pädagogischen Arbeit mit Kindern mit Migrations- und Fluchthintergrund und in ihren gesundheitsfördernden Basiskompetenzen. Sie baut Handlungsunsicherheiten im Kita-Alltag ab und erhöht die interkulturelle Kompetenz der Erzieher: mit diversen Methoden und Übungen zur Wissensvermittlung, Reflexion sowie konkreten Beispielen interkulturellen Handelns.
Inhalte:
- Familien- und Bildungskulturen in den Hauptherkunftsländern
- Kultur und deren Einfluss auf unser Denken und Handeln
- Traumatisierung im Kindesalter und Erzieher-Kind-Interaktion
- Kultursensitiver Umgang mit Materialien und Routinen im Kita-Alltag
- Strategien zum Erreichen der Eltern
- Interkulturelle Kommunikation
Zielgruppen: Papilio-Trainer und andere Erwachsenenbildner mit Kenntnissen um interkulturelle Hintergründe
Umfang: 16 Unterrichtseinheiten, verteilt auf drei Tage plus ein Nachhaltigkeitstreffen
Teilnahmegebühr: 390 Euro (Förderungsmöglichkeiten durch BARMER oder AOK-Hessen auf Anfrage)
-
08.11.2019
Kulturelle Vielfalt erfordert interkulturelle Kompetenzen und eine gelingende Kommunikation im täglichen Zusammenleben. In der Kommunikation zwischen Menschen aus unterschiedlichen Kulturen kann es leichter zu Missverständnissen aufgrund von Unwissenheit, Fehlinterpretationen und Unsicherheiten kommen. Denn wir alle tragen unsere eigene „kulturspezifisch gefärbte Brille“, durch die wir andere Menschen, Gesellschaften, Religionen und im Einzelnen auch Verhaltensweisen betrachten und bewerten. Konflikte, an denen Personen unterschiedlicher kultureller Herkunft beteiligt sind, werden häufig als „interkulturelle Konflikte" wahrgenommen. Doch lassen sich tatsächlich alle Anteile eines Konfliktes aus den verschiedenen kulturellen Prägungen und Identitäten ableiten?
In diesem Seminar lernen Sie verschiedene „Kulturstandards“ und Besonderheiten interkultureller Kommunikationsprozesse kennen. Sie erhalten Impulse für den Umgang mit Missverständnissen in interkulturellen Alltags- und Arbeitssituationen und zudem Unterstützung, „fremdes Verhalten“ besser einzuordnen und zu verstehen. Anhand Ihrer eigenen Beispiele und Praxisfälle werden wir die besonderen „Fallstricke" der Konfliktbearbeitung im interkulturellen Bezugsrahmen ins Visier nehmen.
In einer modernen Einwanderungsgesellschaft ist es allen gesellschaftlichen Gruppen möglich, ihre Sichtweisen in den politischen Diskurs einzubringen und dafür zu sorgen, dass ihre Interessen Berücksichtigung finden. Allerdings finden nicht alle gesellschaftlichen Gruppen gleiches Gehör. Migrantinnen und Migranten, immerhin rund ein Fünftel der Bevölkerung, sind vielmehr auch im Jahr 2019 in politischen Debatten und nicht zuletzt auch in deutschen Parlamenten und Rathäusern politisch unterrepräsentiert.
Folglich drängen sich die Fragen auf, auf welche Hindernisse und Probleme Bürgerinnen und Bürger mit einer Zuwanderungsgeschichte bei der Wahrnehmung ihrer Interessen stoßen?
Welche gesellschaftlichen, politischen und bürokratischen Hürden müssen für eine gleichberechtigte Teilhabe überwunden werden? Und inwiefern setzt mehr politische Teilhabe aller Menschen ein Umdenken in unserer von Vielfalt geprägten Gesellschaft voraus?
Damit dreht sich die Debatte auch um Fragen von Anerkennung und Offenheit gegenüber scheinbar neuen (politischen) Ausdrucksformen und deren Wirkungsmacht.
Diese und weitere Fragen sollen im Rahmen dieser Podiumsdiskussion kontrovers diskutiert werden.
Soll man Menschen ertrinken lassen, weil sonst ein „Pull-Faktor“ für Flüchtlinge entsteht? Ist der rechtsextreme Mord an einem Politiker wirklich der richtige Anlass darüber zu reden, wie wütend manche Leute auf Angela Merkels Asylpolitik sind? Die Debatten der letzten Jahre haben es wirklich in sich. Irgendwo ging mittlerweile der Konsens verloren, dass auch Journalist*innen sich dem Grundgesetz und Menschenrechten verpflichtet sehen. Wir finden ihn wieder, versprochen.
Als Neue deutsche Medienmacher*innen liegt uns Qualitätsjournalismus im Blut und ein menschenfreundliches Diskussionsklima am Herzen. Deswegen sprechen wir darüber, wie, wann und warum (aber nicht ob) Journalist*innen Haltung zeigen können. Und danach feiern wir unseren freshen Medienpreis: Die Goldene Kartoffel ist so gefürchtet wie verdient. Wir werden sie auch 2019 sensationell gut begründet verleihen. Don’t miss it!
Oktober 2019
Wer Vorurteile abbauen will, muss Begegnungen schaffen. Dies gelingt am besten in der Nachbarschaft, im Quartier, dort wo man sich einfach nur „über den Weg läuft“ oder gemeinsam den Alltag verbringt. Aber wie kann Begegnung im Quartier gelingen? Wie können Menschen aus verschiedenen Gruppen miteinander ins Gespräch kommen?
Die Gemeinwesenarbeit (GWA) ist ein traditionsreiches, mehrdimensionales Konzept, Arbeitsprinzip und Handlungsfeld Sozialer Arbeit, das auf der Quartier- und Nachbarschaftsebene setzt. Ihre zentralen Anliegen der Partizipation, Demokratisierung und Förderung eines guten Miteinanders erfahren angesichts aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen wie der zunehmenden Spaltungen in der Bevölkerung – ökonomisch, soziokulturell, ideologisch und zwischenmenschlich, gegenwärtig neue Wertschätzung und Aufmerksamkeit.
„Migrationssensibler Kinderschutz“ und soll die tägliche Arbeit in Kindergärten, Schulen, Kinderarztpraxen und in der Jugendhilfe unterstützen. Vermittelt werden kulturelle Besonderheiten, die in der Zusammenarbeit mit Kindern, Jugendlichen
und erziehungsberechtigten Personen mit
Migrationshintergrund beachtet werden sollten.
Wie geht man im Unterricht mit einem traumatisierten Kind um? Warum kommt ein Kind nicht regelmäßig zur Schule? Wie führt man Gespräche mit Eltern, die eine andere Sprache sprechen? Wer ist Ansprechpartner in der Familie? Welche Institutionen können in der Praxis effektiv unterstützen? Auf diese und viele weitere Fragen wird es zum Kinderschutzfachtag Antworten geben. Während einer Denkwerkstatt werden die Teilnehmer in die Thematik eingeführt. Zudem gibt es die Möglichkeit eine Fachmesse zu besuchen, bei der Ansprechpartner und Unterstützungsangebote für die tägliche Arbeit vorgestellt werden.
Konfliktbearbeitung im Quartier ist so vielfältig wie die Stadtteile, in denen die Ansätze erprobt werden. Auf dem Fachtag werden fünf Ansätze vorgestellt und versucht mit den Menschen ins Gespräch kommen, die in Quartieren und Kommunen damit arbeiten.
Der Fachtag bildet außerdem den Projektabschluss vom Modellprojekt „Gewaltfrei streiten! Konfliktkompetenz individuell, gesellschaftlich und kulturell stärken“. Seit Anfang 2018 wird in Halle-Neustadt zusammen mit lokalen Akteur*innen gearbeitet, um durch Netzwerke, Fortbildungen und Begegnungen Konfliktkompetenzen vor Ort zu stärken. Formate wie Nachbarschaftsgespräche, Mediation, ein Lebendiger Neustadtkalender in der Weihnachtszeit und Gesprächsrunden zu konkreten Konflikten wurden in den letzten zwei Jahren erprobt.
-
31.10.2019
Die Frage nach Migration und Asyl polarisiert. Nicht nur in Deutschland. Hier ist die Alternative für Deutschland (AfD) stärkste Oppositionspartei im deutschen Bundestag. Im Herbst 2019 wählen Sachsen, Brandenburg und Thüringen. In Europa vernetzen sich politische Kräfte von Rom (Legar Nord, Salvini) über Wien (FPÖ, Strache), Warschau (PiS, Kaczynski) bis Budapest (Fidesz, Orban).
Die gesellschaftlichen und politischen Auseinandersetzungen um das Thema Migration, die schon längst den Sprung ins Private, ins Umfeld von Freund*innen, Bekannten und der Familie, geschafften haben bleiben nach wie vor kontrovers. Für Horst Seehofe, CSU Innen- und Heimatminister, ist die "Migration Mutter aller Probleme".
An diesen Kontroversen setzt die Fortbildung "Der Orientierungsrahmen in Zeiten gesellschaftlicher Transformation: Lernen zwischen Migration und Populismus" an.
Im Rahmen der Fortbildung wollen wir...
- ... sowohl Populismus als auch Migration nicht auf Deutschland beschränkt betrachten, sondern nach ihrer globalen Dimension und ihrem Zusammenhang fragen,
- ... der Frage nachspüren, wie Lehrende in Bildungskontexten dabei unterstützt werden können, diese Themen gemeinsam mit Lernenden zu bearbeiten, sie zur eigenen Beurteilung und Meinungsbildung zu befähigen und individuelle Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln,
- ... uns reflexiv mit Migration und Populismus auseinandersetzen: Wie stehen wir als Lehrende eigentlich selbst dazu? Welche, vielleicht auch unbewussten, Einstellungen und Positionen bringen wir selbst mit? Wie wirkt sich das u.U. auf unsere Bildungsarbeit aus?,
- ... aktuelle Erkenntnisse aus der Fachwissenschaft kennenlernen,
- ... aktuelle didaktische Ansätze – z.B. aus der Politischen Bildung und dem Globalen Lernen – kennenlernen und diskutieren,
- ... uns einen Überblick über Bildungsmaterialien in diesem Feld verschaffen. Welche Unterrichtsmaterialien existieren in diesem Bereich - auch abseits der großen und bekannten Verlage? Was ist für die eigene Bildungsarbeit geeignet, was eher nicht?
- ...in Workshops, die von NGO-Vertreter*innen durchgeführt werden, neue Anregungen für die methodische, didaktische und inhaltliche Politische Bildungsarbeit im Bereich Migration und Populismus sammeln.
Muslimische Männer stehen mittlerweile sinnbildlich für das unvereinbare, bedrohliche „Andere“… Mittlerweile? Die Gefühle und auch die Bilder, aus denen gesellschaftliche Vorstellungen resultieren, sind gar nicht so neu.
Auf dem Fachtag des Projektes „Vaterzeit im Ramadan?!“ spüren wir den Annahmen und auch den Gefühlen von antimuslimischem Rassismus aus der Vergangenheit bis in die Gegenwart nach: Wie werden Gefühle instrumentalisiert? Welche Rolle spielen Männlichkeitsbilder? Und wie werden die Stimmen der fremdgemachten Menschen aus dem öffentlichen Bewusstsein ferngehalten?
Hierzu erwartet Sie ein Programm mit Keynotes von Prof. Dr. Schirin Amir-Moazami (Freie Universität Berlin) sowie Prof. Dr. Paul Mecheril (Carl von Ossietzky Universität Oldenburg), Impulsreferaten, Reflexionen, einer Dokumentarfilm-Vorführung und einem Ausstellungsbesuch.
In Bündnissen wie #unteilbar oder #wirsindmehr
organisieren sich Menschen unterschiedlichster Hintergründe und Herkünfte.
Gemeinsam mit
Serhat Karakayali (Berliner Institut für empirische Migrations- und Integrationsforschung)
Karen Taylor (Each One Teach One)
Katja Barthold (Gewerkschafterin aus Jena) und
Danilo Starosta (Kulturbüro Sachsen)
Das intensive Theaterstück wirbelt Vorurteile und scheinbar Vertrautes, Abnickbares durcheinander und macht Platz im Kopf für neue, überraschende Verknüpfungen.
Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz hat 2018 in einem interdisziplinären und partizipativen Diskussionsprozess begonnen, Struktur- und Reformkonzepte des Betreuungsrechts zu entwickeln.
Auf dem Fachtag werden aktuelle Ergebnisse vorgestellt und ein Ausblick auf mögliche gesetzgeberische Konsequenzen gegeben. Im Fokus stehen: die Schnittstellen rechtlicher Betreuung zu anderen sozialen Hilfen, die tatsächliche Ausgestaltung und Umsetzung rechtlicher Betreuung sowie schließlich die Frage, wie es gelingen kann, geeignete Rahmenbedingungen zu schaffen, die eine qualitative Betreuungstätigkeit entsprechend der Grundrechte und der UN-BRK sicherstellen.
Die Veranstaltung bietet ein Forum, das den Teilnehmenden die Möglichkeit eröffnet, sich über gute Praxis auszutauschen und weitere Entwicklungen und Reformen, auch auf Ebene der Gesetzgebung, anzuregen und mitzugestalten.
-
23.10.2019
Die diesjährige Herbsttagung des Bundesfachverbands umF e.V. steht unter dem Motto „Gut angekommen?!“. Sie stellt neben aktuellen Themen aus der Praxis der Arbeit mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen das Thema Familie in den Fokus: Von Familienzusammenführung in der EU und aus Drittstaaten, der Arbeit mit Eltern bis zu den Angeboten der Jugendhilfe für Familien.
Die Veranstaltung bildet den Abschluss des Projektes “Gut ankommen – Fachkräfte qualifizieren. Kindgerechte Aufnahme unbegleiteter Minderjähriger” von Terre des Hommes, dem Deutschen Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. und dem Bundesfachverband umF. Das Projekt befasst sich mit der Qualifizierung von Fachkräften in Bezug auf die Umsetzung des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems. In diesem Rahmen werden Partner/innen aus der Türkei, Griechenland und Italien einen Einblick in ihre Arbeit geben und die Frage beantworten, unter welchen Voraussetzungen Zusammenführungen, Relocation und Resettlement in ihrer Praxis funktionieren und welche Unterstützung hierfür durch Fachkräfte in Deutschland geleistet werden kann.
Die Herbsttagung richtet sich an Mitarbeitende von Jugendämtern, Trägern der Jugendhilfe, Beratungsstellen, Vormund/innen und andere Personen die mit minderjährigen Geflüchteten arbeiten. Ihr Ziel ist zudem die bundesländerübergreifende Vernetzung zwischen Fachkräften.
Referentin: Johanna Mantel, Leitende Rechtsreferentin - Informationsverbund Asyl und Migration / Dozentin - Refugee Law Clinic Berlin
Zielgruppe: Das Seminar richtet sich an haupt- und ehrenamtliche Flüchtlingsberater*innen und Rechtsanwält*innen in der Flüchtlingsarbeit. Kenntnisse im Asyl- und Aufenthaltsrecht werden vorausgesetzt.
Schwerpunkte:
- Überblick über Änderungen für Geflüchtete durch die im Sommer 2019 beschlossenen Gesetze im Rahmen des „Migrationspaketes“
- Vertiefung zu den Themen Zweites Durchsetzung-Ausreisepflicht-Gesetz (z.B. Duldung „für Personen mit ungeklärter Identität“) und Ausbildungs- und Beschäftigungsduldungsgesetz
Wann ist eine Asylantragstellung sinnvoll – wann nicht? Welche Voraussetzungen müssen – vor dem Hintergrund der jüngsten Gesetzesänderungen – für die Erteilung einer (Ausbildungs-)Duldung erfüllt werden? Welche Identitätsklärungs- und Passbeschaffungspflichten bestehen? Was kann bei Widerrufsverfahren getan werden?
Diese und weitere Fragen werden durch den Rechtsanwalt Dr. Stephan Hocks beantwortet.
Behörden, Wohlfahrtsverbände und Freiwilligenorganisationen arbeiten bereits intensiv zusammen, um das Ankommen zu erleichtern und die Menschen in die Gesellschaft zu integrieren. Auch für die Zukunft müssen wir durch eine enge Kooperation das kulturübergreifende Miteinander fördern. Gerade durch Begegnung auf Augenhöhe, können sich die neuzugewanderten Menschen mit ihren Fähigkeiten in die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt einbringen. Das Thema Soziale Teilhabe mit all seinen Herausforderungen wird für uns als eine vielfältige Gesellschaft zunehmend an Bedeutung gewinnen.
Dementsprechend werden Vernetzung, Informationsaustausch und Zusammenarbeit für Entscheidungsträger und handelnde Organisationen wichtiger denn je. Das Projekt „ZWO – Zuwanderer integrieren, Wege bereiten, Orientierung geben“, und das „Willkommensnetz Flüchtlingshilfe des Bistums Trier“ möchten gemeinsam mit Ihnen das Thema „Soziale Teilhabe“ in einem Fachtag aufgreifen und die einzelnen Facetten des Themas genauer betrachten.
Wir möchten im Fachtag Handlungsansätze für die Zukunft entwickeln: Wie können wir den gesellschaftlichen Zusammenhalt trotz zunehmender Pluralität stärken? Wie und wo können sich Neuzugewanderte proaktiv in die Gesellschaft einbringen? Sind unsere Angebote für die Integration der Neuzugewanderten noch zielführend?
-
02.10.2019
Unser Ziel ist es, einen Raum zu schaffen, um verschiedene sowohl wissenschaftliche als auch zivilgesellschaftliche Ansätze zu Antidiskriminierung, Community-Empowerment und Engagement, Solidarität und muslimisches Dasein in Deutschland zu diskutieren. Wichtig sind uns Ansätze der Diskursüberschneidungen im Kontext Flucht und Migration, um aufzuzeigen, dass in Deutschland der Antimuslimische Rassismus sich allzu oft an diesen Schnittstellen verortet und mit einer Fremdzuschreibung von Muslim*innen erfolgt.
Im Themenkomplex gehören aber auch, die Betrachtung rechtspopulistischer Tendenzen und ihren Anteil an der europäischen gesellschaftlichen Akzeptanz von Islamfeindlichkeit/Antimuslimischen Rassismus. Gerade die aktuellen Fluchtbewegungen und Migrationspolitischen Entwicklungen stellen Politik und Gesellschaft vor der Herausforderung den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern.
September 2019
In den letzten Jahren sind geflüchtete Menschen in der gesellschaftlichen Debatte immer wieder mit islamistischer Radikalisierung in Verbindung gebracht worden. Hierdurch entstanden sowohl bei Menschen aus der Hilfe für Geflüchtete wie auch bei Geflüchteten selbst häufig Unsicherheiten in Bezug auf Religiosität, dem gelebten Glauben oder einer möglichen Radikalisierung. Das Beratungsnetzwerk Grenzgänger möchte sich daher einer differenzierten Auseinandersetzung in Form eines Fachtags stellen und lädt dazu herzlich ein.
Dieser Fachtag möchte sich der Vorbeugung einer Radikalisierung unter Geflüchteten widmen, Unsicherheiten abbauen, Fragen beantworten und über das Phänomen aufklären. Dazu gehört, mögliche Gründe einer Radikalisierung und Szeneangebote für Geflüchtete in den Blick zu nehmen. Thematisiert wird auch, wie Stigmatisierung und Viktimisierung, die Geflüchtete in Deutschland erfahren, eine Abwendung von der Gesellschaft befördern können. Nicht zuletzt soll es darum gehen, wie wir gemeinsam allen Geflüchteten helfen können, in Deutschland Fuß zu fassen und sie erfolgreich beim Ankommen begleiten.
-
27.09.2019
Themen wie Liebe und Partnerschaft, Sexualität, die eigene geschlechtliche Identität und das Verhältnis zwischen den Geschlechtern gehören zum Menschsein elementar dazu. Trotzdem herrscht in sexualpädagogischen Fachkontexten oft Unsicherheit darüber, wie diese Themen auch mit geflüchteten Menschen behandelt werden können. Die Bundeskonferenz „Sexuelle Bildung und Flucht“ wird deshalb in Vorträgen, Workshops, Podiumsdiskussionen und Filmvorträgen Wege zu einer gelingenden Sexuellen Bildung im Kontext Flucht aufzeigen. Die Konferenz bündelt herausragende Expertise aus Theorie und Praxis: Die Hochschule Merseburg ist mit den deutschlandweit einzigartigen Studiengängen in Angewandter Sexualwissenschaft und Sexologie führend auf dem Gebiet der Sexuellen Bildung. Der Burgenlandkreis wiederum hat als bisher einziger Landkreis in Deutschland ein umfassendes Konzept zur Sexuellen Bildung im Kontext Flucht erarbeitet und umgesetzt und konnte dabei viele Erfahrungen in der Arbeit mit Fachkräften, Einrichtungen und Geflüchteten zum Thema Sexualität sammeln.
Workshops:
- Sexuelle Bildung im Fluchtkontext – praktische pädagogische Arbeit (Karoline Heyne, freie Referentin für Sexuelle Bildung und Sexualpädagogik)
- Sexualpädagogisches Arbeiten mit jungen Geflüchteten (Helge Jannink, Institut für Sexualpädagogik ISP Hamburg/Berlin)
- Sexualpädagogik und Prävention sexualisierter Gewalt in der Arbeit mit Mädchen / jungen Frauen (Dr. Delal Atmaca, DaMigra)
- ZANZU - Einsatz des Webportals in der Praxis(Diana Kostrzewski, BZgA)
- Männlichkeit, Sexualität, Migration (Carina Großer-Kaya, LAMSA)
- Betroffene sexualisierter Gewalt unterstützen: Erfahrungen aus der traumasensiblen Beratungsarbeit (Michaela Koch und Daniela Rackow, Wildwasser Halle)
- Schutzkonzepte und Prävention sexualisierter Gewalt (Maria Urban und Prof. Dr. Heinz-Jürgen Voß, Hochschule Merseburg)
Am Nachmittag finden verschiedene Workshops statt, unter anderem zu den Themen „Kultur, Heimat, Identität – Wie soll die Debatte geführt werden?“ und „Kulturinstitutionen als Orte des Gemeinschaffens“.
-
25.09.2019
Was bedeutet „Qualität in der Arbeit mit Kindern, jungen Menschen und Familien“ aus Sicht der MitarbeiterInnen von Jugendämtern, Einrichtungen/Dienste öffentlicher und freier Träger, Forschung und Lehre aus Sicht der gesellschaftlichen Verantwortung?
Dieser und weiterer Fragen wird sich der 3.Thüringer Fachkräftekongress intensiv widmen.
„Migration kommunal gestalten – zusammen leben, streiten, wachsen“: Dies ist im Rahmen der Interkulturellen Woche am 24. September 2019 von 9.00-16.00 Uhr Thema einer Konferenz des Fachdienstes für Migration und Integration und der Fachstelle Interkulturelle Öffnung des AWO Regionalverbandes Mitte-West-Thüringen e.V.
Neben einem Vortrag von Herrn Prof. Dr. El-Mafaalani, medial präsent unter anderem als Autor des Buches „Das Integrationsparadox: Warum gelungene Integration zu mehr Konflikten führt“, wird es Raum für Austausch in verschiedenen Panels geben, die von Expert*innen geleitet werden. Behandelte Themen sind dabei unter anderem „Soziales Miteinander und gesellschaftliches Klima“ (Prof. Dr. El-Mafaalani), „Bildung im Kindesalter“ (Fr. Binder vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend) oder „Zuwanderung und Wohnen“ (Prof. Dr. Helbig von der Universität Erfurt).
Neben der Gelegenheit zu einer aktuellen Bestandsaufnahme sowie zur Vernetzung bietet der Fachtag die Möglichkeit, gemeinsam lokale Antworten auf gesamt-gesellschaftliche Fragen zu einem gelingenden Miteinander zu finden.
Zuwanderung, demografischer Wandel und der gesellschaftliche Umbruch durch Digitalisierung sind enorme Herausforderungen für unsere Demokratie und das Zusammenleben in unserer Gesellschaft. Für die Kommunen zeigen sich diese Veränderungen ganz unmittelbar und direkt im Sozialraum des Quartiers, der Gemeinde: im Gemeinwesen vor Ort.
Wie gehen die Kommunen mit diesen “neuen Nachbarschaften” um? Wie gelingt das Zusammenleben trotz der z.T. schwierigen Herausforderungen? Dabei zeigt sich Gemeinwesenarbeit als ein wirksames Konzept. Entsprechend entwickeln immer mehr Kommunen eine Strategie zur Gemeinwesenarbeit.
- Was ist professionelle Gemeinwesenarbeit?
- Was braucht Gemeinwesenarbeit um “Gute Nachbarschaft” zu ermöglichen?
Diese und weitere Fragen sollen an diesem Tag mit Expert*innen sowohl aus der Planung, als auch aus der Sozialarbeit betrachtet werden. Im Mittelpunkt der Tagung stehen Praxisbeispiele von kommunalen Ansätzen aus Niedersachsen.
Präsentiert werden kommunale Strategien sowohl aus dem städtischen als auch aus den ländlichen Räumen.
Ziel ist es, Gemeinwesenarbeit aus Sicht der niedersächsischen Kommunen – Gemeinden, Städte und Landkreise - zu beleuchten und gemeinsam zu überlegen, wie die Verbreitung und Weiterentwicklung aussehen soll.
Am 16. September findet die Berlinkonferenz des Projektes "KASA" mit dem Titel "Qualität in der Alphabetisierung mit Zugewanderten" statt.
Anmelden können Sie sich bis zum 01.09.2019 unter kasa.buero@giz
Bitte geben Sie bei der Anmeldung eine Arbeitsgruppe (a – d) an.
Die Teilnahme ist kostenlos.
Der Arbeitskollege zieht über Minderheiten her? Im Bus beschimpft ein Fahrgast eine Kopftuchträgerin? Die Tante sprengt die Familienfeier mit diskriminierenden Sprüchen?
Wer sich in solchen Momenten sprachlos fühlt und sich nachher am meisten über sich selbst ärgert – nämlich darüber, dass er/sie nichts dazu gesagt hat – der/die ist in diesem interaktiven Kurzworkshop richtig. Schweigen kann Zustimmung bedeuten und wir wollen gegen das Schweigen angehen. Zumindest Menschen, die in ihrer eigenen Haltung verunsichert sind, können wir so erreichen. Und wir können in unserem Umfeld für ein Klima sorgen, welches demokratiefeindliche und rassistische Parolen nicht einfach hinnimmt.
Der Schwerpunkt des Workshops liegt auf dem Ausprobieren und Einüben verschiedener Gesprächstechniken.
Die GGUA e.V. und die AWO Münsterland-Recklinghausen veranstalten zum fünfjährigen Jubiläum des Psychosozialen Zentrums Refugio Münster am 13.09.2019 einen Fachtag zu dem Thema Versorgung traumatisierter Geflüchteter in Münster und Münsterland.
Viele Multiplikator*innen, wie Sozialarbeiter*innen in Flüchtlingsunterkünften, Mitarbeiter*innen verschiedener Behörden, Schulsozialarbeiter*innen und Freiwillige aus Willkommensinitiativen wenden sich an unserer Beratungsstelle um Informationen und Handlungsmöglichkeiten zu erfahren in Bezug auf Unterstützung und Umgang mit Mädchen und Frauen, die von frauenspezifischer Gewalt betroffen sind. Doch was bedeutet geschlechtsspezifische Gewalt und wie können betroffene Mädchen und Frauen unterstützt werden?
Wir werden uns in dem Workshop intensiv mit verschiedenen Formen von geschlechtsspezifischer Gewalt beschäftigen: Genitalverstümmlung, Frauenhandel, Zwangsverheiratung und Häuslicher bzw. Innerfamiliärer Gewalt.
Ziel des Workshops ist eine Sensibilisierung zu den o.g. Themen und über Informationen zum Hilfesystem und den rechtlichen Möglichkeiten die Handlungsfähigkeit von Unterstützenden zu erhöhen.
-
15.09.2019
Im Paradigma der „Flüchtlingsabwehr“ gibt die Politik zusehends humanitäre und rechtsstaatliche Errungenschaften preis. Kirchengemeinden reagieren darauf mit klarem Einstehen für Flüchtlingsrechte und Humanität – auch mit Kirchenasyl.
Im 25. Jahr ihres Bestehens lädt die Ökumenische Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche e.V. herzlich ein, um über Erfahrungen im Kirchenasyl zu reflektieren, Herausforderungen zu diskutieren und Zukunftsperspektiven zu suchen. Aktive und Interessierte aus Kirchengemeinden, Nachbarschaften und Kirchenasylnetzwerken sind herzlich willkommen.
MitGeN (Migration. Geschlechtergleichstellung. Niedersachsen.) ist ein Netzwerk von Akteur*innen aus den Bereichen Gleichstellung, Teilhabe und Migration, das mit dem Ziel arbeitet, Geschlechtergleichstellung in Niedersachsen zu fördern.
Neben einer Vorstellung des Netzwerks und einem Vortrag von Prof. Dr. Maureen Maisha Auma mit anschließender Diskussion wird es nachmittags Tische zum Mitdiskutieren zu Themen wie Intersektionalität, praktische Männlichkeitskritik mit Migranten* oder LSBTIQ* geben. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, beim Speed-Dating diverse Akteur*innen und gelingende Projekte aus der Migrations- und Teilhabearbeit aus ganz Niedersachsen kennenzulernen.
Das breite Veranstaltungsprogramm aus Wissenschaft und Praxis richtet sich an alle Akteur*innen der Arbeitsfelder Flucht, Migration, Gleichstellung und Teilhabe. Sie erwartet eine Vielzahl an Projektvorstellungen und Impulse für die Praxis sowie Diskussionen mit Expert*innen und kollegialer Austausch.
Die Veranstaltung wird mitgestaltet von: kargah e.V., mannigfaltig e.V., Gleichberechtigung und Vernetzung e.V., Queeres Leben in der Migrationsgesellschaft, amfn e.V., Flüchtlingsrat Niedersachsen e.V., Bundesverband Netzwerke von Migrantenorganisationen e.V., MiSO Netzwerk Hannover e.V., Arbeits- und Sozialberatungs-Gesellschaft e.V.
Der Fokus der jährlich stattfindenden Veranstaltung liegt in diesem Jahr auf dem Thema "Kinderschutz im Abschiebungskontext". Berücksichtigt werden dabei auch Fragen, die sich bei der Anerkennung von Sorgerechtsentscheidungen sowie beim Einrichten von einstweiligen Schutzmaßnahmen (nach der Brüssel IIA-VO bzw. Haager Kinderschutzübereinkommen) stellen.
"Yes, we can!" Dieser Ausruf, der ursprünglich aus einer Zeichentrickserie stammt, avancierte in den vergangenen Jahren zum politischen Statement. "Wir schaffen das!" wurde zur Verbalisierung der kollektiven Selbstwirksamkeitserwartung hinsichtlich aufkommender (inter)nationaler Herausforderungen, zumindest seitens der politischen Akteur*innen. Genauer betrachtet sagt dieser Satz jedoch nichts darüber aus, wer eigentlich was zu schaffen hat, geschweige denn wie. Hinsichtlich der wieder "neuen" Herausforderungen in 2015, eine Vielzahl neu ankommender Menschen aufzunehmen, wurde das "Wir" als deutsche Aufnahmegesellschaft und das "Was" als die neu ankommenden Menschen interpretiert.
Jungen* und junge Männer*, die Fluchterfahrungen gemacht haben, sind mindestens in der nahen Vergangenheit in ihrem Handeln erstaunlich wirksam gewesen. Von der Planung, Organisation und Finanzierung bis hin zur eigentlichen Flucht, wurden massive Ressourcen aufgetan und in Form vielfältiger Handlungen aktiviert. Zudem beginnt der Ausblick auf ein besseres Leben mit einer Vielzahl von Aufträgen im Gepäck, mit denen sie sich in ein Hilfesystem begeben, welches strenge Anforderungen an diese jungen Menschen stellt. Das Bedürfnis danach ein selbstbestimmtes Leben zu führen, erhöht den (Selbst-)Druck. All das sind Aufgaben, Situationen und Hürden, die mehr als nur Routine abverlangen. Gegenteilig verlangt dies ein extra Maß an geistiger wie körperlicher Anstrengung und Ausdauer.
Das Dilemma zwischen Druck und eingeschränkter Handlungsfähigkeit kann zudem Übertragungseffekte auf Fachkräfte haben, die sich in der Arbeit mit geflüchteten Jungen* befinden. Diese Übertragungseffekte können Symptome von sekundärer Traumatisierung und Burnout verursachen. Daher ist es zentral die Erwartungen an eigene Wirksamkeit der jungen Männer* nachzuvollziehen, um sie sensibilisiert für die Anforderungen ihrer individuellen Lebenswelt zu begleiten.
In dieser Fortbildung werfen wir einen Blick auf das Konzept von Selbstwirksamkeitserwartungen und erarbeiten Mechanismen und Schutzfaktoren, die Selbstwirksamkeit erfahrbar machen und erweitern. Zudem werden wir uns, mit einem Fokus auf Ressourcenorientierung und Resilienzförderung, der eigenen Selbstwirksamkeit im professionellen Handeln widmen, um einen achtsamen Blick auf Selbstfürsorge zu entwickeln und uns individuelle Strategien aneignen, die uns in Überlastungsmomenten widerstandsfähiger machen.
August 2019
Vielfalt ist nicht erst durch die vermehrte Zuwanderung der letzten Jahre in fast allen Alltagsbereichen angekommen. Vielmehr ist sie schon lange erlebte und gelebte Realität im Arbeitsalltag.
Fachkräfte der Migrations- und Gleichstellungsarbeit stehen vor der Herausforderung, die Vermittlung der heterogenen Bedürfnisse und Perspektiven von Mitarbeiter*innen und Kolleg*innen, von der sogenannten ‚Mehrheitsgesellschaft‘ und von Zugewanderten gelingend in Einklang zu bringen. Sie möchten die gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft ermöglichen und Benachteiligungen abbauen.
Welche Rolle spielen dabei Geschlecht und Migrationserfahrung für die gesellschaftlichen Teilhabemöglichkeiten? Wie kann in der täglichen Arbeit auf migrations- und geschlechtsspezifische Vielfalt und Unterschiedlichkeit eingegangen werden? Welche (un)problematischen Rollenvorstellungen haben Zugewanderte eigentlich? Und welche eigenen Bilder und die der ‚Mehrheitsgesellschaft‘ gilt es zu hinterfragen?
Wenn Kolleg*innen, Freund*innen, Familie und andere Verwandte rechtspopulistische Einstellungen zeigen, bewusst oder unbewusst sich rassistisch oder diskriminierend verhalten, sind wir oft überrumpelt und in der Situation sprachlos. Was tun, in solchen Situationen? Ignorieren? Das Thema wechseln? In die Diskussion gehen? Sich zurückziehen? Wie kann Mensch in solchen Situationen kompetent reagieren, für eine Auseinandersetzung offen sein, aber auch Grenzen ziehen und sich schützen? In diesem Workshop werden wir gemeinsam die Antworten auf diese Fragen überlegen. Gerne können eigene Fälle und Fragen eingebracht werden.
Der Workshop richtet sich an ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer*innen und andere Interessierten.
Die Teilnehmer*innenzahl ist auf 15 begrenzt. Um Anmeldung unter samo.fa@miso-netzwerk.de wird bis zum 20. August gebeten.
Die Veranstaltung findet in Kooperation mit QLM – Queeres Leben in der Migrationsgesellschaft statt.
Seit 1945 hat es viele Migrationsbewegungen nach Deutschland gegeben. In aktuellen Debatten finden sie jedoch wenig Beachtung. Der Historiker Jan Plamper will mit seinem Buch "Das neue Wir – Warum Migration dazugehört" eine neue Perspektive auf die deutsche Einwanderungsgeschichte geben. Am 12. August diskutiert er darüber auf einer Veranstaltung der Heinrich-Böll-Stiftung mit der Sozialwissenschaftlerin Naika Foroutan und der Journalistin Ferda Ataman.
Vortrag und Gespräch
- * Prof. Dr. Jan Plamper, Autor und Professor für Geschichte am Goldsmiths College, London
- * Prof. Dr. Naika Foroutan, Direktorin des „Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung“ (BIM), Berlin
- Gesprächsführung: Ferda Ataman, Journalistin, Sprecherin "Neue deutsche Organisationen", Berlin
Juli 2019
Am 10. Juli 2019 findet das nächste BumF-Vertiefungsseminar statt, diesmal in Kassel. Referent des eintägigen Seminar zu den Themen „Niederlassungserlaubnis, Widerrufsverfahren und Passpflicht bei minderjährig Eingereisten“ ist Rechtsanwalt Stephan Hocks.
Inhalte des Seminars
- Was sind die Voraussetzungen für Niederlassungserlaubnis und Einbürgerung – welche Sonderregelungen gibt es für minderjährig Eingereiste?
- Widerrufsverfahren und Verlängerung von Aufenthaltserlaubnissen bei Abschiebungsverboten, subsidiärem Schutz und Flüchtlingsanerkennung – was kann getan werden?
- Passbeschaffungspflicht bei Aufenthalts- und Niederlassungserlaubnissen
-
06.07.2019
Der Verein "Afrika United e.V." richtet am 5. und 6. Juli 2019 den 2. Afrikanischen Kulturtag im Kunstkreishaus (5. Juli) und im Bürgergarten (6. Juli) in Hameln aus. Am 5. Juli ist eine politische Podiumsdiskussion mit dem Schwerpunkt auf Fluchtursachen und die Rollen Frankreichs und Englands geplant. Am 6. Juli wird ein vielfältiges Programm bestehend aus Tanz, Trommeln und Theater, wie auch jeder Menge toller kulinarischer Gerichte geboten.
Am Freitag, 5. Juli 2019 wird von 17:00 Uhr bis 21:00 Uhr im „Kunstkreis Hameln“ (Rathausplatz 4, 31785 Hameln) eine politische Podiumsdiskussion zu folgenden Themen stattfinden:
- Die wahren Fluchtsursachen aus Afrika und die Folgen
- Die Rolle Englands und insbesondere Frankreichs in ihren jeweiligen ehemaligen Kolonien Afrikas
- Frankreich und England, verlängerter Arm der Europäischen Union in Afrika
- Doppelrolle Englands und insbesondere Frankreichs als Feuerwehrmann und Brandstifter in Afrika.
Jeder ist eingeladen. Alle Teilnehmenden haben die Möglichkeit, mit den Referenten zu diskutieren.
Referenten:
- Herr Uwe Hiksch, Mitglied im Bundesvorstand der Naturfreunde Deutschlands
- Herr Jan Zimmermann Journalist und Reporter bei BR / ARD
- Herr Steve Becko Berater im Kommunikationspolitik aus Elfenbeinküste mit Wohnsitz in Frankreich
- Ein Vertreter der Seebrücke Hameln
Am Samstag, 6. Juli 2019 wird von 12:00 Uhr bis 17:30 Uhr im Bürgergarten Hameln ein Afrikanisches Kulturfest stattfinden:
Moderation:
Frau Alberta K. & Herr Ibrahim Jammeh
Programm:
12:00 – 12:20 Uhr: Eröffnung / Vorstellung des Programms
12:20 – 12:40 Uhr: Eröffnungsrede des Oberbürgermeisters der Stadt Hameln Herr Claudio Griese
12:45 – 13:05 Uhr: Perkussion (Afrika United)
13:10 – 13:45 Uhr: Tanz-, Perkussion mit der Musikgruppe „Zaouri“ von der Elfenbeinküste
13:50 – 14:10 Uhr: Traditionelle Tanzaufführung mit Aicha & Mubarakat, Glocken Rhythmus „Afrika United
14:15 – 14:55 Uhr: Präsentation einer kleinen Szene, die aus einem traditionellen afrikanischen Königshof besteht: Eine Abwanderung Junger arbeitsfähiger Menschen aus dem Dorf. Eine Dürre, die seit mehr als einem Jahr über das Königreich wütet, ganze Herden dezimiert, gelten als Fluch. Um eine Lösung zu diesem Fluch zu finden, berief der König den Rat der Weisen und Priester ein, um die Götter und Vorfahren zu beschwören.
15:00 – 15:20 Uhr: Präsentation einiger Könige Afrikas in traditionellen afrikanischen Outfits (Modenschau)
15:25 – 15:55 Uhr: Perkussion und Tanz mit der Trommelgruppe „Zaori“
16:00 – 16:20 Uhr: Trommelgruppe „Bantaba“ aus Hameln
16:25 – 16:35 Uhr: Afrikanische moderne Tanzaufführung mit Aicha und Kindern
16:40 – 17:30 Uhr: Perkussion, Tänze in verschiedenen afrikanischen Masken mit der traditionellen afrikanischer Volksgruppe „Zaori“
Außerdem bestehen während des Festes folgende Angebote:
- Verkostung verschiedener afrikanischer Gerichte
- Zubereitung von Ingwersaft durch Aicha
- Internationales Fußballturnier mit deutschen und ausländischen Teams
- Kinderprogramm: Tombola, Hüpfburg
- Infostand der Seebrücke Hameln
- Infostand von Amnesty International
- Haare flechten mit Clarisse
- Afrikanischer Basar, Pavillons
- Verschiedene Arten von afrikanischen Spielen
Die Abschlussveranstaltung des Afrikanischen Kulturtages findet am Samstag, 6. Juli 2019 von 21:00 bis ca. 3:00 Uhr in Form einer „Afro–Latino Night“ mit DJ Sesay & Revelino im freiraum Hameln (Walkemühle 1a, 31785 Hameln) statt. Der Einlass erfolgt ab 20:30 Uhr.
Immer wieder sind Fachkräfte in Kitas herausgefordert, neue und bedürfnisorientierte Entwicklungsprozesse zu initiieren, Strukturen und Abläufe weiter zu entwickeln oder pädagogische Prozesse vor dem Hintergrund aktueller Alltagsanforderungen zu verändern. Für Kinder und Familien mit Fluchterfahrungen kann die Kita ein wichtiger Begleiter sein, um das Ankommen und Einleben zu unterstützen.
Was brauchen Kinder und Familien mit Fluchterfahrungen? Wie kann ein stärken- und ressourcen-orientierter Umgang mit ihnen gefördert und gelebt werden? Welche konkreten Hilfen stehen Fachkräften in Kitas zur Verfügung?
Diesen und ähnlichen Fragen widmet sich unser Fachtag. Ziel ist es, Kita-Teams in der Begegnung mit Kindern und Familien mit Fluchterfahrungen zu unterstützen. Dazu wird es am Vormittag fachliche Impulse zu Bedingungen und Voraussetzungen der pädagogischen Begleitung sowie zu Aspekten möglicher psychosozialer Belastungen geben. Im Nachmittagsteil bieten wir drei parallel stattfindende Workshops an. Workshop 1 und 2 bauen vertiefend auf die Inhalte des Vormittags auf. Workshop 3 richtet sich an Teilnehmende, die in ihrem Kita-Alltag einer konkreten Herausforderung bei der Begleitung geflüchteter Kinder und Eltern gegenüberstehen und an einer zielgerichteten Fallberatung interessiert sind.
Menschen auf der Flucht sind besonders gefährdet, Gewalt zu erfahren und/oder ausgebeutet zu werden. Die besondere Gefährdung bleibt auch im europäischen Aufnahmeland bestehen. Faktoren wie prekäre Unterbringung, eingeschränkte Rechte, Lücken im Unterstützungssystem sowie fehlende Informationen zur eigenen rechtlichen Situation können das Risiko erhöhen, in ausbeuterische Situation zu gelangen. In Deutschland stehen Betroffenen von Menschenhandel besondere Schutzrechte zu. Doch nur, wenn sie als Betroffene von Menschenhandel erkannt werden, können sie ihre Rechte wahrnehmen und Unterstützung erhalten.
Bereits im letzten Jahr veranstaltete der KOK Webinare zur Einführung in das Phänomen Menschenhandel speziell für Mitarbeiter*innen in der Beratungs- und Unterstützungsstruktur für Geflüchtete. Das rege Interesse an Basiswissen zum Phänomen Menschenhandel hat aufgezeigt, dass bundesweit ein großer Bedarf an Informationen zu rechtlichen Situation von Betroffenen von Menschenhandel sowie zum Unterstützungssystem für Betroffene von Menschenhandel in Deutschland besteht.
Zielgruppe:
Im letzten Jahr richteten sich die Webinare gezielt an Mitarbeiter*innen in Unterkünften für Geflüchtete. Für die kommenden Webinare ist die Zielgruppe auf die verschiedenen Akteure in der Unterstützungsstruktur für Geflüchteten ausgeweitet und richtet sich u.a. an Sozialarbeiter*innen, Asylverfahrensberater*innen, Gewaltschutzkoordinator*innen, Sicherheitspersonal, Kinderbetreuer*innen in Flüchtlingsunterkünften und ehrenamtliche Unterstützer*innen.
Inhalt:
Wie bereits im letzten Jahr bietet das kostenfreie Angebot umfassende Information zum Thema Menschenhandel im Kontext von Flucht und ermöglicht den direkten Austausch mit Expert*innen. Zudem werden konkrete Handlungsmöglichkeiten für Fachkräfte aufgezeigt.
-
02.07.2019
Feindselige Blicke. Beschimpfungen, nicht nur online, sondern im Alltag. Überall, jederzeit. Rassismus gegenüber Menschen, die als muslimisch wahrgenommen werden, ist trauriger Alltag. Wer sie ablehnt, sei verunsichert, heißt es dann beschwichtigend – durch islamistische Attentate, durch radikalisierte Rückkehrerinnen und Rückkehrer aus den Kriegsgebieten in Syrien und dem Irak oder die Unterstützernetzwerke des militanten Salafismus und des Dschihadismus. Der Kurzschluss funktioniert: Schnell wird gefragt, ob „der Islam“ wirklich friedfertig sei, tauglich für die Moderne und ob er wirklich zu Deutschland gehören könne.
Doch wie wirken sich Ablehnung, Hass und Gewalt auf das Leben von Musliminnen und Muslimen beziehungsweise auf Menschen, die von anderen als solche wahrgenommen werden, aus? Und schließlich: Wie kann antimuslimischem Rassismus begegnet werden?
Das vollständige Programm sowie die Anmeldung sind online zu finden:
Juni 2019
Was sind die Voraussetzungen für Niederlassungserlaubnis und Einbürgerung – welche Sonderregelungen gibt es für minderjährig Eingereiste? Welche Passbeschaffungspflichten bestehen bei Aufenthalts- und Niederlassungserlaubnissen? Was kann bei Widerrufsverfahren getan werden? Was muss bei der Verlängerung von Aufenthaltserlaubnissen beachtet werden?
Diese und weitere Fragen werden durch den Rechtsanwalt Dr. Stephan Hocks beantwortet.
Vorläufiges Programm
- 9:00 Anreise und Stehkaffee
- 9:30 Begrüßung und Einführung
- Niederlassungserlaubnis und Einbürgerung bei minderjährig Eingereisten
- 12:30 Mittagspause
- 13:30 Passbeschaffungspflicht bei Aufenthalts- und Niederlassungserlaubnissen
- 15:00 Pause
- 15:15 Schutz mit Verfallsdatum? Widerrufsverfahren und Verlängerung von Aufenthaltserlaubnissen bei Abschiebungsverboten, subsidiärem Schutz und Flüchtlingsanerkennung.
- 16:00 Fallbesprechungen
- 17:00 Ende
-
25.06.2019
Im Rahmen des International Peace Centre auf dem 37. Deutschen Evangelischen Kirchentag in Dortmund stellen Expert*innen aus Afrika und Europa Ansätze von lokaler Migrationspolitik vor und diskutieren über die verschiedenen Herangehensweisen.
Zeitplan:
- What is Better Migration? Niels Annen MdB, minister of state, German Federal Foreign Office, Berlin Dr. h. c. Erastus Mwencha, president, African Capacity Building Foundation, Nairobi/Kenya
- The Impact of EU Migration Policy on the Local Population in East Africa - Dr. Albaqir Alafif Mukhtar, director, Al-Khatim Adlan Center for Enlightenment, Khartoum/Sudan
- The Migration Business: Trade in Refugees - Prof. Dr. Mirjam van Reisen, International Relations, Innovation and Care, Tilburg/Netherlands
- Panel Diskussion
Moderation: Marina Peter, Bread for the World, Berlin
Sprecherinnen für das Publikum: Kirsten Mittmann, Bremen, und Christian Reiser, Berlin
Musik: Sauti Ya Ushindi, Malula/Tansania
-
19.06.2019
Sprache, Information und Wertschätzung helfen den Geflüchteten, ihre Integration in Deutschland selbst in die Hand zu nehmen. Daneben ist es wichtig, dass sie sich in ihrer neuen Umgebung von Anfang an wohlfühlen. Durch Freizeit- und Beschäftigungsangebote kann die viele freie Zeit bereichernd gestaltet werden, und die Geflüchteten können sich in ihrer neuen Umgebung wirksam erleben. Das Modul zeigt erfolgreiche Projekte, Tipps, Anregungen und Vorgehensweisen aus der Praxis.
Referent*in: Cecilia Westerholt und Philipp Gockel
-
19.06.2019
Vom 18. bis 19.06.2019 bietet die Internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen (IGfH) in Kooperation mit dem BumF eine zweitägige Fortbildung zum Thema “Junge Geflüchtete im Übergang gut begleiten” in Frankfurt an.
Alle jungen Menschen aus der stationären Jugendhilfe stehen beim Hilfeende vor vielfältigen Herausforderungen. Dies gilt in besonderer Weise für junge Geflüchtete: Veränderte, z.T. nicht aufeinander abgestimmte rechtliche Rahmenbedingungen, Zurechtfinden in gesellschaftlich neuen Kontexten, in der eigenen Wohnung ankommen und in der Unsicherheit eine eigene – wenn auch kurzfristigere – Lebensperspektive entwickeln und verfolgen. Die oft abrupte rechtswidrige Hilfebeendigung nach dem 18. Lebensjahr kann die jungen Geflüchteten in eine krisenhafte Situation bringen.
Themen der Fortbildung sind u.a.:
- Überblick über die verschiedenen rechtlichen Rahmenbedingungen.
- parteilich Zukunftsperspektiven mit den jungen Menschen entwickeln – auch im Hinblick auf aufenthaltssichernde Schritte.
- Lebensunterhaltssicherung: Welche Leistungssysteme sind nach der Jugendhilfe für die jungen Menschen zuständig? Wie stellt man wo Anträge?
- Schule erfolgreich abschließen und Zugänge zu Ausbildung und Arbeit gestalten.
Die Fortbildung bietet Zeiträume für kollegiale Fachaustausche für Mitarbeiter/innen. Grundlagen im Asyl- und Aufenthaltsrecht sowie SGB VIII werden vorausgesetzt.
-
18.06.2019
Durch die steigende Zahl an Kindern mit Migrations-und Fluchthintergrundwachsen die Anforderungen an das pädagogische Fachpersonal. Einerseits haben einge-reiste und geflüchtete Kinder besondere Bedarfe. Ande-rerseits sollen alle Kinder gleichermaßen bedarfsgerecht und professionell betreut werden.
Ein zentrales Anliegen der Fortbildung Papilio-Integration ist, den ErzieherInnen zu vermitteln, dass sie bereits viele der notwendigen Fähigkeiten besitzen. Die Fortbildung bestärkt ErzieherInnen in ihren pädago-gischen Basiskompetenzen. Diese bewusst zu machen bedeutet auch, sie im Alltag besser nutzen zu können. Die Verknüpfung der eigenen Fähigkeiten mit den neuen Situationen eröffnet kultursensitives pädagogisches Handeln und baut Unsicherheiten ab.
in Niedersachsen leben rund 700.000 Frauen mit einer Zuwanderungsgeschichte. Viele von ihnen leben schon lange bei uns und sind fest verwurzelt. Manche haben ihre Heimatländer erst kürzlich verlassen und bemühen sich, mit ihren Familien in unserer Gesellschaft Fuß zu fassen. Frauen spielen eine entscheidende Rolle bei der Integration ihrer Familienangehörigen und damit für den gesellschaft lichen Zusammenhalt insgesamt. Vor allem der Zugang zu Bildung und Arbeit wirkt sich positiv auf die eigene Integration und die Erfolgschancen der Kinder aus. Mütter mit Schulbildung und Arbeit sind die besten Vorbilder für ihre Kinder. Sie können „Türöffnerinnen“ zur hiesigen Kultur werden und damit die Bildung von Parallelgesellschaften verhindern.
In der sechsten Integrationskonferenz unter dem Titel „Werkstatt Frauen mit Flucht und Zuwanderungsgeschichte“ wird es nun um konkrete Maßnahmen und Fragen zur Integration von geflüchteten und zugewanderten Frauen gehen: Wie können wir die gleichberechtigte Teilhabe von Migrantinnen in Gesellschaft, Arbeit und Kultur unterstützen? Welche sprachlichen, kulturellen und sozialen Barrieren gilt es zu überwinden? Wie gelingt es, geflüchtete Frauen an das Gesundheitssystem heranzuführen? Wie erreichen wir die Frauen mit Sprachkursen, und wie können wir die Instrumente und Angebote bedarfsgerecht weiterentwickeln? Welche Kompetenzen und Potenziale bringen die Migrantinnen mit? Wie erleichtern wir die Anerkennung beruflicher Abschlüsse und Kompetenzen und was macht erfolgreiche Qualifizierungsprojekte aus? Was bedeutet Teilhabe konkret im Alltag und welche Kontakte und Türöffner können Frauen mit Fluchtbiografie nutzen?
Diese und weitere Fragen werden wir in vier WerkstattForen „anpacken“, dabei Hemmnisse und Handlungsansätze aufzeigen und gemeinsame Lösungen erarbeiten. Auf einem Markt der Möglichkeiten wird sich eine Fülle „Guter Beispiele“ und ermutigender Projekte präsentieren. Erstmalig halten wir ein Angebot zur Kinderbetreuung bereit, um auch jungen Müttern zu ermöglichen, sich einzubringen. Gemeinsam mit den vielen Partnerinnen und Partnern des Bündnisses aus Kommunen, Arbeitsagenturen, Vereinen und Verbänden, Beratungsstellen, netzwerken und der Zivilgesellschaft lade ich Sie herzlich ein: Seien Sie am 3. Juni mit dabei, bringen Sie Ihre Kompetenz ein, tauschen Sie sich aus und zeigen Sie: Niedersachsen packt an!
Mai 2019
IBIS Interkulturelle Arbeitsstelle e.V. in Oldenburg (Nds.) veranstaltet einen Fachtag zur sensiblen Beratung und Unterstützung von queeren Geflüchteten.
Für viele Geflüchtete, besonders LSBTI* (Lesben, Schwule, Trans*- und Inter*-Personen), stellt die Ankunft in Deutschland noch längst kein sicheres Ankommen dar, denn sie sind nicht nur vor Krieg, gewaltsamen Konflikten oder Armut geflohen, sondern auch vor Verfolgung aufgrund ihrer sexuellen oder geschlechtlichen Identität. – Wie geht es für diese Menschen in Deutschland weiter?
Queere Geflüchtete können aufgrund ihrer Herkunft sowie ihrer sexuellen oder geschlechtlichen Identität häufig Mehrfachdiskriminierungen in Deutschland ausgesetzt sein. Zudem werden sie mit langwierigen Asylverfahren konfrontiert, bei denen sie möglichst detailliert über ihre diskriminierenden Erfahrungen im Herkunftsland berichten sollen. Dadurch ist für viele auch in Deutschland ihr unsicherer Weg noch nicht vorbei. Wie kann das verändert werden?
Während des Fachtages „Angekommen – aber sicher?!“ sollen die Teilnehmenden für den Umgang mit queeren Geflüchteten sensibilisiert werden. Wie schaffe ich ein offenes und zugleich sicheres Umfeld? Welche Strukturen gibt es vor Ort, die dabei unterstützen können? Welche Strukturen könnten dem im Weg stehen? Bin ich möglicherweise ein Teil davon? Wie kann ich für queere Geflüchtete ein sicheres Ankommen ermöglichen? – Diese und weitere Fragen sollen in Vorträgen und Workshops diskutiert und Lösungen erarbeitet werden.
Der Fachtag richtet sich an alle, die geflüchtete Menschen haupt- oder ehrenamtlich beraten, begleiten oder unterstützen. Weitere Informationen samt Ablaufplan können Sie dem beigefügten Flyer entnehmen.
Die Fortbildung vermittelt einen vertieften Einblick in das Migrationsrecht. Thema sind Veränderungen im Asyl- und Aufenthaltsrecht und ihre konkrete Umsetzung und Praxis in Niedersachsen. Die neuen Regelungen und ihre Auswirkungen werden umfassend dargestellt und bewertet. Im Einzelnen werden folgende Inhalte bearbeitet:
Themen im Bereich AsylG, u.a.:
- Änderungen in der Praxis des BAMFs
- Widerrufverfahren
- Geschlechtsspezifische Verfolgungsgründe
- Anerkannte Drittstaatsangehörige
Themen im Bereich AufenthG, u.a.:
- Passbeschaffungsmöglichkeiten und Grenzen
- Arbeitsverbot
- AsylblG-Kürzungen
- Verlängerungen des Aufenthaltstitels
Referentin: Claire Deery, Fachanwältin Migrationsrecht (Göttingen)
Zielgruppe:
Das Seminar richtet sich an haupt- und ehrenamtliche Beraterinnen und Berater von Flüchtlingen, die bereits über fortgeschrittene Kenntnisse des Aufenthalts- und Asylrechts verfügen.
Vielfalt ist nicht erst durch die vermehrte Zuwanderung der letzten Jahre in fast allen Alltagsbereichen angekommen. Vielmehr ist sie schon lange erlebte und gelebte Realität im Arbeitsalltag.
Fachkräfte der Migrations- und Gleichstellungsarbeit stehen vor der Herausforderung, die Vermittlung der heterogenen Bedürfnisse und Perspektiven von Mitarbeiter*innen und Kolleg*innen, von der sogenannten ‚Mehrheitsgesellschaft‘ und von Zugewanderten gelingend in Einklang zu bringen. Sie möchten die gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft ermöglichen und Benachteiligungen abbauen.
Welche Rolle spielen dabei Geschlecht und Migrationserfahrung für die gesellschaftlichen Teilhabemöglichkeiten? Wie kann in der täglichen Arbeit auf migrations- und geschlechtsspezifische Vielfalt und Unterschiedlichkeit eingegangen werden? Welche (un)problematischen Rollenvorstellungen haben Zugewanderte eigentlich? Und welche eigenen Bilder und die der ‚Mehrheitsgesellschaft‘ gilt es zu hinterfragen?
Bisher bestätigte Referent*innen:
- Prof. Dr. Sabine Hess, Direktorin des Göttingen Centers for Global Migration Studies, Georg-August Universität Göttingen
- Johanna Elle M.A., Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Verbundforschungsprojekt "Gender, Flucht, Aufnahmepolitiken. Prozesse vergeschlechtlichter In- und Exklusionen in Niedersachsen"
Themen:
Warum braucht es Gewaltschutzkonzepte in Gemeinschaftsunterkünften? Welche besonderen (konfliktfördernden) Faktoren und Trigger existieren in Gemeinschaftsunterkünften? Wie können wir gewaltvorbeugende Maßnahmen in Gemeinschaftsunterkünften implementieren?Was ist eine partizipative Risikoanalyse und wie wird sie durchgeführt?Welche Handlungsoptionen gibt es bei Gewaltvorfällen und was muss bedacht werden?Zielgruppe:
Der Fachtag richtet sich an Sozialarbeiter*innen in Flüchtlingsunterkünften und an weitere Personen, die haupt- oder ehrenamtlich in Gemeinschaftsunterkünften tätig sind.
-
31.10.2019
Über einen Zeitraum von fünf Monaten erhalten die Teilnehmenden in mehreren Workshops Fachkenntnisse über die Berufsbilder Pflege, Betreuung und Hauswirtschaft und lernen anhand praktischer Übungen, was bei der Unterstützung von Pflegebedürftigen zu beachten ist. Die erworbenen Kenntnisse können in einem 12-wöchigen Praktikum in einer Pflegeeinrichtung erstmals angewandt werden. Die Besonderheit: Die Teilnehmenden werden während des Praktikums von einem geschulten Paten begleitet. Ein Bewerbungstraining rundet das Angebot ab.
Start: 20. Mai
Ende: 31. Oktober
Dauer: Immer Montag bis Donnerstag von 9 bis 13 Uhr (ca. 5 Monate)
Ort: Berlin Steglitz-Zehlendorf
-
19.05.2019
In Leipzig wollen wir nicht nur gemeinsam über das konstitutive Verhältnis von Migration und Gewalt diskutieren, sondern gerade jetzt gemeinsam mit Akteur*innen vor Ort eine breite Allianz gegen zunehmend autoritäre und gewaltvolle gesellschaftliche Positionen bilden. Wir freuen uns auf vier spannende Tage mit Workshops, Vernetzung, Vorträgen, Theater, Tanz und Lesung.
-
07.06.2019
"Sehr geehrte Damen und Herren,
wir laden Sie herzlich zu unserer Tagung „Flüchtlinge – Impulse für die ehrenamtliche Arbeit“ nach Hannover ein, mit der wir Ihre Arbeit vor Ort unterstützen und begleiten wollen.
Zu Beginn des Vormittags freuen wir uns auf Rechtsanwältin Claire Deery aus Göttingen, die uns über die aktuellen Rechtsentwicklungen im Asylbereich informieren wird.
Die Wege in den Arbeitsmarkt und die Ausbildung für Geflüchtete steht im Mittelpunkt des zweiten Teils des Vormittags. Wir danken Olaf Strübing vom Flüchtlingsrat Niedersachsen e.V. (u.a. Projekt Arbeitsmarktzugang für Flüchtlinge – AZF3) sehr herzlich für seine Bereitschaft zu kommen und uns einen Überblick zu geben.
Am Nachmittag widmen wir uns in fünf Arbeitsgruppen einem breiten Themenspektrum (Ausländer- und sozialrechtliche Fragen, Mieterführerschein, Kirchenasyl, Rückkehr/Rücküberstellung/Weiterwanderung/Härtefallkommission, Arbeitsmarkt und Ausbildung) und danken den fünf Referentinnen und Referenten, die mit ihrer Kompetenz jeweils eine der Arbeitsgruppen verantworten und bereichern:
a) Claire Deery, Göttingen, Rechtsanwältin
b) Imke Fronia, Diakonieverband Hannover-Land, Burgdorf
c) Hildegard Grosse, Ökumenisches Netzwerk „Asyl in der Kirche“ in Niedersachsen, Arnum
d) Magdalena Kruse, Raphaelswerk e.V., Hannover
e) Olaf Strübing, Niedersächsischer Flüchtlingsrat, Hannover"
Wer darf sich in Europa über Grenzen hinweg frei bewegen? Wer wird bewegungsunfähig gemacht? Für wen gelten die Grenzen im Schengenbereich und für wen sind sie unsichtbar? Diese und weitere Fragen erörtern wir in unserem Symposium am 11. Mai 2019 in der Johanneskirche in Witten. Wir möchten einen Raum schaffen, in dem sich Hauptamtliche, Ehrenamtliche, Aktivist*innen, Studierende, Menschen mit Fluchterfahrung und weitere Interessierte begegnen und gemeinsam über Möglichkeiten der innereuropäischen Bewegungsfreiheit für Geflüchtete diskutieren.
Die rechtliche Lage für geflüchtete Menschen wird in Europa immer prekärer. Verordnungen wie Dublin III illegalisieren die Mobilität von Geflüchteten zwischen EU-Staaten. Dies hat enorme Auswirkungen auf das Leben des/der Einzelnen. In dem Symposium möchten wir daher der rechtlichen Diskriminierung, der sogenannte Dublin-Geflüchtete ausgesetzt sind, auf den Grund gehen und gemeinsam über Alternativen zur innereuropäische Bewegungsfreiheit für Menschen mit Fluchterfahrung nachdenken. Dabei soll eine Sensibilität für die Lebenssituation von Menschen geschaffen werden, die von der Dublin-Verordnung betroffen sind.
Nach einer Einführung zu Dublin III wird der aktuelle Stand der Diskussion zur Dublin-Verordnung im Europaparlament skizziert. In der sich anschließenden Podiumsdiskussion diskutieren Aktivist*innen, Wissenschaftler*innen und Betroffene gemeinsam darüber, wie Grenzregime entstehen (politisch, rechtlich und als soziale Konstruktionen) und wie diese Geflüchtete in ihrer Bewegungsfreiheit und ihrem Alltag einschränken. Nachmittags wollen wir uns in kreativen und partizipativen Workshops mit der Frage nach Möglichkeiten zur Unterstützung legaler Migrationswege und Alternativen zum aktuellen Rechtssystem auseinander setzen. Zwischendurch wird es Zeit zur Vernetzung und zum Austausch geben.
-
09.05.2019
Viele der Betroffenen bleiben mittel- bis langfristig in Deutschland. Ein Ausschluss von frühen Integrationsleistungen erschwert die spätere Integration, grenzt die Betroffenen aus und verursacht soziale Folgekosten. Vielfach wurden deshalb ordnungspolitische Restriktionen aufgehoben, um den Zugang zu gesichertem Aufenthalt, Ausbildung, Sprachförderung und Erwerbsintegration zu verbessern. Allerdings gilt das nur teilweise, denn die Zugänge zu Regelangeboten und zielgruppenspezifischer Sprachförderung sind je nach Status unterschiedlich ausgestaltet. Auch werden manche Regelungen in der Praxis nicht so umfassend oder einheitlich angewandt, wie vom Gesetzgeber beabsichtigt. Hier werden zum einen Praxiserfahrungen ausgewertet und diskutiert. Zum anderen werden die aus dem Koalitionsvertrag folgenden Schritte einschließlich der angekündigten
bundesweiten Strategie des Forderns und Förderns diskutiert.
Darüber hinaus werden aktuelle Fragen des Asylbewerberleistungsgesetzes aufgegriffen. Das betrifft mögliche anstehende Gesetzesänderungen ebenso wie Leistungen und Förderungen im Bereich von Studium und Ausbildung.
Auch wenn der Frauenanteil gerade bei schweren Gewaltdelikten (nach wie vor) äußert gering ist: Dass Extremismus und Radikalisierung keine rein männlichen Phänomene sind, dürfte mittlerweile unumstritten sein. Daher bemühen sich Forscher und Praktiker seit geraumer Zeit um eine genderreflektierte Präventionsarbeit. Dahinter steht die Annahme, dass erfolgreiche Radikalisierungsprävention das Verständnis über die geschlechtsspezifischen Dynamiken und Vorstellungen von Männlich- und Weiblichkeit radikaler Szene braucht, um dieses Wissen in die jeweiligen präventiven Angebote einfließen lassen zu können.
Ohne Zweifel hat sich in dieser Hinsicht seitdem Vieles getan. Trotzdem scheint es hier weiterhin Nachholbedarf zu geben, wie nicht zuletzt die Rückmeldungen von Teilnehmer(inne)n aus vergangenen Workshops nahelegen. Wiederholt wurde auf den noch immer unterschätzten Einfluss von Frauen auf die Szenebildung und -bindung hingewiesen und gefordert, genderspezifischen Aspekten in der öffentlichen Fachdebatte noch mehr Beachtung zu schenken. Diese Forderung aufgreifend, möchten wir uns in diesem Workshop der gendersensiblen Perspektive auf Radikalisierung und auf präventive Maßnahmen widmen.
Im Workshop werden wir den folgenden Fragen nachgehen:
- Welche Funktionen nehmen Frauen innerhalb radikaler Gruppen ein?
- Wie unterscheiden sich die Hinwendungsmotive von Frauen und Männern? Welche Vorstellungen zu Männlichkeit und Weiblichkeit spielen dabei eine Rolle?
- Wie sind Frauen und Mädchen präventiv zu erreichen?
- Welche Erkenntnisse bietet die Geschlechterforschung für die Arbeit im Feld der Radikalisierungsprävention? Lässt sich Wissen zu Frauen in der rechtsextremistischen Szene für die Präventionsarbeit mit Frauen im Bereich des religiös begründeten Extremismus nutzen?
Empfehlungen zum Management von Beschwerden von Menschen mit Fluchterfahrung
Zunehmend beschäftigen sich Fachpraktiker_innen und Entscheidungsträger_innen in der Sozialen Arbeit mit dem Auf- bzw. Ausbau von Beschwerdemanagement.
Funktionierende Beschwerdesysteme geben Bewohner_innen von Unterkünften für Geflüchtete die Möglichkeit, Bedürfnisse und Kritik zu äußern sowie Gewaltvorkommnisse und Missstände zu adressieren. Damit verbessern Beschwerdesysteme den Gewaltschutz. Sie entlasten aber auch Mitarbeiter_innen, beschleunigen Verwaltungsabläufe und sind ein konkreter Beitrag zur Teilhabe von Geflüchteten.
Die Ergebnisse des Projekts „Gewaltschutz für Frauen und Beschwerdemanagement in Unterkünften für Geflüchtete“ 2016 - 2019 möchten wir vorstellen und mit Ihnen diskutieren.
Im Fachtag richten wir den Blick auch auf Erfahrungen aus weiteren Arbeitsfeldern wie aus der Kinder- und Jugendhilfe oder der Antidiskriminierungsarbeit.
-
05.05.2019
- Rechte von Frauen afrikanischer Herkunft zu fördern und zu verteidigen;
- Nationale und internationale Beschwerdemechanismen zu nutzen;
- Beratungsangebote für Frauen zu schaffen, die Opfer von Diskriminierung geworden sind;
- Frauen in ihren Gemeinden zu den Menschenrechten zu schulen.
Eine Anmeldung steht Frauen afrikanischer Herkunft, ungeachtet ihres aufenthaltsrechtlichen Status, offen, die folgende Voraussetzungen erfüllen:
- Beschäftigung oder Engagement in einer Organisation, Initiative oder Einrichtung, die sich für Menschenrechte, und dabei insbesondere für Nichtdiskriminierung, einsetzt;
- Erfahrung in der Arbeit mit Frauen afrikanischer Herkunft;
- Bereitschaft eigene Trainings durchzuführen.
April 2019
Viele Menschen, die sich haupt- oder ehrenamtlich für Flüchtlinge engagieren, werden früher oder später mit den rechtlichen Rahmenbedingungen, Hürden und Grenzen konfrontiert, denen Schutzsuchende sowohl im Asylverfahren als auch danach unterworfen sind. Gleichzeitig ist das Asyl- und Aufenthaltsrecht in den letzten Jahren wiederholt geändert worden und die nächsten gesetzlichen Änderungen sind schon absehbar.
Zielgruppe: Alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen, die neu in die Flüchtlingsarbeit einsteigen wollen oder gerade eingestiegen sind, aber auch an diejenigen, die ihre Kenntnisse auffrischen möchten
Als Projekt des Integrationsbüros und in Kooperation mit lokalen Partnern hat das Projekt "PRO Prävention" zahlreiche Projekte und Initiativen zur Förderung identitärer Vielfalt, Demokratie und friedlichem Zusammenleben umgesetzt. Das Ziel: Radikalisierung vorbeugen und gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken.
Auf der Fachveranstaltung wird auf die dreijährige Projektarbeit zurückgeblickt. Die Erfahrungen und Ergebnisse werden diskutiert, gute Praktiken von Radikalisierungsprävention auf Kreisebene und in enger Abstimmung mit Kommunen und Zivilgesellschaft werden vorgestellt, blinde Flecken werden identifiziert und ein Ausblick auf die künftigen Herausforderungen in der Region wird gewagt.
1. Unverletzlichkeit der Wohnung – Dr. Hendrik Cremer, Deutsches Institut für Menschenrechte
Menschen, die in Deutschland Asyl suchen, leben häufig über lange Zeiträume – mitunter über mehrere Jahre – in Gemeinschaftsunterkünften. In diesen Einrichtungen verbringen die Erwachsenen und Kinder viel Zeit; sie wohnen, essen und schlafen auf wenig Raum. Die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften bedingt tiefe Eingriffe in die Privat- und Intimsphäre der Bewohner*innen. Regelmäßig berichten Bewohner*innen, dass ihre Wohn- und Schlafräume durch Dritte betreten oder gar durchsucht werden. Nahezu ebenso regelmäßig berichten Bewohner*innen, dass Besucher*innen oder gar ihnen selbst Zutritts- oder Hausverbote erteilt werden.
Der Vortrag beleuchtet, inwiefern diese Praxis mit dem Recht auf Unverletzlichkeit der Wohnung aus Art. 13 Grundgesetz vereinbar ist. Zudem erläutert er die verfassungsrechtlichen Anforderungen, an denen Hausordnungen für Gemeinschaftsunterkünfte zu messen sind. Im Anschluss an den Vortrag erhalten die Teilnehmer*innen die Möglichkeit zu Rückfragen und zur Diskussion.
2. Gebühren der Unterbringung – Muzaffer Öztürkyilmaz, Flüchtlingsrat Niedersachsen e.V.
Sofern Asylsuchende oder anerkannte Flüchtlinge (noch) in Gemeinschaftsunterkünften wohnen (müssen) und ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten, sind sie verpflichtet, die Gebühren der Unterbringung selbst zu tragen. Dabei werden sie teilweise mit horrenden Gebührenforderungen der Kommunen konfrontiert. So sollen Geflüchtete etwa bis zu 700 € monatlich für einen Schlafplatz in einem 35m2 Zimmer zahlen, das sie sich mit mehreren Personen teilen. Zahlungsforderungen, die in privatrechtlichen Mietverhältnissen als „Wucher“ zu werten sind, sollen in Form von öffentlich – rechtlichen Gebührenforderung rechtmäßig sein. Andere Kommunen wiederum haben die Gebühren für die Unterbringung in Flüchtlingsgemeinschaftsunterkünften auf einen Maximalbetrag gedeckelt. Der Vortrag vermittelt einen Überblick zum Gebührenrecht, vergleicht die Gebührensatzungen verschiedener Kommunen miteinander und bietet den Teilnehmer*innen ausreichend Gelegenheit, um juristische und politische Handlungsstrategien zur Problemlösung zu diskutieren.
Zielgruppe:
Das Seminar richtet sich an alle Gremien und Behörden, die für Ausgestaltung von Hausordnungen und Gebührensatzungen zuständig sind sowie an Mitarbeiter*innen von Gemeinschaftsunterkünften, aber auch an andere haupt- oder ehrenamtlich in der Flüchtlingsarbeit Tätige.
Wirkungsorientierung gewinnt in der Sozialen Arbeit immer mehr an Bedeutung. Migrationsarbeit bildet dabei keine Ausnahme. Geförderte Projekte müssen zunehmend ihre Wirkungen gegenüber dem Geldgeber nachweisen. Antragsteller für Projektförderung müssen oftmals bereits in der Planung die Wirkungsziele des Projekts benennen.
Soziale Wirkung ist dabei planbar und nichts, was zufällig entsteht. Wer Wirkungsziele benennen kann und von Anfang an im Projektalltag mitdenkt, steigert die Qualität der eigenen Arbeit – und verschafft der Organisation wertvolle Vorteile in der Kommunikation und im Fundraising. Hierfür wird der Workshop einen ersten Überblick geben und mit der Wirkungstreppe ein Tool vorstellen, welches hilft, die eigene Arbeit anhand von Indikatoren zu reflektieren und das Handeln an Wirkungszielen auszurichten.
-
10.04.2019
Die Tagung „Übergänge – Junge Geflüchtete zwischen den Systemen“ richtet sich an Mitarbeitende von Jugendämtern, von freien Trägern der Jugendhilfe, von Beratungsstellen, an (ehrenamtliche) Vormund/innen sowie an alle Aktiven, die mit jungen Geflüchteten arbeiten. Sie dient dem vertiefenden Austausch über die Arbeit mit jungen Geflüchteten und den aktuell entstehenden Herausforderungen in Übergangssituationen. Mit Übergang ist dabei jede Situation gemeint, die an der Schnittstelle verschiedener (rechtlicher) Systeme Betroffene und ihre Unterstützer/innen vor oftmals unauflösbare Probleme stellt.
Analysiert werden sollen die Unterstützungsmöglichkeiten der Begleitenden und die Handlungsoptionen der Betroffenen in den Spannungsfeldern zwischen Jugendhilfe- und Ordnungsrecht, zwischen Ausbildung und sogenannter Bleibeperspektive und zwischen Gesundheitsversorgung und kriminalisierenden Diskursen.
Ziel der Veranstaltung ist die vertiefende Auseinandersetzung mit aktuellen Problemstellungen in der Arbeit mit jungen Geflüchteten sowie die bundesländerübergreifende Vernetzung zwischen den Fachkräften.
-
09.04.2019
-
09.04.2019
Gleichzeitig werden an das Gelingen der Integration dieser jungen Menschen hohe Erwartungen geknüpft, auch in Bezug auf die Deckung des lokalen und bundesweiten Fachkräftemangels.
Vor diesem Hintergrund sind die Anforderungen an eine konkrete rechtskreis-, träger- und institutionenübergreifende Zusammenarbeit bei der Unterstützung von Bildung, Ausbildung, Arbeitsmarktintegration und Aufenthaltssicherung besonders hoch.
Die Fachveranstaltung will zur Vernetzung und zur Verbreitung sinnvoller Konzepte beitragen und die Praxis vor Ort stärken. Auch der Umgang mit besonders herausfordernden Themen wie Sucht und Delinquenz wird aufgegriffen.
Unter Berücksichtigung praktischer Erfahrungen und bestehender rechtlicher Regelungen werden fachliche Konzepte und Möglichkeiten der Zusammenarbeit zum Wohl der jungen Menschen eruiert.
-
07.04.2019
Der Caritas-Vormundschaftsverein sucht engagierte Menschen, die eine ehrenamtliche Vormundschaft für einen unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten übernehmen möchten. Die Caritas lädt alle Interessierten zur Schulungsreihe ein.
Die Schulung beschäftigt sich mit Themen des Vormundschafts-, Asyl- und Aufenthaltsrechts, der Jugendhilfe, vermittelt interkulturelle Kompetenzen und bereitet auf die Übernahme einer Vormundschaft vor. Auch im Jahr 2019 kommen noch immer unbegleitete Minderjährige in Berlin an. In ihren Heimatländern herrschen Krieg und gewalttätige Konflikte. Sie kommen aus unterschiedlichen Ländern in der Hoffnung auf bessere Bildungs- und Zukunftschancen. Der Caritas-Vormundschaftsverein hat bereits über 400 ehrenamtliche Vormundschaften für minderjährige Geflüchtete begleitet.
Es wird um eine Anmeldung an a.merkel@caritas-berlin.de bis zum 17.03.2019 gebeten.
März 2019
In der Arbeit mit Geflüchteten stellt sich einem oft die Frage, was diese Menschen in ihren Biographien durchlaufen haben – vorgestellte Bilder der Grausamkeit, des Terrors und der Angst hinterlassen bei uns ein Gefühl der Unsicherheit. Wie gehe ich hiermit um? Was kann ich sagen und wie? Dieser Workshop nähert sich diesem Gefühl der Unsicherheit von der psychologischen Seite. Zum einen wollen wir uns im Workshop damit befassen, was ein Trauma bedeutet und wann eine Posttraumatische Störung vorliegt (die Beschäftigung mit den ‚Anderen/Fremden‘). Zum anderen beleuchten wir eigene Vorstellungen sowie Wünsche und Anforderungen an die eigene Arbeit, stellen diese in einen kritischen Kontext und fragen auch nach den Grenzen eigener Handlungsmöglichkeiten (die Beschäftigung mit dem ‚Eigenen‘). Der Raum für Wissen und Reflexion kommt in der engagierten Hilfsarbeit im sozialen Bereich oft zu kurz und dieser Workshop dient als Raum, sich auch für die eigenen Belange, Sorgen und Fragen in der Arbeit mit Geflüchteten Zeit zu nehmen.
Schwerpunkte des Workshops:
- Grundlagen zur Erkennung von Traumata
- Achtsamer Umgang mit Geflüchteten
- Grenzen eigener Handlungsmöglichkeiten
- Selbstfürsorge
-
27.03.2019
Einfalt oder Vielfalt? - Diversität im Alltag
Diese Fortbildung widmet sich dem Engagement und der Stärkung der persönlichen Kompetenzen von Menschen, die in der Flüchtlingsarbeit aktiv sind. Zunächst geht es darum, die eigene Haltung zu Vorurteilen, Diskriminierung und Macht zu reflektieren, um dann gemeinsam Strategien sowie alternative Denk- und Handlungsweisen zu entwickeln, Vielfalt im Alltag zu leben. Dabei stehen praktische Erfahrungen und deren Reflexion im Vordergrund. Dadurch wird die eigene „Diversitäts-Kompetenz“ trainiert und gestärkt – unter Berücksichtigung der eigenen Bedürfnisse und derjenigen anderer Menschen.
Leitung:
Ann-Kristin Beinlich, Akademie St. Jakobushaus
Referent:
Andreas Sedlag, Hermannsburg
Eine Kooperationsveranstaltung des Bundesfachverbandes unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, der AWO-RHEINLAND und des Flüchtlingsrates Rheinland-Pfalz.
Die Anzahl minderjähriger Flüchtlinge, die mit oder ohne ihre Familien nach Deutschland geflüchtet sind, hat in den Jahren 2015/16 deutlich zugenommen. Mittlerweile sind die Jugendlichen im hiesigen System angekommen. Neben Mitarbeiter*innen der Migrationsfachdienste begleiten Fachkräfte unterschiedlichster Disziplinen die jungen Menschen. Dabei arbeiten sie mit ihren jeweiligen Sichtweisen und fachlichen Ausrichtungen.
Während des gemeinsamen Fachtages werden wir diese Ausrichtungen zum Ausgangspunkt nehmen, um gemeinsam über Herausforderungen in der Zusammenarbeit zu sprechen. Im Rahmen von Fallwerkstätten möchten wir anhand spezifischer Einzelfälle über Kooperationsstrukturen reflektieren und gemeinsam Weiterentwicklungsmöglichkeiten sowie Handlungsstrategien entwickeln.
-
23.03.2019
Im Workshop werden Methoden und Erfahrungen aus Veranstaltungen der politischen Bildung vorgestellt und ausprobiert. Das Seminar richtet sich an Multiplikator/innen in der Flüchtlingsarbeit. Wir freuen uns auf Teilnehmende ohne und mit Fluchtbiografie.
Die vorgestellten Methoden kommen aus dem Qualifizierungsprojekt »Demokratie geht nur miteinander. Partizipation und Integration von Geflüchteten«. In diesem Projekt wurden seit 2017 mehrere Workshops mit dem Titel »Auf Augenhöhe? Vor Ort gemeinsam etwas bewegen« durchgeführt.
-
31.07.2019
-
16.03.2019
Der Verein Hilfe für Jungs veranstaltet in Kooperation mit der Humboldt Universität zu Berlin einen Fachtag zum Thema “Sexualität und Gewalt in jungen Lebenswelten”. Seit 1994 unterstützt der Verein Jungen und junge Männer, die von sexueller Ausbeutung und Gewalt bedroht oder betroffen sind. Die Ziele hierbei sind, sie in der Wahrnehmung ihres Rechts auf ein Leben ohne sexuelle Gewalt zu stärken, ihre Gesundheit zu fördern und ihnen Chancen auf persönliche Entwicklung und Partizipation zu geben. Hierzu soll die zweitägige Tagung im März beitragen. Das Programm besteht unter anderem aus einer Begrüßung durch die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Franziska Giffey, die Beleuchtung der Schule als Institution sowie die Teilnahme der World Chilhood Foundation. Außerdem gibt es sowohl am ersten als auch am zweiten Tag der Fortbildung zwei Workshop-Sequenzen, in denen die Teilnehmer_innen je nach Interesse ihr Wissen mit Hilfe von Expert_innen vertiefen und ausbauen können.
Unter den in den letzten Jahren nach Deutschland geflüchteten Menschen findet sich eine nicht unerhebliche Anzahl von Menschen mit Behinderungen. Der Fachtag beleuchtet die noch unzureichend gefüllte Schnittstelle zwischen den Unterstützungssystemen für Menschen mit Behinderungen und geflüchteten Menschen. Wie ist die Lebenssituation von geflüchteten Menschen mit Behinderungen und ihren Familien? Wo liegen die Gründe für Versorgungsschwierigkeiten? Welche Lösungsmöglichkeiten gibt es? Das sind nur einige der Fragen, die die Veranstalter beantworten möchten. Der Fachtag richtet sich an Fachkräfte und ehrenamtliche Engagierte aus den Bereichen der Verbandsarbeit für Menschen mit Behinderungen, der Behindertenhilfe sowie dem Unterstützungssystem für geflüchtete Menschen.
-
05.07.2019
Nach einem erfolgreichen Start letztes Jahr bietet veedu zum zweiten Mal den Online-Marketing-Kurs zum Wiedereinstieg ins Berufsleben für nichterwerbstätige Frauen an. Der Kurs in Teilzeit findet vom 4. März bis 5. Juli 2019 im interkulturellen Familienzentrum „Familien-RING“ in Steglitz-Zehlendorf statt. Dank der finanziellen Unterstützung durch den Europäischen Sozialfonds ist der Kurs für die Teilnehmerinnen kostenlos.
18 Wochen können Frauen, die einen Wiedereinstieg ins Berufsleben anstreben, ihre Kompetenzen auf dem Fachgebiet des Online-Marketings stärken. In sechs fortlaufenden Workshops lernen die Teilnehmerinnen Grundlagen in Suchmaschinenoptimierung, Social-Media-Marketing, E-Mail-Marketing und Web-Analytics kennen und gestalten ihre eigene Webseite. Im Anschluss können die Teilnehmerinnen eine zweiwöchige Hospitation in einem lokalen Unternehmen oder einer Web-Agentur absolvieren und so erste Einblicke in den praktischen Berufsalltag erlangen. Auf einer Netzwerkveranstaltung können sie zudem Expert*innen aus der Online-Marketing-Branche kennenlernen. Durch den Mix aus Präsenzzeiten mit Kinderbetreuung sowie zeit- und ortsunabhängigen Online-Trainings ist der Kurs familienfreundlich.
Das Projekt „Marketing-Rookies – Online-Marketing-Kurse für Frauen zum Wiedereinstieg in das Berufsleben“ schafft für die Teilnehmerinnen eine Basis für einen erfolgreichen Wiedereinstieg ins Berufsleben. „Um auf dem Fachgebiet des Online-Marketing fit zu sein, muss man sich stetig weiterbilden. Gerade nach einer längeren beruflichen Unterbrechung kann der Wiedereinstieg herausfordernd sein. Deshalb möchten wir besonders alleinerziehende Frauen und Frauen in Elternzeit ermutigen, teilzunehmen und sie bei der Wiederaufnahme einer Arbeit ein Stück weit begleiten“, so die Projektleiterin Florentine Halder.
-
31.07.2019
Die Förderung des zivilgesellschaftlichen Engagements und der bürgerschaftlichen Courage im Bereich der Hasskriminalität ist Ziel des Projekts „kNOw HATE CRIME!“, das die Türkische Gemeinde in Baden-Württemberg e.V. (tgbw) landesweit umsetzt, gefördert durch den Fonds für Innere Sicherheit der Europäischen Union.
Wesentlicher Teil der dreijährigen Maßnahme ist eine Weiterbildungsreihe für Beratungs- und Handlungskompetenz im komplexen Problemfeld menschenverachtender Einstellungen, Benachteiligungen und Anfeindungen.
Diese Grundausbildung „kNOw HATE CRIME!“ setzt sich aus 8 Modulen zusammen, jeweils 4 Zeitstunden pro Modul, von März bis Juli 2019.
- Konzept der Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit (GMF) in Theorie in Praxis
- Konzept Hate Crime und Anwendung im Bereich der Polizeiarbeit
- Aktuelle Formen von Antiziganismus
- Extremismustheorie
- Aktuelle Formen von Homo- und Transfeindlichkeit
- Aktuelle Formen von Antisemitismus
- Hilfen zur Bewältigung von Opfererfahrungen
- Empowerment von potenziellen Betroffenengruppen
Die Weiterbildung wird von sehr kompetenten und erfahrenen Fachleuten geleitet. Sie wird den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen umfassenden und in dieser Komplexität sehr selten zu gewinnenden Blick auf die aktuelle Situation bieten, tiefgreifende Auseinandersetzungen mit unterschiedlichen Ansätzen, Zugangsweisen und Perspektiven ermöglichen und praxistaugliche Handlungsoptionen aufzeigen.
Der Veranstalter, die Türkische Gemeinde in Baden-Württemberg e.V., ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015 und zugelassener Träger nach dem Recht der Arbeitsförderung. Alle Teilnehmer_innen erhalten eine personalisierte Teilnahmebescheinigung.
Februar 2019
Am 28.2. wird es wuselig. Auf der großen Praxismesse Aktivierung geht es um eine der Kernaufgaben der Gemeinwesenarbeit: Wie können Bewohner*innen aktiviert werden? Vorgestellt werden bekannte Methoden wie „aktivierende Befragung“ aber auch ganz ungewöhnliche Zugänge.
Den Inhalt der Messe stellen die Veranstaltenden in einem kurzen Erklärvideo dar:
Video: Praxismesse Aktivierung
Die Anmeldung ist online möglich. Außerdem ist es möglich, eigene Methoden einreichen und präsentieren zu können.
-
27.02.2019
Bei der diesjährigen Frühjahrstagung steht neben den aktuellen rechtlichen und tatsächlichen Entwicklung – von Ankerzentren und Alterseinschätzung bis Einwanderungsgesetz – die pädagogische Praxis der Jugendhilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und die Schnittstellenarbeit mit anderen Rechtskreisen im Fokus.
Die Frühjahrstagung richtet sich an Mitarbeitende von Jugendämtern, Trägern der Jugendhilfe, Beratungsstellen, Vormund/innen und andere Personen die mit umF arbeiten. Sie ist einer der zentralen Orte des vertiefenden Austausches über die Arbeit mit umF. Ihr Ziel ist zudem die bundesländerübergreifende Vernetzung zwischen Fachkräften.
Zum Ankommen gehört es auch, das eigene und gesellschaftliche Umfeld mitgestalten und für seine Belange einstehen zu können. Im Mittelpunkt dieses Seminars stehen die Fragen: Wie können wir in der Flüchtlingsarbeit Voraussetzungen schaffen, damit Flüchtlinge sich selbst organisieren und repräsentieren können? Wie kann dabei die Asymmetrie zwischen Ehrenamtlichen und Flüchtlingen vermieden bzw. abgebaut werden?
Die Referenten mit und ohne Fluchtgeschichte geben Hintergrundwissen und praktische Tipps, wie Flüchtlinge in das Gemeindeleben und in die Arbeit eines Vereins eingebunden werden können, um einer Begegnung auf Augenhöhe näher zu kommen.
Anmeldung bei:
Mira Berlin
Referentin "Vernetzung des Ehrenamts"
E-Mail: Ehrenamt1.at.frnrw.de
Tel: 0234 58 73 15 82
Die Institutionen, die an den Asylverfahren in Deutschland beteiligt sind, sehen sich ständigen Änderungen der politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen gegenüber. In den letzten Jahren haben sich durch die hohe Zahl von Verfahren bei den Verwaltungsgerichten besondere Herausforderungen ergeben. Richterinnen und Richter weisen zunehmend nicht nur auf Überlastung hin, sondern auch darauf, dass die Asylverfahren beim zuständigen Bundesamt für Migration und Flüchtlinge häufig oberflächlich und fehlerhaft durchgeführt würden. Auf diese Weise werde die Durchführung eines angemessenen Verfahrens auf die Gerichtsebene verlagert. Bei der Veranstaltung soll diskutiert werden, was die am Verfahren beteiligten Institutionen tun können, um Fairness und Qualität der Verfahren aufrechtzuerhalten.
Die Veranstaltung findet aus Anlass des 20-jährigen Bestehens des Informationsverbunds Asyl und Migration statt. Der Vertreter des UN-Flüchtlingshilfswerks in Deutschland, Dominik Bartsch, wird hierzu einleitend mit einem Grußwort ebenso beitragen wie Wolfgang Grenz, der für Amnesty International an der Gründung des Vereins beteiligt war.
-
10.02.2019
Fachtagung der niedersächsischen IvAF-Verbünde AZF III, FairBleib, Netwin3 und TAF sowie des Bremer Verbundes BIN zu 10 Jahren Erfahrungen in der Integration und Vermittlung von Flüchtlingen in Ausbildung und Arbeit.
Auf dieser Veranstaltung werden Herausforderungen und Erfahrungen in der Arbeitswelt bei der Integration von Flüchtlingen in Arbeit, Ausbildung und Qualifizierung gesammelt, ausgetauscht und kritisch diskutiert. Beiträge aus Politik, Verbänden und Wissenschaft werden ergänzt von Inputs aus der Praxis, um zu einer produktiven Gesamtschau zu kommen. Die Tagung wird somit von Inputs, aber auch genug Zeit für Austausch und Diskussion geprägt sein. Eingeladen sind Alltagsexpert/innen genauso wie jene aus Politik, Wissenschaft und Verbänden.
Nach drei Jahren Projektlaufzeit wollen wir in einer zweiten Fachveranstaltung mit Ihnen das Thema Empowerment geflüchteter Frauen vertiefen. In einem Vortrag zum Thema:„Geflüchtete Frauen im Spannungsfeld zwischen Verlust und Neuanfang“ geht die Referentin Gabriele Fischer der Frage nach, was Frauen in den unterschiedlichen Phasen des Ankommens empowert.Gabriele Fischer ist Diplompsychologin, Psychologische Psychotherapeutin/ DPTV.
Mit der VIA Verbund für Integrative Angebote Berlin gGmbH und dem Verbund für Altenhilfe und Gerontopsychiatrie Steglitz-Zehlendorf wurden zwei starke Partner gefunden, die sich seit vielen Jahren in der Berliner Pflegelandschaft engagieren. Aus dem Bezirk Steglitz-Zehlendorf wird das Projekt außerdem vom Bezirksamt und dem Jobcenter unterstützt. Dank der finanziellen Unterstützung durch den Europäischen Sozialfonds ist die Weiterbdilung für die Teilnehmenden kostenfrei.
Nach der Pilotphase sind drei weitere Projektdurchläufe mit erweiterten Inhalten ab Frühjahr 2019 geplant.
Mehr Informationen finden Sie unter: www.neustart-pflege.de
Interessierte können sich dort oder direkt bei Anne Woltmann anmelden (Tel. 030 789 5460 13).
-
02.02.2019
Januar 2019
Seit Jahrhunderten leben Roma in Deutschland. Sie gehören ebenso wie deutsche Sinti zu den vier in Deutschland anerkannten Minderheiten. Oft wahrgenommen als Balkanflüchtlinge handelt es sich bei den neu zugewanderten Roma hauptsächlich um Arbeitsmigrantinnen und -migranten aus EU-Staaten.
Roma waren und sind massiv von Vorurteilen und Ausgrenzung betroffen. Doch was wissen wir wirklich? Wie sieht die Realität in Vergangenheit und Gegenwart aus? Welche Wege gibt es, die gesellschaftliche Akzeptanz und Wertschätzung sowie die Partizipationsmöglichkeiten von Romafamilien in Thüringen zu erhöhen?
Ergänzt wird die Veranstaltung durch die Vorstellung des 2017 gegründeten Landesverbandes der Roma Thüringens: RomnoKher Thüringen e.V.
In einem anschließenden ExpertInnengespräch mit ausgewählten Gästen, die jeweils einen besonderen Bezug zum Thema haben, wird Zeit für weiterführende oder vertiefende Fragen und Diskussion sein.
Politische Teilhabe und gesellschaftliche Integration stehen in einem engen Wechselverhältnis. Dies wird in den Debatten um Flucht, Migration und Integration bisher nur unzureichend thematisiert. Die Tagung schlägt einen Perspektivwechsel auf das Thema Flucht und Geflüchtete vor: Weg von der „Krisensemantik“ hin zu einem Verständnis von Flucht als Katalysator gesellschaftlicher Entwicklungen. Im Fluchtkontext sind in den Bereichen Bildung, Arbeit und Beteiligung neue Konzepte hinsichtlich Diversity, Antirassismus, Menschenrechte angestoßen und implementiert worden. Die Tagung fokussiert daher Fragen politischer Selbstermächtigung und Mitbestimmung, nicht zuletzt stellt sie Geflüchtete als „neue Akteure“ der Zivilgesellschaft in den Mittelpunkt.
Flucht und Migration sind als Themen in der politischen Bildung verankert. Neben politischer Bildung über Flucht und Migration existieren im Schul-, Arbeits- und außerschulischen Kontext verschiedenste Projekte, Tandemangebote, Mentoringprogramme usw. für und mit Geflüchteten und auch für die Aufnahmegesellschaft, die oft mit Sprachangeboten oder sozialer Arbeit verbunden sind.
Das Ziel politischer Bildung ist politische Mündigkeit und politische Handlungsfähigkeit. Das Recht auf Teilhabe auch im Bereich des Politischen ist ein Menschenrecht. Diese Perspektive zeigen auch die bisherigen Ergebnisse des Seminars „Flucht als Thema der politischen Bildung“, welches Vorläufer der Fachtagung ist und im laufenden Semester in Kooperation der Berliner Landeszentrale für politische Bildung und des Otto-Suhr-Instituts der Freien Universität Berlin angeboten wird.
Den hier aufgeworfenen Fragen nach Selbstermächtigung, Mitgestaltung und politischer Bildung geht die Fachtagung mit zwei Impulsvorträgen und vier Workshops nach und diskutiert abschließend auf dem Podium die Ergebnisse aus den Perspektiven von Politik, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Geflüchtetenselbstorganisationen.
Teil 1: Muslimische Vielfalt und gelebter Islam in NRW
Teil 2: Radikalisierungswege von Jugendlichen
Teil 3: Möglichkeiten der Prävention und Intervention
Die Veranstaltungsreihe in NRW wird organisiert von der Landeszentrale für politische Bildung, dem Integrations- und Schulministerium und dem Ministerium des Innern. Sie richtet sich an pädagogische Fach- und Lehrkräfte.
-
19.01.2019
Im Seminar wird kulturspezifisches Hintergrundwissen vermittelt, eigene wie unbekannte Werte und Verhaltensweisen plastisch erlebbar gemacht. Die Teilnehmer*innen erarbeiten sich Wissen über islamische Modelle des Umgangs mit Konflikten. Mit den Erfahrungen aus dem Workshop erweitern sich Ihre Handlungsoptionen und Sie agieren auch in angespannten Situationen professionell und situationsgerecht.
Seit ihrer Gründung führt die Refugee Law Clinic Hannover eine Ringvorlesung zum Migrations- und Flüchtlingsrecht durch. Darin erläutern wechselnde Dozent*innen die aktuellen Themen und bieten Einblicke in die asylrechtliche Praxis. Die Ringvorlesung ist dabei Teil unseres Fortbildungskonzepts und dient den Berater*innen zur Auffrischung und Vertiefung ihrer bisherigen Kenntnisse. Die Ringvorlesung richtet sich aber auch immer an ein interessiertes Fachpublikum. Sie sind herzlich willkommen!
Constantin Hruschka ist Senior Research Fellow am Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik und beschäftigt sich seit Jahren mit asyl- und aufenthaltsrechtlichen Fragestellungen. In seinem Vortrag wird er den Widerruf und die Rücknahme des Schutzstatus betrachten. Denn es ist davon auszugehen, dass das BAMF in der Zukunft vermehrt derartige Verwaltungsakte erlassen wird und damit der Aufenthalt in Deutschland gefährdet ist.
Die Veranstaltungen finden alle auf dem „Conti-Campus“ der Leibniz Universität Hannover (Königsworther Platz 1, 30167 Hannover) statt. Raum 1209 (12. Etage) im Conti-Hochhaus (Gebäude 1502).
Migrationspolitisches Forum des Forschungszentrums Ausländer- und Asylrecht sowie des Exzellenzclusters „Kulturelle Grundlagen von Integration“ der Universität Konstanz.
Welche Qualifikationen bringen Geflüchtete mit? Hat sich die sogenannte Westbalkan-Regelung bewährt, womit Menschen aus Albanien, Bosnien, Kosovo, Mazedonien, Montenegro und Serbien der Arbeitsmarktzugang in Deutschland erleichtert wurde? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt einer Veranstaltung mit dem Titel "Wechselwirkung zwischen Flucht- und Erwerbsmigration", die das Migrationspolitische Forum des Forschungszentrums Ausländer & Asylrecht an der Universität Konstanz am 15. Januar ab 14 Uhr in Berlin organisiert.
Dezember 2018
Care, Migration und Gender sind auf offensichtliche und weniger offensichtliche Weise miteinander verwoben. Bridget Anderson zeigt, wie die "Drecksarbeit" in der Pflege an marginalisierte Subjektpositionen delegiert wird. Das von Rhacel Salazar Parreñas entwickelte Konzept der Care Chain unterstreicht die Tatsache, dass Care-Arbeiter_innen selbst reproduktive Aufgaben hinterlassen, die wiederum von anderen nach ihrer Migration übernommen werden müssen. Der Queer-Theoretiker Martin F. Manalansan hinterfragt die implizit angenommene Heterosexualität von Care-Migrant_innen. Weitere Untersuchungen zeigen, dass Care-Arbeiter_innen nicht nur Opfer sozialer Strukturen sind, sondern selbst aktiv Entscheidungen treffen. Dies eröffnet Debatten über Handlungsmacht. Nach bedeutenden Publikationen von Rajni Palriwala und Helma Lutz stellen sich Fragen darüber, wer Handlungsmacht hat und wie sich Care-, Migrations- und Gender-Regimes darauf auswirken. Weiterhin ist Care-Migration ein Effekt globaler Ungleichheiten und ermöglicht gleichzeitig Ausbeutung und Empowerment. Das vorherrschende Narrativ besteht aus Pflegekräften, die aus dem globalen Süden und postsozialistischen Gesellschaften in den globalen Norden auswandern – jedoch findet Care-Migration auch innerhalb des Globalen Südens und zwischen postsozialistischen Gesellschaften statt. Darüber hinaus ist das Verhältnis zwischen Care-Arbeiter_innen und Care-Empfänger_innen alles andere als eindeutig. Die Strukturen (und Hierarchien) von Abhängigkeit und Macht hängen von den jeweiligen gesellschaftlichen Positionen sowie dem Zugang zu Rechten und Anerkennung ab. Zusätzlich können Migrant_innen auch Care-Empfänger_innen sein, aber einige Care-Empfänger_innen müssen möglicherweise migrieren, um Zugang zu Care zu erhalten.
Die Konferenz "Care - Migration - Gender. Ambivalent Interdependencies" bietet einen Raum, um diese Interdependenzen gemeinsam in ihrer Komplexität zu untersuchen und eine Diskussion über solche Ambivalenzen anzuregen. Insbesondere werden wir auf Folgendes eingehen:
- Welche Formen haben die Interdependenzen von Care – Migration – Gender an verschiedenen Orten, in verschiedenen Bereichen und mit verschiedenen Interessengruppen?
- Wie sind die Interdependenzen von Care – Migration – Gender durch unterschiedliche Impulse, Interessen und Repräsentationen geprägt?
- Wie werden die Interdependenzen von Care – Migration – Gender politisch, rechtlich und sozial geregelt?
- Wie und mit welchen Zielen und Wirkungen haben sich Care-Arbeiter_innen selbst organisiert?
Wir laden Sie herzlich zur Fachtagung „Hand in Hand fürein gewaltfreies Miteinander“ im Rahmen des bundesweiten Projekts „MiMi – Gewaltprävention für geflüchtete Frauen, Kinder und Männer“ ein. Das Projekt bündelt gemeinsam mit Migrant*innen seit 2016 die Kapazitäten engagierter Geflüchteter und Migrant*innen mit Fachdiensten und lokalen Netzwerken. In transkulturellen Mediator*innenschulungen, muttersprachlichen Informationsveranstaltungen unter Zuhilfenahme von Ratgebern zum Thema „Gewaltschutz und regionale Hilfsangebote“ werden von Gewalt bedrohte geflüchtete Frauen und Familien bundesweit über Schutzmaßnahmen aufgeklärt und unterstützt.
Die Veranstaltung findet am Mittwoch, den 12.12.2018, von 10:00-16:00 Uhr im Forum St. Joseph, Isernhagener Str. 63, 30169 Hannover, statt.
Organisiert vom Netzwerk für traumatisierte Flüchtlinge in Niedersachsen e.V. in Kooperation mit der Niedersächsischen Landesstelle für Suchtfragen. Gefördert durch das niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung.
Eine Einladung mit detailliertem Tagesprogramm folgt in Kürze.
Die Zuwanderung von Geflüchteten fordert Kommunen bis heute. Sind mittlerweile Fragen der Unterbringung und ersten Betreuung weitgehend geregelt, rücken Fragen der Integration in die Gesellschaft stärker in den Fokus. Erfahrungen zeigen: Integration gelingt nicht kurzfristig, sondern ist eine Daueraufgabe. Die beteiligten Akteure müssen bestehende Prozesse, Maßnahmen und Regelungen kontinuierlich reflektieren und überdenken. Sowohl die praktischen Herausforderungen für die Integration in die Stadtgesellschaft als auch die Ungewissheiten und Ängste der Stadtbevölkerung bedürfen neuer Aushandlungsprozesse auf lokaler Ebene.
Diesen Aushandlungsprozess nimmt die Fachtagung "(Neu-)Zuwanderung bewegt - sozialer Zusammenhalt in der Stadtgesellschaft" auf und fragt, wie wir angesichts zunehmender Vielfalt sozialen Zusammenhalt in der Stadtgesellschaft erfolgreich gestalten können.
Wie steht es um die Vielfalt in deutschen Redaktionen und Pressebüros? Wie können Migranten die interkulturelle Kompetenz im Journalismus stärken? Und wie partizipieren Zugewanderte an einem gesellschaftlichen "Wir"? Diese Fragen thematisiert eine Fachkonferenz des "Zentrums für Europäische und Orientalische Kultur" und des Instituts für Kommunikations- und Medienwissenschaft der Universität Leipzig am Freitag ab 9 Uhr.
Seit einigen Jahren existieren zahlreiche Migrantinnenorganisationen, die ihre Ansprüche neu definieren und sich eher als „Neue Deutsche“ verstehen, denn als Einwanderinnen. Ihre Botschaft lautet: „Wir gehören dazu und wollen mitreden“. Für sie steht nicht mehr die Frage der Integration im Mittelpunkt, sondern die der Repräsentation. Mehrsprachige Migrantinnenmedien stellen in Deutschland eine Praxis dar, mit der die Sprechenden aufeinander Bezug nehmen. Sie setzen sich für eine ausgewogene und sachliche Berichterstattung zu Migrations- und Integrationsthemen ein und ermöglichen Teilhabe, wodurch sie eine bedeutsame Rolle für die Stärkung der Gemeinschaften und Individuen spielen. Diese Kommunikatorinnen wollen nicht nur über „Integrationsmaßnahmen“ reden, sondern über gleiche Rechte und Chancen. Die jahrelange Fixierung auf “die” Migrantinnen soll beendet werden und ein neues gesamtgesellschaftliches „Wir“ entstehen. In der postmigrantischen Gesellschaft übernimmt jede soziale Verantwortung für die Gemeinschaft.
Auf der Jahresabschlussveranstaltung des projekt.kollektiv am 6. Dezember im Stadtmuseum Düsseldorf möchten wir einen Rückblick auf das vergangene Projektjahr werfen, über die Perspektiven von jungen geflüchteten Menschen in NRW „zwischen Ausgrenzung und Empowerment“ diskutieren und gemeinsam die Zukunftspläne des Projekts im kommenden Jahr beleuchten. Wir freuen uns sehr, dass Prof. Dr. Kemal Bozay den Keynote-Vortrag mit dem Titel „Migration & Flucht als Herausforderung für die (Jugend-)Sozialarbeit: Rassismus- und diskriminierungskritische Perspektiven" halten wird.
Das projekt.kollektiv des IDA-NRW nimmt seit Beginn in den Blick, dass junge Geflüchtete und Selbstorganisationen als Multiplikator*innen der Jugendarbeit sowie als Akteur*innen in eigener Sache anerkannt und in die Jugend(bildungs-)arbeit einbezogen werden müssen. 2018 wurden im Rahmen des Projekts mit Vernetzungstreffen und einer Zukunftswerkstatt Impulse zum Aufbau von landesweiten Vernetzungsstrukturen und Räumen des Empowerments für junge geflüchtete Menschen und People of Color in NRW gesetzt.
Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an:
- Junge Geflüchtete, die als (zukünftige) Multiplikator*innen in eigenen Initiativen oder Organisationen aktiv sind oder sein möchten
- Selbstorganisierte (Willkommens-)Initiativen, Vereine und Einzelpersonen
- Pädagogische Fachkräfte und Multiplikator*innen der Offenen Jugendarbeit, der Jugendverbandsarbeit, der Jugendsozial- und der Jugendbildungsarbeit
Deutschland ist ein Einwanderungsland. Das ist die Wirklichkeit. Alle gesellschaftlichen Teilbereiche werden von Migration geprägt - vom Bildungssystem über den Arbeitsmarkt bis hin zu zivilgesellschaftlichen Strukturen. Migration und die damit einhergehenden Folgen werden immer noch vorwiegend als Problem wahrgenommen. Dabei wird vergessen, dass Migration immer mehr zu einer neuen Normalität wird, verbunden mit großartigen Chancen. So bleiben angesichts des demografischen Wandels und des Arbeitskräftemangels schon heute viele Stellen unbesetzt. Die Industrie- und Logistikbranche, die Pflegebereiche und das Handwerk sind zunehmend mit einer „Nachwuchsklemme“ konfrontiert.
Im Rahmen des 23. Forums Migration 2018 wollen wir mit Expertinnen und Experten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, aus Kirchen, Verbänden und Migrantenorganisationen diskutieren, wie Einwanderung unseren Alltag prägt und wie Migration zukünftig gestaltet werden muss. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, inwiefern Migration einen Beitrag dazu leisten kann, den Fachkräftebedarf abzumildern, vor welchen Herausforderungen wir dabei stehen und welche Lösungsansätze zwingend erforderlich sind.
Themen sind unter anderem:
- Eckpunktepapier Fachkräfteeinwanderung aus Drittstaaten
- Wie der Arbeitskräftemangel unsere Wirtschaft bedroht
- Migration, Deutschland und die Europäische Union
-
07.12.2018
November 2018
-
01.12.2018
Im Seminar wird kulturspezifisches Hintergrundwissen vermittelt, eigene wie unbekannte Werte und Verhaltensweisen plastisch erlebbar gemacht. Die Teilnehmer*innen erarbeiten sich Wissen über islamische Modelle des Umgangs mit Konflikten. Mit den Erfahrungen aus dem Workshop erweitern sich Ihre Handlungsoptionen und Sie agieren auch in angespannten Situationen professionell und situationsgerecht.
Zwei Jahre lang begleitete „Gemeinsam Mittendrin Gestalten – Geflüchtete Jugendliche stärken” geflüchtete Jugendliche und Fachkräfte an drei Projektstandorten, um Partizipation junger Menschen zu fördern. Nun geht das Programm zu Ende und Sie haben die Möglichkeit, an der Abschlussveranstaltung in Offenbach teilzunehmen.
Das Programm, das von der Bertelsmann Stiftung gefördert wird, war mit dem Ziel gestartet, Konzepte und Methoden zur Beteiligung geflüchteter Jugendlicher im Alter von 14 bis 27 Jahren zu erproben und weiterzuentwickeln. Durch konkrete Projekte an den Modellstandorten der „Medien-Etage“ in Offenbach, dem Jugendzentrum „Auf der Höhe“ in Trier und dem „Kinder- und Jugendhaus“ in Weißenfels wurden junge Menschen mit Fluchtgeschichte befähigt, sich an Verfahren und Entscheidungen kompetent und aktiv zu beteiligen und selbst Initiative zu ergreifen. Dabei wurden diese durch die Erfahrung und das Wissen kommunaler Partner unterstützt.
Da das Programm auf das Empowerment und die damit verbundene Partizipation junger Menschen zielt, wird sich dies auch in unserem Abendprogramm widerspiegeln. Denn Jugendliche mit Fluchterfahrung sind in erster Linie junge Menschen mit individuellen Stärken und Interessen. Ihre aktive Mitgestaltung des Abends zeigt, dass Teilhabe maßgeblich für Entwicklung und die Eigengestaltung ihres Lebens ist. Entsprechend bunt und vielfältig wird die Veranstaltung.
Der Fachtag richtet sich an Interessent_innen verschiedener Professionen, Geflüchtete und ehrenamtlich tätige Menschen, die mit Betroffenen rassistischer Gewalt arbeiten. Die Themen Rechte, Schutz, Beratung und Therapie für Betroffene sollen aus sozialarbeiterischer, juristischer, beraterischer und psychosozialer Sicht vor dem Hintergrund rassismuskritischer Gesichtspunkte und menschenrechtlicher Standards beleuchtet werden. Dabei soll die Betroffenen-Perspektive im Fokus stehen.
Im Rahmen dieses Fachtags wird erstmals ein Austausch in dieser Breite ermöglicht und, so der Wunsch, der Grundstein für einen (regelmäßigen) organisierten Austausch und eine tragfähige Vernetzung gelegt.
Anmeldeschluss ist der 15.11.2018.
Weitere Informationen sowie Anmeldung unter: fachtag@opferberatung-rheinland.de
-
30.11.2018
-
23.11.2018
Eine immer stärker globalisierte und digitalisierte Arbeitswelt stellt das Diversity-Management vor neue Herausforderungen.
Wie können Organisationen eine Arbeitskultur schaffen, in die alle ihr Potenzial einbringen können und in der alle sich akzeptiert fühlen – auch mit ihren Sorgen und Ängsten vor Veränderung? Wer sind die Gewinner und Verlierer der Digitalisierung? Förderung von Vielfalt in Zeiten des Populismus – warum stellt dieser auch ein ökonomisches Problem dar? Antworten gibt es auf der Diversity-Konferenz mit Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und Wissenschaft.
Die führende Konferenz für Vielfalt in der Arbeitswelt berücksichtigt alle Dimensionen des Diversity Managements: Alter, Geschlecht, sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität, Behinderung, ethnische Herkunft und Nationalität sowie Religion und Weltanschauung.
-
08.03.2019
Im Rahmen seines Bundesmodellprojekts „Akzeptanz für Vielfalt – gegen Homo-, Trans*- und Inter*feindlichkeit“ im Bundesprogramm „Demokratie Leben!“ hat das BMFSFJ in Kooperation mit dem Braunschweiger Zentrum für Gender Studies und Schlau Niedersachsen die Lehrkräftefortbildung „Vielfalt. Kompetent. Lehren.“ konzipiert.
Ziel des 3-moduligen Fortbildungskonzeptes ist die Sensibilisierung und Qualifizierung pädagogischer Fach- und Lehrkräfte unterschiedlicher Schulstufen für die Auseinandersetzung mit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt. Die Fortbildungsveranstaltung verfolgt einen mehrdimensionalen Ansatz durch den Einsatz unterschiedlicher Methoden und didaktischer Instrumente in Anlehnung an die Trias der Menschenrechtsbildung mit den drei Ebenen der Lebensformenpädagogik als kritisches reflektierendes Bildungskonzept: Wissenserwerb auf der kognitiven Ebene, erfahrungsbezogenes Lernen auf der reflexiven Ebene und praxisbezogenes Lernen auf der Handlungsebene.
Die Fortbildung ist über das Kompetenzzentrum Göttingen als anerkannte Lehrkräftefortbildung ausgeschrieben und für Lehrkräfte verschiedener Schulformen aller Bundesländer zugänglich.
Referent*innen: Annette Bartsch, Leiterin der Zentralstelle für Weiterbildung der TU Braunschweig, Juliette Wedl, Geschäftsführerin Braunschweiger Zentrum für Gender Studies und Pascal Mennen, Lehrer, SCHLAU Niedersachsen.
Welche Chancen bietet interkultureller Austausch für das gesellschaftliche Miteinander? Und wie kann eine gute Diskussionskultur die Demokratie gegen Anfeindungen und Ausgrenzungsversuche widerstandsfähiger machen? Diese Fragen behandelt die Fachtagung "In Vielfalt leben – Vielfalt für die Demokratie mobilisieren" des Bundeszuwanderungs- und Integrationsrats.
Vielfalt ist in der heutigen deutschen Gesellschaft selbstverständlich. Sie bereichert unser alltägliches Leben, sie macht unsere Wirtschaft und Gesellschaft weltoffen und dadurch stark, sie ist einer der Ankerpunkte unserer politischen Kultur. Das Leben in Vielfalt ist aber auch komplex und konfliktreich wie unsere globalisierte Welt auch komplex und konfliktreich ist. Ohne Konflikte und ohne Komplexität gibt es aber weder Innovation noch Fortschritt.
Die Fachtagung wird durch ein Forum abgerundet. Die zentrale Fragestellung lautet: Was sind meine Erfahrungen im alltäglichen Zusammenleben in der Gesellschaft der Vielfalt? Warum fühle ich mich hier wohl und was würde ich gerne ändern? Wie gehen wir mit unseren Erfahrungen in unseren Beiräten und in unseren Communitys um? Hier kann jede*r Teilnehmer*in der Fachtagung sich und die eigene Expertise einbringen und uns durch die Schilderung der eigenen Erfahrungen alle bereichern.
Mediation ist eine strukturierte Methode der Konfliktklärung, die Sie nach der Ausbildung routiniert beherrschen. Mit der Mediation folgen Sie dem Konflikt, kommen den Interessen der Parteien auf die Spur und unterstützen diese bei der Suche nach passgenauen und selbstverantwortlichen Lösungen. Sie erlernen einen systemischen Blick auf Konfliktlagen. Sie behalten den Überblick und führen die Konfliktbeteiligten souverän über emotionale Hürden, so dass diese unbeschadet neue Perspektiven entwickeln können. Die fundierte praxis- und anwendungsnahe Ausbildung bringt Ihnen die Werkzeuge der Mediation nahe. Durch reichlich Raum zum Üben und Reflektieren entwickeln Sie Ihren eigenen Mediationsstil. Interkulturelle Kompetenzen gehören in die heutige Lebens- und Arbeitswelt. Die MITTLEREI nimmt in der Ausbildung diesen Bedarf mit eigenen Elementen kontinuierlich auf.
Dauer: Über 200 Stunden in neun Modulen bis zum Juli 2019.
Kosten: 3.640,00 Euro
Die Schlagwörter Flucht und Migration polarisieren weiterhin in Europa und sind auch in Deutschland bestimmende Themen der politischen Agenda. Nach Eurobarometer-Umfragen wünschen sich die Europäerinnen und Europäer mehrheitlich gemeinsame Antworten auf die aktuellen Herausforderungen. Haben die Europäische Union und die Mitgliedstaaten diese Herausforderung wirklich angenommen und wo stehen sie in der Überarbeitung ihrer aktuellen Politik?
Die Konferenz geht den unterschiedlichen Aspekten der europäischen Flüchtlings- und Migrationspolitik nach, um Wege für gemeinsame Lösungen aufzuzeigen.
Auf vier Panels debattieren wir die aktuellen Herausforderungen: Von den Chancen der legalen Migration und der Verbesserung der Lebensperspektiven außerhalb der Europäischen Union über die Überarbeitung des an seine Grenzen gestoßenen Dublin-Systems bis hin zur Integration von Migrantinnen und Migranten.
-
16.11.2018
Aus verschiedenen Richtungen sind Versuche der Vereinnahmung von Familien identifizierbar: fundamentalistische religiöse Strömungen, rechtsradikale Bewegungen und weitere.
Was steckt hinter den genannten Strömungen? Wie erkennen wir antidemokratische Tendenzen? Wie können wir uns vor ihnen schützen? Wie kann in der Praxis eine Kommunikation zum Thema aussehen? Wie stärken wir unsere Teams und die Familien in unseren Angeboten vor antidemokratischer Agitation?
Wir informieren über aktuelle Diskussionen und Ansätze, regen zur (Selbst-)Reflexion an, stellen Beispiele guter Praxis vor und laden Sie herzlich zum fachlichen Austausch ein.
-
14.11.2018
Viele unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die in den letzten Jahren nach Deutschland geflohen sind, stehen nun kurz vor der Volljährigkeit. Für viele stellt sich die Frage, wie es dann weitergeht. Welche Rechte haben sie? Und wie können sie bei dem Übergang in die Volljährigkeit unterstützt werden?
Die Fachtagung richtet sich an alle Fachkräfte der öffentlichen und freien Jugendhilfe, die mit geflüchteten minderjährigen und jungen Erwachsenen zusammenarbeiten sowie alle weiteren Interessierten, die in dem Arbeitsfeld tätig sind oder es werden wollen.
Die Anmeldegebühr für die Fachtagung beträgt 90 Euro (bzw. 70 Euro ermäßigt).
Anmeldungen werden per Email (veranstaltung@ibis-ev.de) entgegengenommen.
Viele geflüchtete Frauen in Deutschland sind beruflich qualifiziert. Um ihnen den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern, brauchen sie Beratung und Einstiegshilfen, die ihren Fähigkeiten und ihren Bedürfnissen und Rechten als Frauen gerecht werden. Durch Diskriminierungen gegen ihr Geschlecht und ihre Herkunft werden sie von einer Teilhabe an unserer Gesellschaft und an qualifikationsgerechter Arbeit oft ausgeschlossen.
Die Veranstaltung findet am 12. November 2018, 10 Uhr bis ca. 18 Uhr, in Hannover statt. Sie richtet sich an Gleichstellungsbeauftragte sowie Fachkräfte im Sozialbereich und in Stabsstellen zu Migration und Flucht in Niedersachsen.
Am 10.11.2018 von 10:00 bis 16:00 Uhr findet in der Stadthalle Osterode am Harz eine Konferenz zum Thema Integration und Demografie statt.
Interessierte Bürgerinnen und Bürger, Akteurinnen und Akteure der Demografie- sowie Integrationsarbeit, Politik sowie Verwaltung sind herzlich eingeladen, um gemeinsam mit uns mögliche Problematiken im Landkreis aufzuzeigen und Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln.
Neben interessanten Vorträgen werden auch vier spannende Workshops angeboten, bei denen Sie herzlich eingeladen sind sich mit einzubringen.
Die Veranstaltung ist kostenlos.
Zur Anmeldung sowie weiteren Informationen:
-
11.11.2018
Im Zentrum der Veranstaltung steht der Austausch zur Entwicklung und praktischen Umsetzung von Schutzkonzepten in Einrichtungen. Die Fachsymposien geben den Teilnehmenden Raum für den fachlichen Austausch und Anregungen für die eigene Arbeit. Dabei wird auch die Frage diskutiert werden, wie Schutzkonzepte überarbeitet und auf aktuelle Entwicklungen angepasst werden müssen.
-
08.11.2018
Oktober 2018
Berater*innen sind immer wieder mit Fragen von Geflüchteten konfrontiert, ob und wie sie ihre Familien nach Deutschland holen können. Die rechtlichen Grundlagen sind komplex: wer hat ein Recht auf Familiennachzug, und für welche Familienangehörigen gilt es? Was beinhalten die Neuregelungen zum Familiennachzug zu Geflüchteten mit subsidiärem Schutz? Welche Besonderheiten gibt es beim Familiennachzug zu unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen? Wo und wann sollten Anträge gestellt und Termine gebucht werden? In der Fortbildung sollen ausgehend von den rechtlichen Grundlagen (allgemeine Regelungen zum Familiennachzug und Besonderheiten des humanitären Familiennachzuges) Antworten auf diese Fragen gegeben werden.
Referent*innen: Miriam Wollmer und Sebastian Muy (Sozialarbeiter*innen, BBZ - KommMit - für Migranten und Flüchtlinge e.V., Berlin)
Zielgruppe: Das Seminar richtet sich an haupt- und ehrenamtliche Flüchtlingsberater*innen und Rechtsanwält*innen in der Flüchtlingsarbeit. Grundlagenkenntnisse im Asyl- und Aufenthaltsrecht werden vorausgesetzt.
-
31.10.2018
Fortbildung für Lehrkräfte und andere Multiplikator_innen sowie für Haupt- und Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit.
Diese Fortbildung macht Haupt- und Ehrenamtliche fit für den religionssensiblen Umgang mit Geflüchteten. Zunächst nähern wir uns dem komplexen Begriff der ‚Religion‘. Was ist Religion eigentlich und wie prägt sie Individuen und Gesellschaften? Welche Rolle spielt Religion bei Migration und Flucht? Wo bestehen Unter-schiede und Gemeinsamkeiten zwischen den verschiedenen Religionen und Konfessionen? Während einer Exkursion nach Hannover gibt es Gelegenheit für Besuche im Haus der Religionen und in verschiedenen Gotteshäusern.
Der Preis inklusive Teilnahmegebühr, Unterbringung und Vollpension beträgt pro Person 163,00 € im Einzelzimmer und 135,00 € im Zweibettzimmer
Die Freiburger Hilfsorganisation AMICA e.V. veranstaltet am 20. Oktober einen Workshop für Menschen, die sich in der Flüchtlingshilfe als Dolmetscher engagieren. Geleitet wird der Workshop von einer erfahrenen Diplom-Dolmetscherin. Ziel ist, den Teilnehmenden durch praktische Übungen zu helfen, ihre Aufgaben klarer zu definieren, auf das eigene Wohlbefinden zu achten und Fertigkeiten zu vertiefen.
-
23.10.2018
Der Theaterworkshop DEINE STIMME ZÄHLT! bietet Dir ein spannendes Programm! Durch theaterpädagogische Zusammenarbeit tauschst Du Dich mit den anderen Teilnehmerinnen über soziales und politisches Engagement von Frauen aus und triffst bei Kaminabenden und Gesprächsrunden spannende Menschen aus der Berliner Theater- und Kulturszene.
Das Besondere an dem Workshop: Junge Frauen mit und ohne Fluchterfahrung haben bei DEINE STIMME ZÄHLT! die Chance von- und miteinander zu lernen und sich auszutauschen! Gemeinsam überlegen wir, wofür Frauen heute kämpfen und in der Vergangenheit gekämpft haben.
Der Workshop findet vom 19. bis 23. Oktober 2018 in Berlin statt und ist kostenfrei. Die EAF Berlin übernimmt die Kosten für die Reise, Unterbringung und Verpflegung. Eine Ansprechpartnerin steht rund um die Uhr zur Verfügung.
In Brandenburg leben aktuell über 8000 Kinder und Jugendliche aus geflüchteten Familien. Das Engagement seitens der Jugendarbeit ist beeindruckend groß, der Unterstützungsbedarf für die Jugendlichen enorm. Es stellt sich die Frage, was junge Menschen, die ihre Herkunftsländer aufgrund von existentieller Lebensbedrohung verlassen mussten, tatsächlich benötigen, um im Ankunftsland psychische Entlastung sowie das Gefühl von einem „Ankommen“ zu erfahren.
- Welche Angebote der Jugend(verbands)arbeit sind sinnvoll, und wie sehen gelingende Empowerment-Projekte aus?
- Wie erleben die Jugendlichen selbst die vorhandene Unterstützungsstruktur?
- Und wie können Jugendverbände und Vereine bedarfsgerecht agieren, wenn junge Menschen sich im Kreislauf von unsicherem Aufenthaltsstatus, Bildungsanforderungen, Trauma, Spracherwerb und dem gleichzeitig dringenden Bedürfnis nach Spaß und Erholung bewegen?
Auf der Fachtagung wird u.a. die Fotoausstellung „Eindrücke“ zu sehen sein. Diese wurde von geflüchteten Schüler*innen des OSZ Teltow-Fläming gestaltet und gibt auf eindrückliche Weise deren Sicht auf ihre jeweiligen Heimatländer sowie auf die Flucht nach Europa wieder.
Die Teilnahme am Fachtag ist kostenfrei. Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist erforderlich.
Fahrtkosten für Ehrenamtliche können auf Anfrage erstattet werden.
Das Amt für Zuwanderung und Integration der Stadt Oldenburg und G mit Niedersachsen (VNB e.V.), die Bildungs- und Beratungsstelle zu Geschlechtergleichstellung und Migration, laden herzlich ein zum Werkstattgespräch „Geschlechtergleichstellung im Migrationskontext gestalten“.
In der Migration erfahren und gestalten Familien weitreichende, oftmals generationenübergreifende Wandlungsprozesse. Es kommt im gesamten Beziehungsgefüge zu Aushandlungs- und Neubildungsprozessen sowie zur Pluralisierung familiärer Lebensformen und Geschlechterrollen. Die Konstruktionen von an Geschlecht gebundene, familiär und kulturell tradierte Lebensentwürfe, Zuschreibungen und Handlungspraxen werden hierbei kritisch hinterfragt.
-
19.10.2018
Ein Trauma ist eine "schwere seelische Verletzung". Leider zeigt sich posttraumatischer Stress oft erst in Form von Folgeerkrankungen. Aktuelle Beobachtungen zeigen, dass acht von zehn geflüchtete LSBTIQ*-Klient*innen, die das Gespräch mit den Berater*innen hier in Deutschland suchen, unter einer akuten PTBS Symptomatik (Posttraumatische Belastungs-störung) mit Folgeerkrankungen leiden.
Anlässlich der neuen PHINEO Publikation "FEMpowerment – Geflüchtete Frauen in Deutschland stärken" bringt PHINEO geflüchtete Frauen, Unternehmen, Politik, Stiftungen und andere Interessierte zusammen und zeichnet herausragende Projekte mit dem Wirkt-Siegel aus.
- Erleben Sie einen Abend, der sich ganz um das Thema Empowerment von geflüchteten Frauen in Deutschland dreht.
- Diskutieren Sie mit über 100 geladenen Fördernden, PolitikerInnen, UnternehmensvertreterInnen, Programmverantwortlichen und geflüchteten Frauen darüber, was es für wirkliches Empowerment braucht.
Begrüßen Sie mit uns spannende Gäste, u.a. Miren Bengoa (Fondation Chanel), Gesa Birkmann (Terre des Femmes), Barbara Costanzo (Telekom), Judith Eberhard (IB München), Dr. Heiko Geue (BMFSFJ), Stefan Kiefer (DFL Stiftung) und Aydan Özoğuz (ehem. Integrationsbeauftragte). - Lassen Sie sich begeistern von 24 herausragenden Projekten, die bundesweit Migrantinnen darin bestärken, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen.
Genießen Sie das Buffet mit syrischen Spezialitäten!
Die Teilnahme ist kostenlos.
-
18.10.2018
In diesem Format unterhalten sich drei wiederkehrende muslimische Gastgeber aus dem Beirat der Alhambra Gesellschaft mit einem regelmäßig wechselnden Gast über ihre Ansichten zum Islam in Deutschland und Europa. Ein solches Format soll die medialen Rollenbilder etablierter Talkrunden aufbrechen – Muslime und ihr Glaube sind nicht länger “Fremde”, sondern in Deutschland beheimatet. Die muslimischen Gastgeber sprechen ausdrücklich aus der Position von deutschen Muslimen. Deutschland ist ihre Heimat – die sie sich mit ihrem Glauben erschließen.
Diesmal greift das Quartett das Thema "Der inspizierte Muslim - Zur Politisierung der Islamforschung in Europa" mit Prof. Dr. Schirin Amir-Moazami auf.
-
13.10.2018
Zwei Jahre nach der so bezeichneten ‚Flüchtlingskrise‘ ist scheinbar etwas Ruhe eingekehrt. Die akuten Gefühle der Überforderung, Rastlosigkeit und Hilflosigkeit wirken etwas abgeklungen. In den Medien häufen sich Negativberichte über Geflüchtete. Empirische Untersuchungen bestätigen das seelische Leid der Geflüchteten, während zeitgleich der Ruf nach Abschiebung immer lauter wird. Die Versorgungsstrukturen sind weiterhin heraus- wenn nicht überfordert. Zugleich ist eine Solidarisierung in der Gesellschaft und eine Professionalisierung sowie Bildung neuer bedarfsanpasster Strukturen zu beobachten.
Wir gehen davon aus, dass die Psychoanalyse und die Gruppenanalyse in dieser gesellschaftlichen Situation Anregungs- und Veränderungspotenziale haben, sowohl als klinische Praxen als auch als kulturtheoretische Zugänge. Konzepte wie Containing und Holding können nicht nur dazu beitragen Menschen mit Flucht- und Migrationsgeschichten sondern auch Professionelle darin unterstützen, Gefühle des Verlusts, der Entwurzelung und Ohnmacht zu bewältigen und Erfahrungen von Zugehörigkeit (wieder) zu ermöglichen.
Diesen Themen und Fragen werden wir in einem interaktiven Format aus Vorträgen, Podiumsdiskussion, Diskussionsgruppen und Selbsterfahrungsgruppe nachgehen und die Chancen und Herausforderungen in klinischen und nicht-klinischen Settings mit Menschen mit Flucht- und Migrationserfahrung erlebbar machen, vertiefen und diskutieren. Gemeinsam möchten wir erkunden, wie in Behandlungs- und anderen Settings durch psychoanalytische und gruppenanalytische Zugänge Resonanzräume für eine Begegnung geschaffen werden können.
Ziel ist es über die Veranstaltung hinaus, psychoanalytische und gruppenanalytische Zugänge für die Arbeit mit Geflüchteten zur Verfügung zu stellen.
-
12.10.2018
Die Konferenz "Living with Islamophobia" rückt erstmals die Betroffenenperspektive ins Zentrum. Sie lenkt den Blick auf Rassifizierungsprozesse entlang von Kultur und Religion, auf Themen der Versicherheitlichung sowie die Rolle von Sexualität und Gender im antimuslimischen Rassismus – und fragt nach Strategien des Umgangs, der Erprobung von Gegennarrativen und Möglichkeiten des Empowerments.
Neun von zehn Flüchtlingen, die minderjährig und unbegleitet nach Deutschland kommen, sind Jungen. Trotzdem wird dies weder in der Forschung, noch bei der Entwicklung pädagogischer, jugendpsychiatrischer oder gesundheitsfördernder Angebote ausreichend thematisiert. Dabei gibt es bei den Fluchtursachen, den Flucht- und Gewalterfahrungen sowie den Bewältigungsstrategien viele jungenspezifische Aspekte.
In der Zeit von Ende 2015 bis 2017 stand die Jugendhilfe unter einem enormen „Improvisationsdruck“,unter dem das Hilfesystem mit einer Vielzahl pädagogischer, psychologischer und administrativer Herausforderungen konfrontiert war. Inzwischen sind spezifische Hilfestrukturen weitgehend aufgebaut, auch gelangen weniger Flüchtlinge nach Europa. Deshalb besteht nun die Möglichkeit, die zur Routine werdende Praxis der stationären Jugendhilfe, der Trauma-Behandlung und der Gesundheitsförderung einer gendersensiblen Reflektion zu unterziehen.
Termin: 11. Oktober 2018
Veranstaltungsort: Ameron Hotel Regent, Melatengürtel 15, 50933 Köln
Teilnahmegebühr: kostenlos, für Verpflegung ist gesorgt
Anmeldefrist: 15.09.2018 (Teilnehmerzahl begrenzt)
Ziel der Fortbildungsreihe "Migrationsarbeit im DRK" ist es, fach- und programmübergreifend einen genaueren Blick auf wichtige Themen in der Migrationsarbeit zu werfen und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim DRK zu erreichen, die direkt oder indirekt mit diesem Themenkomplex in ihrer Arbeit zu tun haben.
Für den Fachtag konnten renommierte Referenten gewonnen werden:
- Andreas Hollstein, Bürgermeister der Stadt Altena, Träger des ersten nationalen Integrationspreises und gestern vom Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen UNHCR mit dem bedeutenden Nansen-Flüchtlingspreis ausgezeichnet, wird am Beispiel seiner Stadt Möglichkeiten und Chancen einer ganzheitlichen und integrativen Flüchtlingspolitik vorstellen
- Volker Maria Hügel von der GGUA wird in seinem Beitrag zur Thematik „Asyl in Deutschland“ eine politische und menschenrechtliche Analyse der aktuellen Asylpolitik vornehmen
- Prof. Dr. Joachim Gardemann, Leiter des Kompetenzzentrums Humanitäre Hilfe an der Fachhochschule Münster, wird in seinem Beitrag die Verantwortung von Politik, Gesellschaft und jedes/jeder einzelnen von uns angesichts der Krisen und Notlagen in der Welt aufzeigen
- Dr. Eric Wallis, Experte für politische Kommunikation, wird sich in seinem Beitrag „Sprache der Entmenschlichung - Entmenschlichung durch Sprache“ mit der Instrumentalisierung der Sprache durch Populisten und mit möglichen Gegenstrategien beschäftigen.
Unter dem Motto “Alte Herausforderungen – neue Partnerschaften” findet die 3. Fachkonferenz der Landesfreiwilligenagentur am 10.10. von 9.30 bis 16.00 Uhr mit Podien und Workshops statt.
"Alte Herausforderungen – neue Partnerschaften“– wir streben mit diesem Titel die Klärung an, wie „offen“ wir wirklich sind, wollen an der eigenen Haltung dazu arbeiten, ganz praktische Schritte der interkulturellen Öffnung fü unsere Arbeit erkunden, den aktiven Austausch mit neu entstandenen Initiativen ermöglichen und uns vernetzen. Seit dem Sommer 2015 und der Zuwanderung vieler Geflüchteter sind noch mehr großartige Projekte zu Fragen des interkulturellen Zusammenlebens in Berlin entstanden, die es unbedingt kennenzulernen gilt."
Die Erkenntnisse der Migrationsforschung machen deutlich, dass Menschen durch den Verlust ihrer Heimat, die Belastungen während der Migration, durch wirtschaftliche Not, unzureichende Wohnsituationen sowie ein Klima der Ablehnung im Aufnahmeland Risikofaktoren für seelische Erkrankungen ausgesetzt sind. Dies ist Grund genug, durch Beiträge von Expertinnen und Experten der Frage nachzugehen, wie es gelingen kann, jenen, die in akuter Bedrängnis bei uns Zuflucht suchten, eine Heimat zu geben.
Beim Transferforum zur Programmbilanz stehen die drei zentralen Themenfelder Kinderschutz, Bildung und Partizipation von Kindern und Jugendlichen mit Fluchterfahrung im Vordergrund: Wie muss ein geschütztes und sicheres Umfeld aussehen, damit geflüchtete Kinder und Jugendliche ihre Potentiale entfalten können? Wie können Zugänge zu Ausbildung und Arbeit für junge Erwachsene mit Fluchterfahrung ermöglicht und ihre Begleitung gewährleistet werden? Und welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit sie ihr eigenes Umfeld sowie gesellschaftliche Prozesse aktiv mitgestalten können?
Zu diesen und weiteren Fragen stellt Ihnen das Transferforum gelungene Praxisansätze vor und bietet die Gelegenheit zum Austausch von Erfahrungen und über notwendige nächste Schritte.
Die Tagung der Landesvereinigung Kulturelle Jugendarbeit (LKJ) NRW stellt die aktuelle Situation junger geflüchteter Kinder und Jugendlicher dar und bietet einen Einblick in die verschiedenen Modelle der kulturellen Jugendarbeit mit ihren Handlungsansätzen. Dabei berichten Akteure aus der Praxis und Jugendliche von ihren Erfahrungen in kulturellen Projekten.
Am Nachmittag des 9. Oktober 2018 haben die Teilnehmenden in Dortmund die Möglichkeit selbst aktiv zu werden: Aus den Sparten Theater, Musik, Zirkus, bildende Kunst, Medien, Tanz und Literatur werden von erfahrenen Dozent*innen Arbeitsweisen vorgestellt und Beispiele zum Mitmachen angeboten, die sich mit dem Ziel auseinandersetzen: Wie können kulturelle Projekte mit Geflüchteten funktionieren?
Bei diesen Workshops gibt es praktische Tipps und Anregungen für eine Angebotsentwicklung, die geflüchtete und einheimische Kinder und Jugendliche erreicht – immer mit dem Ziel der Partizipation und Integration.
n drei Jahren Programmlaufzeit wurden durch das Bundesprogramm „Willkommen bei Freunden – Bündnisse für junge Flüchtlinge“ Veränderungsprozesse in über 80 Kommunen intensiv begleitet und es fand eine Zusammenarbeit mit Akteuren an weiteren 150 Standorten statt. Ausgangspunkt des im Jahr 2015 gestarteten Programms war die Vision, geflüchtete Kinder und Jugendliche darin zu unterstützen, ihr Grundrecht auf Bildung und gesellschaftliche Teilhabe auszuüben.
Beim Transferforum zur Programmbilanz stehen die drei zentralen Themenfelder Kinderschutz, Bildung und Partizipation von Kindern und Jugendlichen mit Fluchterfahrung im Vordergrund: Wie muss ein geschütztes und sicheres Umfeld aussehen, damit geflüchtete Kinder und Jugendliche ihre Potentiale entfalten können? Wie können Zugänge zu Ausbildung und Arbeit für Jugendliche und junge Erwachsene mit Fluchterfahrung gestaltet und ein erfolgreicher Abschluss gewährleistet werden? Und welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit sie ihr eigenes Umfeld sowie gesellschaftliche Prozesse aktiv mitgestalten können?
-
12.10.2018
-
06.10.2018
-
06.10.2018
Die interdisziplinäre Forschungslandschaft zu Themen von Zwangsmigration, Flucht und Asyl hat sich in Deutschland innerhalb weniger Jahre stark erweitert und ausdifferenziert.
Zur Vorstellung und Diskussion aktueller Forschungsergebnisse sowie zur Förderung von interdisziplinärem Austausch und Kooperationen findet vom 4. bis 6. Oktober 2018 die 2. Konferenz des Netzwerks Flüchtlingsforschung statt. Ausrichter und Partner ist das Zentrum Flucht und Migration der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt.
Mit der Konferenz soll in Deutschland eine Plattform für Diskussion und Vernetzung der Forscher*innen im Feld der Flucht- und Flüchtlingsforschung geschaffen werden. Das Netzwerk Flüchtlingsforschung ist ein multidisziplinäres Netzwerk von Wissenschaftler*innen in Deutschland, die zu vielfältigen Fragen über Flucht und Geflüchtete forschen, sowie internationaler Wissenschaftler*innen, die diese Themen mit Bezug zu Deutschland untersuchen.
September 2018
-
30.09.2018
-
28.09.2018
-
28.09.2018
Im Februar 2016 hat das von dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) geförderte Symposion „25 Jahre Gewaltprävention im vereinten Deutschland – Bestandsaufnahme und Perspektiven“ in Berlin stattgefunden. Als Ergebnis der Bestandsaufnahme lässt sich festhalten: Einerseits hat sich die Praxis der Gewaltprävention in einigen Arbeitsfeldern positiv entwickeln und professionalisieren, Strukturen für die gewaltpräventive Arbeit haben sich bilden können und die Präventionsforschung hat an Bedeutung gewonnen. Darüber hinaus hat es im Zusammenhang mit der Prävention von und der Intervention bei Gewalt wichtige gesetzliche Neuerungen gegeben. Andererseits hat sich gezeigt, dass die Gewaltprävention in Deutschland keineswegs auf einem sicheren Fundament steht. Entsprechende Defizite in Praxis, Wissenschaft, Verwaltung und Politik finden sich in unterschiedlichen Ausprägungen in allen Be-reichen und auf allen Ebenen der Gewaltprävention. Bzgl. der Perspektiven der Gewaltprävention in Deutschland konnten in Berlin zahlreiche Vorschläge zu deren Weiterentwicklung erarbeitet werden. Deren Umsetzung würde einen Beitrag dazu leisten, die festgestellten Defizite langfristig abzubauen. Offen bleiben musste dagegen, wie und unter welchen Voraussetzungen dies gelingen könnte.
Mit der zweiten Folgeveranstaltung zum Berliner Symposion bieten wir Ihnen die Gelegenheit, an neuen Strategien für die Gewaltprävention mit- und weiterzuarbeiten. Wir gehen dabei davon aus, dass die Entwicklung eines nationalen Konzepts Gewaltprävention von engagierten Akteur*in-nen aus allen Bereichen der Gewaltprävention angestoßen werden muss. Ein solches Konzept muss selbstverständlich alle Bereiche der Gewaltprävention in den Blick nehmen, wir werden uns jedoch im nächsten Schritt – was die Arbeitsfelder der Gewaltprävention betrifft –zunächst auf einige „Schlüssel“themen konzentrieren müssen.
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir den in Berlin begonnenen gemeinsa-men Arbeits- und Diskussionsprozess mit Ihnen fortsetzen und Sie als engagierte Mitstreiter*innen für ein sicheres Fundament der Gewaltprävention in Deutschland gewinnen könnten.
Das Projekt „Zukunft in Niedersachsen – Fachstelle für minderjährige Geflüchtete (ZiN)“ veranstaltet am 25.09.2018 im Stephansstift Hannover eine Fachtagung zum Thema
„Genderperspektiven minderjähriger Geflüchteter“ – Praxiserfahrungen und Konzepte
„Zukunft in Niedersachsen (ZiN)“ ist ein Kooperationsprojekt zwischen mannigfaltig e.V. – Institut für Jungen- und Männerarbeit, dem Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen (VNB) und dem Flüchtlingsrat Niedersachsen e.V.
An diesem Fachtag werden vielfältige konkrete Erfahrungen aus der Praxis mit minderjährigen Geflüchteten vorgestellt. Dabei werden unterschiedliche Aspekte aus Jungenarbeit, Mädchenarbeit, Jugend*bildung, Diskriminierungsreflexion, Rechtsberatung und der Multiplikator*innenbegleitung gebündelt in 2 konzeptionellen Vorträgen und 5 Praxisworkshops für die eigene Theorie und Praxis zur Verfügung gestellt.
Da die Mehrzahl der unbegleiteten, minderjährigen Geflüchteten männlich* ist, wird hier ein Schwerpunkt auf Männlichkeitskritik und Jungen*arbeit gelegt. Doch auch die ebenso wichtige Genderperspektive der Mädchen*arbeit erhält ihren eigenen Raum der Auseinandersetzung, ebenso wie die Genderreflexion im Umfeld von LGBTI* und Geflüchteten. Darüber hinaus widmet sich ein Workshop der wichtigen Perspektive rechtlicher Belange von minderjährigen Geflüchteten.
Deutschlands Städte sind kulturell vielfältig – doch wie steht es um das Kulturverständnis und die künstlerische Ästhetik? Wer definiert, was Kunst und Kultur sind und somit in den Kultureinrichtungen gezeigt werden und was nicht? Und bilden diese Einrichtungen die gesellschaftliche und kulturelle Vielfalt adäquat ab?
Die interkulturelle Öffnung der Kunst- und Kultureinrichtungen und die Unterstützung diversitätsorientierter Kulturarbeit werden mittlerweile zwar als kulturpolitische Schwerpunktthemen definiert und es wird angestrebt, dass die Kulturlandschaft für alle Menschen – unabhängig von Herkunft, Alter oder sozialem Status – sichtbar, erlebbar und zugänglich sein sollte. Doch wird dies auch zufriedenstellend umgesetzt?
Auf diese Fragen wird Dr. Mark Terkessidis in seinem Vortrag im Rahmen des Diskussionsforums Einwanderungsland Deutschland eingehen.
-
26.09.2018
Das Forum der Kulturen Stuttgart e. V. unterstützt seit 2016 Migrantenvereine und -initiativen, die sich für Geflüchtete engagieren und Angebote in ihrem Verein schaffen oder schaffen möchten. Neben finanzieller und ideeller Unterstützung bei der Realisierung von Projekten und Angeboten, bietet das Forum der Kulturen regelmäßig stattfindende Austausch- und Informationsabende und Fortbildungen.
Diese Veranstaltung wird von der Referentin Dagmar Nolde der Berghof Foundation Tübingen durchgeführt:
UMGANG MIT KONFLIKTEN IM ENGAGEMENT FÜR UND MIT GEFLÜCHTETEN
Das Engagement von Engagierten und Vereinen in der Flüchtlingsarbeit ist mit viel persönlichem Aufwand und Motivation und dementsprechend auch mit einer Erwartungshaltung verbunden. In verschiedenen Situationen zwischen Ehrenamtlichen und Geflüchteten können Konflikte und Streitigkeiten entstehen. Diese Fortbildung bietet Ansätze, um souverän mit möglichen Konflikten umzugehen. Folgende Fragen werden thematisiert:
- Wie schaffe ich es, dass alle, die sich mit mir im Unterstützerkreis für Geflüchtete engagieren, an einem Strang ziehen?
- Wie kann ich reagieren, wenn mein Engagement nicht den von mir gewünschten Effekt erzielt?
- Wie verhalte ich mich, wenn ich zwischen die Fronten von Konflikten anderer gerate?
-
23.09.2018
-
22.09.2018
In Zusammenarbeit mit der Evangelischen Hochschule Darmstadt und der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf veranstaltet das Nationale Zentrum Frühe Hilfen am 21. September 2018 in Frankfurt einen Fachtag zum Thema: "Geflüchtete Familien und Frühe Hilfen". Die Tagung richtet sich an Fachkräfte der Frühen Hilfen und an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Das Ziel ist, gemeinsam über gelungene Praxisbeispiele und zukünftige Herausforderungen der Arbeit mit geflüchteten Familien nachzudenken und zu diskutieren.
Interessierte können sich den Termin vormerken. Das Programm wird Ende Mai veröffentlicht. Dann besteht die Möglichkeit zur Anmeldung auf der Seite des Nationalen Zentrums Frühe Hilfen.
Welchen Beitrag können die Frühen Hilfen leisten, um das Ankommen von Familien zu unterstützen? Wie können stabile (Beziehungs-) Situationen trotz schwieriger äußerer Rahmenbedingungen hergestellt werden? Wie können dabei auch die Ressourcen und Fähigkeiten der Familien miteinbezogen werden?
Das Nationale Zentrum Frühe Hilfen lädt gemeinsam mit der Evangelischen Hochschule Darmstadt und der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf am 21. September 2018 zu einem Fachtag zum Thema "Geflüchtete Familien und Frühe Hilfen" nach Frankfurt ein. Die Anmeldung ist bis 2. Juli möglich. Die Zahl der Teilnehmenden ist auf 200 begrenzt.
-
22.09.2018
-
21.09.2018
-
21.09.2018
-
21.09.2018
Diese Fortbildung widmet sich der Bedeutung von Geschlecht bei Flucht und Integration auf vielfältige Wei-se. Welche Rolle spielt Geschlecht überhaupt bei der Flucht? Welche Unterschiede gibt es zwischen Männern und Frauen bei der Integration? Und wie kann man in der Arbeit mit Geflüchteten auf diese geschlechtsspezifischen Unterschiede eingehen? Vor dem Hintergrund der haupt- und ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit und unter Anleitung ausgewiesener Expert_innen werden in Übungen verschiedene Fallbeispiele erarbeitet und Handlungsmöglichkeiten erprobt. Dabei sollen auch Konflikte des Alltags thematisiert und gemeinsam aufgearbeitet werden.
-
19.09.2018
Diversity oder der „Umgang mit Vielfalt“ spricht für eine bewusste Haltung in der zwischenmenschlichen Beziehung. Diversity als Haltung setzt eine Kompetenz voraus, die die Gleichwertigkeit des Gegenübers und einen empathischen Umgang mit unterschiedlichen Wahrnehmungen gewährleistet.
Unsere Gesellschaft ist durch eine hohe Vielfalt innerhalb der Bevölkerung gekennzeichnet. Daher ist Diversity-Kompetenz eine wichtige Schlüsselqualifikation im Alltag und Berufsleben geworden. Sie hilft uns, mit der Unterschiedlichkeit von Menschen und den unterschiedlichsten Lebensentwürfen sensibel und kompetent umzugehen.
Eine diversitätsbewusste Jugendhilfe zeichnet sich dadurch aus, dass Heterogenität bei jungen Menschen als auch bei Kolleg*innen als Normalfall verstanden wird und Konstruktionen von Differenzen sichtbar gemacht werden. Teams von Kolleg*innen, die einen hohen Grad an Diversität aufweisen, profitieren davon, da sie ganz unterschiedliche Kompetenzen bündeln.
Die Fortbildung hat das Ziel, Vielfalt im eigenen Arbeitskontext zu erfahren, sowohl auf Seiten der Kollegen als auch im Hinblick auf die Adressaten unseres pädagogischen Handelns, indem Menschen, mit denen wir unmittelbar in Kontakt sind als handelnde Individuen betrachtet werden, die in einem spezifischen Lebenskontext sind.
Datum: 18. und 19.09.2018, 2-tägig
Ort: AWO Jugend-und Erziehungshilfen, Damm 14/15, 38100 Braunschweig
Referent: Musa Dağdeviren, M.A., ist Fachreferent und Trainer für Interkulturelle Kompetenz, Systemischer Berater und Coach beim Kölner Institut für Interkulturelle Kompetenz (KIIK) e.V.
Kosten: 140€ via Rechnungsstellung
-
17.02.2019
Interkulturelle Kompetenz ist eine Handlungsoption, den persönlichen Umgang mit "Fremdheit" und "Andersartigkeit"
souverän und konstruktiv zu gestalten. Interkulturelle Kompetenz setzt eine Reihe an Fach- und Sozialkompetenzen voraus. In
dieser Fortbildung erwerben die Teilnehmenden die Kompetenzen, die eigene "kulturelle Brille" aus verschiedenen
Perspektiven zu betrachten und diese in den Kontext der eigenen Tätigkeit zu stellen. Ziel ist es, ein eigenes Profil als interkulturelle/r
TrainerIn zu entwickeln und zu schärfen.
Datum
17. Sep. 2018 - 17. Feb. 2019
09:00 - 17:30
Veranstalter
Ev. Erwachsenenbildungswerk Westfalen und Lippe e. V.
Telefon 0231/540910
Preis
€ 1.565,00
Die drei zentralen Informationsportale zum Thema Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen - „Anerkennung in Deutschland“, das BQ-Portal und anabin - informieren beim Webinar am 13. September 2018 Ehrenamtliche über das Thema Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen.
Im Vordergrund werden folgende Fragen stehen:
- Wann ist eine berufliche Anerkennung zwingend erforderlich oder ratsam, um in Deutschland zu arbeiten?
- Wo und wie kann ich Informationen dazu finden, wie die mitgebrachten Qualifikationen der/des Anerkennungsinteressierten einzuschätzen sind?
- Wo findet man Beratungsstellen, die vor Ort zur Anerkennung beraten?
- Wo kann ich selbst nachfragen, wenn ich mir nicht sicher bin, was zu tun ist?
Das Webinar wird aus verschiedenen Bausteinen bestehen: Inputs von Fachreferenten, Fallbeispielen, Umfragen und einer Chatmöglichkeit. So können sich alle Teilnehmenden aktiv beteiligen.
13.09.2018, 18:00 - 19:00 Uhr
-
12.09.2018
Mit der wachsenden Zahl von Akteuren im Arbeitsfeld steigt gleichzeitig der Bedarf an Hintergrundwissen und gelungenen Beispielen aus der Präventionspraxis. Der Fachtag der bpb soll ein Ausgangspunkt für diesen Wissenstransfer sein.
-
14.09.2018
Der Grundkurs „Konstruktiv in Konflikten“ bietet Menschen mit Fluchterfahrungen die Möglichkeit sich zu Themen wie Kommunikation, Interkulturalität & Konfliktbearbeitung fortzubilden. Die erlernten Fähigkeiten & Methoden unterstützen die Teilnehmenden in Konfliktsituationen eine konstruktive Rolle einzunehmen.
Anmeldung ist bis zum 28. August 2018 möglich.
-
06.09.2018
Papilio-Integration bestärkt Erzieher in der pädagogischen Arbeit mit Kindern mit Flucht- und Migrationshintergrund und baut Handlungsunsicherheiten im Kita-Alltag ab. Die interkulturelle Kompetenz der Erzieher wird erhöht: mit diversen Methoden und Übungen zur Wissensvermittlung, Reflexion sowie konkreten Beispielen interkulturellen Handelns.
Inhalte:
- - Familien- und Bildungskulturen in den Hauptherkunftsländern
- - Kultur und deren Einfluss auf unser Denken und Handeln
- - Traumatisierung im Kindesalter und Erzieher-Kind-Interaktion
- - Kultursensitiver Umgang mit Materialien und Routinen im Kita-Alltag
- - Strategien zum Erreichen der Eltern
- - Interkulturelle Kommunikation
Termin: 4.-6. September 2018 in Homberg (Ohm)
Ort: BIZ der AOK Hessen, Lärchenweg 20, 35315 Homberg (Ohm)
Weitere Informationen sowie das Anmeldeformular sind online zu finden.
Migrationsprozesse (und Flucht als eine besondere Form von Migration) stellten und stellen (nicht nur in Phasen stark zunehmender Migration wie 2015/2016) unsere Gesellschaft vor immer wieder neue Herausforderungen. Migration ist in Deutschland Konfliktauslöser und Chance zugleich. Sie ist ein Motor für vielfältige Veränderungsprozesse, für eine Auseinandersetzung mit Regeln, Werten und Normen eines gleichberechtigten und respektvollen Miteinanders.
Geschlecht ist nach wie zentrales Strukturprinzip für Migrant_innen, welches Chancen auf gleichberechtigte Teilhabe und ein selbstbestimmtes Leben in Deutschland elementar beeinflusst. Aktuelle und gleichzeitig als eigentlich überwunden gedachte Sichten auf und Diskurse über Migration werden weitgehend dominiert von einem defizitorientierten bis hin zu rassistischen Blick auf „die migrantische Frau“ und „den migrantischen Mann“.
Geschlechtergleichstellung in der Migrationsgesellschaft zu reflektieren und daraus Angebote für eine gleichberechtigt orientierte Praxis zu realisieren, bedarf der Auseinandersetzung mit grundlegenden Haltungsfragen, des Austausches von bewährtem Wissen und der Vernetzung von Expertisen der Gleichstellungs- und Migrationsarbeit.
Wann: 04.09.2018, 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Wo: Kulturzentrum Pavillon – Lister Meile 4 – 30161 Hannover
Anmeldung
August 2018
Am 28. August 2018 beginnen zwei neue Kurse in der Bildungsstätte JACK:
1) Alphabetisierungskurs
Der Alphabetisierungskurs für Frauen ohne Vorkenntnisse ermöglicht neben dem Erlernen und Anwenden des Alphabets auch ein erstes mündliches Erproben der deutschen Sprache. Er ist sowohl für Schülerinnen geeignet, die in ihrer Muttersprache Lesen und Schreiben gelernt haben, als auch für jene, die in der Muttersprache nicht alphabetisiert sind.
2) DaZ-Vorkurs
Der Kurs mit der Niveaustufe A0 richtet sich an Frauen, die lateinisch alphabetisiert wurden und nun mit einem Deutsch-Sprachkurs beginnen möchten, jedoch wenig Lernerfahrung haben und daher einen langsamen Einstiegskurs benötigen. Der Vorkurs setzt somit vor der Stufe A1 an, um den Schülerinnen erste Kenntnisse der deutschen Sprache sowie Lerntechniken zu vermitteln.
Die Kurse finden fünf mal pro Woche zu je anderthalb Stunden täglich statt und haben parallele Kinderbetreuung.
In beiden Kursen sind mindestens zehn freie Plätze zu vergeben. Bitte melden Sie interessierte Frauen so früh wie möglich an.
Weltweit zählen die Vereinten Nationen 250 Millionen Migrant*innen. Weitere 65 Millionen Menschen befinden sich auf der Flucht, auf der Suche nach Sicherheit und besseren Perspektiven. In Deutschland beantragten seit 2015 etwa 1,4 Millionen Geflüchtete Asyl. Die Bundesrepublik gehört damit neben den Vereinigten Staaten, Kanada und Großbritannien zu den wichtigsten Einwanderungsländern unter den OECD-Staaten.
Bevölkerungsrückgang, demografischer Alterungsprozess, Etablierung Deutschlands als Einwanderungsland - diesen und weiteren Herausforderungen müsste ein Einwanderungsgesetz begegnen. Um den demografischen Wandel abzufedern ist Deutschland auf den Zuzug von mehreren Hunderttausend Arbeitskräften angewiesen. Diesen Zuzug gilt es sinnvoll zu steuern. Doch wie kann ein gesetzliches Instrumentarium hierfür aussehen?
Ort: Diakonie Hamburg, Dorothee Sölle Haus, Raum 9, Königstraße 54, Hamburg
Anmeldung unter anmeldung.me@diakonie-hamburg.de
Juli 2018
Das Zentrum für Antisemitismusforschung (ZfA) lädt gemeinsam mit der Berliner Landeszentrale für politische Bildung und der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ) zur offiziellen Vorstellung der Ergebnisse einer europäischen Fünf-Länder-Studie zum Zusammenhang von Antisemitismus und Migration ein.
Unter der Leitung des Londoner Pears Institute for the Study of Antisemitism untersuchten Forscherinnen und Forscher in Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Belgien und den Niederlanden die Frage, ob es mit der Einwanderung aus arabischen und anderen muslimisch geprägten Ländern seit 2014 einen „Import“ von Antisemitismus nach Europa gegeben habe.
Die Vergleichsstudie und der Länderbericht zu Deutschland sind online verfügbar.
Das Themenfeld Flucht, Migration und Integration wird derzeit sowohl auf nationaler wie auch auf europäischer Ebene stark diskutiert und ist von großer Bedeutung. Im Programm Erasmus+ wurden besonders in den letzten beiden Antragsjahren zahlreiche Projekte gefördert, die sich mit verschiedenen Facetten der gesellschaftlichen Integration von Geflüchteten und Migrant*innen beschäftigen bzw. beschäftigt haben. So sind viele wertvolle (Zwischen-) Ergebnisse entstanden, die wichtige Impulse für die Arbeit mit diesen Zielgruppen liefern können.
Die Nationale Agentur beim BIBB möchte mit der Konferenz zum einen Raum für Projekte geben, (Zwischen-) Ergebnisse auszutauschen, sich zu vernetzen und Anregungen für die weitere Arbeit zu finden und zu geben. Zum anderen möchten sie dazu beitragen, die Projektergebnisse an die interessierte Öffentlichkeit zu verbreiten, um auch hier die Vernetzung zu befördern und Impulse zu setzen.
Zielgruppe: Vertreterinnen und Vertreter von laufenden und abgeschlossenen Projekten, Stakeholder, Praktikerinnen und Praktiker im Bildungsbereich sowie alle am Thema Interessierten
Datum: Dienstag, 30. Oktober 2018
Uhrzeit: 10:00 - 16:30 Uhr
Anmeldefrist: 28. September 2018
-
22.07.2018
Das 17. Sommerfestival der Kulturen bietet sechs Tage lang einen großen Markt der Kulturen mit vielen schönen Dingen wie Kunsthandwerk, Schmuck, Kleidung, Taschen, Tee und Gewürze aus verschiedenen Ländern und einen Street Food Market mit jeder Menge kulinarischen Spezialitäten der Stuttgarter Migrantenvereine – sowie dieses Jahr zum ersten Mal einen Kessler-Sektstand und ein Angebot für Kinder und Jugendliche. Von Freitag bis Sonntag, 20.–22. Juli 2018, 16 bis 20 Uhr können sich die kleinen Besucherinnen und Besucher auf verschiedene Aktivitäten freuen.
Das ausführliche Programm und weitere Infos findet Ihr unter:
www.sommerfestival-der-kulturen.de
-
15.07.2018
Viele Menschen, die aus Kriegsgebieten fliehen, haben wiederholt schwere seelische und körperliche Belastungen erlebt. Als Folge der schrecklichen Erlebnisse können Ängste, Panikattacken, Stimmungsschwankungen, Vermeidungs- und Suchtverhalten auftreten.
In dieser IBIS-Fortbildung werden Lehrer_innen dafür sensibilisiert, Anzeichen für Traumata bei Geflüchteten früh zu erkennen. Sie erhalten kompakte Informationen und Gestaltungstipps für den Unterricht mit Menschen, die schwere Belastungen erlebt haben.
Die Fortbildung ist geeignet für alle Menschen, die gern mehr Hintergrundwissen zum Thema „Traumasensibler Unterricht“ hätten - Lehrkräfte, die Integrationskurse leiten, aber auch andere Unterrichtende.
Die Fortbildung umfasst 20 UE und kostet 200 Euro. Aktive Integrationskurs-Lehrkräfte haben einen besonderen Vorteil: sie erhalten nach der Teilnahme die Kursgebühr in voller Höhe vom BAMF erstattet. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs angenommen. Anmeldeschluss ist 10 Tage vor Kursbeginn.
-
15.07.2018
-
15.07.2018
In Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Integrationszentrum Höxter veranstaltet das Christliche Bildungswerk Die Hegge das dreitägige Seminar.
- Sie sind nach Deutschland geflohen und suchen hier eine neue Heimat?
- Sie möchten Ihre Deutschkenntnisse im Alltag anwenden lernen?
- Sie haben Ihre Kultur mitgebracht und möchten diese auch mit anderen teilen?
- Sie wollen ihr Leben in Deutschland besser planen und bewältigen lernen?
- Sie möchten die Deutschen und ihre Lebensweise besser verstehen?
- Vielleicht begleiten Sie auch Geflüchtete und möchten sich einmal länger mit ihnen austauschen?
-
12.07.2018
-
17.08.2018
-
07.07.2018
In Deutschland leben knapp 4 Mio. Frauen mit Migrationshintergrund, viele von ihnen sind Mütter. Ihr Potenzial für den Arbeitsmarkt, für die Nachwuchsförderung und gegen den Fachkräftemangel bleibt noch zu oft ungenutzt.Was können Unternehmen tun, um Mütter mit Migrationshintergrund als qualifizierte Arbeitskräfte zu gewinnen? Wie können Unternehmen die Kompetenzen und das Potenzial motivierter Frauen besser erschließen? Und: Welche Angebote machen ein Unternehmen für Mütter mit Migrationshintergrund attraktiv?
Mittwoch, 04. Juli 2018
13.00 – 16.30 Uhr
SportCentrum Kamen Kaiserau
Jacob-Koenen-Straße 2
59174 Kamen
Um Anmeldung bei Beatrice von Hall wird gebeten; telefonisch unter 02307/2899093, per E-Mail unter vonhall@multikulti-forum.de.
Das Tagesseminar vermittelt Wissen zu Gewalterfahrungen, bespricht Symptome, die auftreten können, und Folgen, die sich beobachten lassen. Zudem wird thematisiert, was man in Krisen tun kann, um Traumatisierte zu unterstützen.
Orientiert an den Bedarfen der Teilnehmer*innen wird auf konkrete Fragen aus der Praxis und der Begleitung insbesondere geflüchteter Kinder und Jugendlicher eingegangen. Zudem soll es darum gehen, was ich selbst an Ideen und Ressourcen brauche, um hilfreich sein zu können: Wie kann ich als professionelle oder ehrenamtliche Helfer*in angemessen und unterstützend damit umgehen und gleichzeitig meine eigenen Grenzen achten?
-
06.07.2018
Juni 2018
-
01.07.2018
-
26.06.2018
Der Kongress „Gesellschaftlicher Dialog Öffentliche Sicherheit“, unter der Präsidentschaft von Wolfgang Bosbach, MdB a.D., lädt am 26.06.18 in Berlin 400 Teilnehmende, darunter Staatssekretär Engelke (BMI) und die wichtigsten Entscheider aus Politik und Sicherheitsbehörden, ein, im Zuge von 6 Leitfragen in den interdisziplinären Dialog zu treten.
Das Eröffnungsplenum thematisiert zunächst die aktuelle Gefährdung. Kongresspräsident Wolfgang Bosbach, Staatssekretär Hans-Georg Engelke, BKA-Präsident Holger Münch, BND-Vizepräsident Guido Müller und weitere Diskutanten geben aus ihrer jeweiligen Perspektive Einblicke in Bedrohungslagen und sich daraus ergebende Herausforderungen.
In insgesamt 6 Foren werden am Kongresstag unter anderem die Themen Sicherheitsarchitektur, Digitalisierung, Übergriffe auf Beamte und die Zusammenarbeit zwischen Staat und Wirtschaft diskutiert.
Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeit finden Sie auf der Website von Wegweiser.
-
27.06.2018
-
24.06.2018
-
23.06.2018
-
15.06.2018
- Was bedeutet es, wenn Engagement für Geflüchtete und ihre Belange nicht nur in der Medienöffentlichkeit, sondern auch vor Ort vielfach zu einem kontroversen Thema geworden ist?Wie sieht das Profil einer differenzierten Landschaft von Einstellungen aus, in der sich neben Offenheit und Unterstützungsbereitschaft immer mehr auch Abwehr, Sorge und ein neuer Realismus artikulieren?
- Wie schlagen sich solche Veränderungen nieder im Verständnis und Selbstverständnis von Engagement und Engagierten? Wie wichtig sind stabilisierende Organisationen und Weltanschauungen und wie wichtig die Bindungskräfte der Beziehungen, die in der Tätigkeit entstanden sind? Wie stimmig ist angesichts der Vielfalt von Motiven und Formen ein bis heute vorherrschender öffentlicher Diskurs, der die Engagierten als „Helfer“ und „Ehrenamtliche“ und kaum als auch politisch motivierte sehen?
- Neue Formen der Kooperation haben sich herausgebildet. Die auch heute noch in den meisten Städten und Gemeinden präsenten Initiativen und Bewegungen zur Unterstützung und Integration Geflüchteter waren und sind auf Zusammenarbeit angewiesen – auf Vernetzung mit weiteren Akteuren in der Gesellschaft, aber vor allem auch mit Verwaltungen und Vertretern der Politik, Parteien und Bürgermeistern. Wie ist es um die weitere Entwicklung der aus dem Wir-Gefühl der Unterstützerbewegung entstandenen Kooperationsformen bestellt?
-
12.06.2018
Neben dem weithin bekannten Hundertwasserhaus in Magdeburg findet am 9. Juni ein interkulturelles Begegnungsfest unter dem Motto "Gemeinsam in Vielfalt - Together in diversity" statt. Dabei geht es um eine offene Begegnung verschiedener Kulturen und ein gegenseitiges Kennen- und Verstehen lernen.
Alle „Neu- und Altmagdeburger*innen“ sind dazu herzlich eingeladen. Auf dem Programm des Festes stehen ein interessantes Bühnenprogramm aus Musik und Kultur sowie Aktionen. Außerdem wollen sich migrantische, integrativ und antirassistisch arbeitende Initiativen und Vereinen mit Infoständen beteiligen und ihre Tätigkeit vorstellen. Statt übereinander sollten wir wieder mehr miteinander reden, heißt es in der Einladung. Gegenseitiges interkulturelles Verständnis und Respekt entstünden durch Begegnung auf Augenhöhe.
-
10.06.2018
Gefängnisse gelten als Orte der Rekrutierung und Radikalisierung. Im Rahmen des Fachtags sollen Ansätze, Konzepte und Erfahrungen der politischen Bildungsarbeit zu den Themenfeldern Rechtsextremismus und Islamismus im Strafvollzug diskutiert werden. Die Veranstaltung richtet sich an Fachkräfte der politischen Bildung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalten sowie Fachreferentinnen und -referenten der Justizministerien.
Veranstalter ist das Anne Frank Zentrum in Kooperation mit dem Violence Prevention Network und der Bundeszentrale für politische Bildung.
Die Stellen „Ehrenamt“ und „Migration“ bieten gemeinsam eine eineinhalbstündige Abendveranstaltung an, bei der Sie selbst erleben können, was eine interkulturelle Erfahrung ist. Anschließend sprechen wir darüber, was es bedeutet interkulturell kompetent zu sein. Ist das etwas Neues oder gab es das eigentlich schon immer? Was zeichnet interkulturell kompetente Menschen aus? Wofür braucht man das und wie ist man denn im Alltag „interkulturell kompetent“? Wie kann ich das für die Vereinsarbeit nutzen?
Mittwoch 06.06.2018, 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr
Anmeldeschluss ist der 29.05.2018
Anmeldungen bitte direkt an:
Landkreis Rotenburg (Wümme) Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe Frau Charbonnier Tel. 04261/983-2854 E-Mail: migration@lk-row.de
Die Stellen „Ehrenamt“ und „Migration“ bieten gemeinsam eine eineinhalbstündige Abendveranstaltung an, bei der Sie selbst erleben können, was eine interkulturelle Erfahrung ist. Anschließend sprechen wir darüber, was es bedeutet interkulturell kompetent zu sein. Ist das etwas Neues oder gab es das eigentlich schon immer? Was zeichnet interkulturell kompetente Menschen aus? Wofür braucht man das und wie ist man denn im Alltag „interkulturell kompetent“? Wie kann ich das für die Vereinsarbeit nutzen?
Mittwoch 06.06.2018, 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr
Anmeldeschluss ist der 29.05.2018
Anmeldungen bitte direkt an:
Landkreis Rotenburg (Wümme) Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe Frau Charbonnier Tel. 04261/983-2854 E-Mail: migration@lk-row.de
-
08.06.2018
-
05.06.2018
Im November 2017 kamen erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik Migrantenorganisationen aus ganz Deutschland selbstbestimmt und mit eigener Agenda zusammen. Über 100 Vertreter*innen aus 60 Organisationen und Institutionen setzten mit dieser ersten Bundeskonferenz der Migrantenorganisationenein deutliches Zeichen: „Wir werden diese Gesellschaftmitgestalten!“
Bei der diesjährigen 2. Bundeskonferenz der Migrantenorganisationen stehen die folgenden Themen im Fokus:
- Empowerment und Anti-Rassismus
- Partizipationsgesetz auf Bundesebene
- Politische Bildung
Darüber hinaus werden zentrale Entscheidungen über die Struktur der Konferenz, das eigene Selbstverständnis und ihre Arbeitsweise getroffen. Die Geschäftsordnung zur Bundeskonferenz der Migrantenorganisationen wurde von einer Arbeitsgruppe entworfen und mit der Vorbereitungsgruppe der BKMO abgestimmt.
Das ausführliche Programm sowie die Einladung können Sie hier nachlesen.
-
02.06.2018
In dieser Fortbildung für Lehrende (hauptamtlich und ehrenamtlich) werden die speziellen Herausforderungen in der Sprachvermittlung mit geflüchteten Menschen thematisiert. Schlimme Fluchterfahrungen sowie fortlaufende existentielle Sorgen behindern das Lernen. Eine Schulbildung von nur wenigen Jahren hat vielleicht nicht ausreichend auf das Lernniveau in Integrationskursen vorbereitet. Englischkenntnisse als Brückensprache sind nicht vorhanden.
Es werden Methoden und Mittel der Sprachvermittlung vorgestellt, die eine leichtere Verankerung von Wissen und einen besseren Zugang zum Lerner ermöglichen. Nicht zuletzt sind Motivation und Lernerfolgserlebnisse essentiell für den Spracherwerb. Durch Arbeit mit Symbolen und Bildern sowie mit Spielen für die Festigung von Wortschatz und Sprachstrukturen kann der Lernerfolg gesteigert werden, nicht nur von geflüchteten Menschen.
-
01.06.2018
Dieses Seminar soll Aktiven (hauptamtlich und ehrenamtlich) in der Integrationsarbeit vermitteln, wie man kulturelle Inhalte in kurzen Modulen gestalten kann.
Deutschland ist gespalten. Es bestehen in der Gesellschaft höchst unterschiedliche Ansichten zu Fragen von Asyl und Einwanderung, zu Religion und insbesondere dem Islam, zu der Frage wie gleichberechtigt man eigentlich gegenwärtig in Deutschland leben kann.
Umso wichtiger ist die Frage, was man gegen Radikalisierung unternehmen kann. Es gilt einerseits zu verhindern, dass sich gerade junge Menschen radikalisieren. Andererseits besteht die Herausforderung, Menschen zu deradikalisieren, die sich für rassistische, salafistische oder antisemitische Ideen begeistern. Wie kann Präventionsarbeit gelingen, wenn die Gesellschaft insgesamt radikaler wird? Welche Anforderungen stellt die rechtspopulistische Bewegung an die Deradikalisierungsarbeit? Was können diejenigen voneinander lernen, die in der Arbeit gegen Rechtsextremismus und gegen islamistischen Extremismus aktiv sind?
Mai 2018
-
30.05.2018
Die Berliner Fachstelle gegen Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt bietet verschiedene Weiterbildungs-Formate an. Ziel ist, zu einer Kultur fairen Vermietens in Berlin beizutragen.
Das Fair mieten – Fair wohnen Seminar 1 bietet eine Einführung dazu, was Diskriminierung beim Zugang zum Wohnungsmarkt und im nachbarschaftlichen Miteinander bedeutet und welche rechtlichen Grundlagen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) und das Mietrecht bieten, dagegen vorzugehen. Diese Weiterbildung richtet sich an alle Interessierten.
Die Beschäftigung von Geflüchteten ist einer der wichtigsten Schritte zu gelingender Integration. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen (UNHCR) haben zahlreiche regionale Dialoge mit Arbeitgebern und Unternehmensverbänden aus neun Ländern sowie auf Europäischer Ebene geführt, um Erfahrungen zu sammeln und sich über gelungene Ansätze auszutauschen. Das Ergebnis dieser Dialoge und weiterer Konsultationen mit Flüchtlingen, staatlichen Stellen und d er Zivilgesellschaft haben die beiden Organisationen in einem 10 - Punkte - Aktionsplan zusammengefasst, den wir gemeinsam mit dem Deutschen Industrie - und Handelskammertag vorstellen und mit Ihnen diskutieren möchten.
Freitag, 25. Mai 2018 10:00 - 12:00 Uhr
Haus der deutschen Wirtschaft
Breite Str, 29, 10178 Berlin
Um eine Verbindliche Anmeldung an berlin.centre@oecd.org wird gebeten.
-
07.06.2018
"Rennen, laufen, hetzen über Tage, Wochen und Monate – ums reine Überleben. Weltweit fliehen mehr als 60 Millionen Menschen vor Not, Krieg und Terror, die Hälfte davon sind Kinder. Irgendwo wird ihre Flucht vorerst ein Ende finden. Vielleicht in unserer Stadt, in unserer Nachbarschaft.
Es gibt viele Gründe für Migration: Verfolgung und Krieg, Armut und Hunger, aber auch das Streben nach einem besseren Leben. Migration ist – kurz definiert – die mittel- oder langfristige Verlagerung des Lebensmittelpunktes. Das geschieht in großer Zahl im legalen Rahmen, aber auch außerhalb dessen und betrifft Europa in zunehmenden Maße.
Wie durchdacht und nachhaltig ist diese Politik? Auf welche gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Prozesse trifft die externe Migrationspolitik der EU in afrikanischen Staaten? Welche Möglichkeiten der Kooperation wären wünschenswert? Welche sind realistisch?
Mit:
- Christian Jakob, Journalist „die tageszeitung" & Autor des Buchs „Diktatoren als Türsteher Europas“ (Ch. Links Verlag)
- Dr. Melanie Müller & Dr. Isabelle Werenfels, Stiftung Wissenschaft und Politik, Mitautorinnen der Studie „Migrationsprofiteure? Autoritäre Staaten in Afrika und das europäische Migrationsmanagement“
- Kirsten Maas-Albert, Heinrich-Böll-Stiftung, Konzeption/ Redaktion „Die Orangen in Europa schmecken besser - Über Fluchtursachen, ihre Bekämpfung und was daran nicht stimmt“
- Moderation: Mekonnen Mesghena, Heinrich-Böll-Stiftung
1,4 Millionen Menschen beantragten von 2015 bis 2017 Asyl in Deutschland. Viele sind aus Konflikt- und Bürgerkriegsländern geflüchtet. Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen unter ihnen können durch eine Berufsausbildung eine Perspektive in Deutschland entwickeln.
Passenderweise klagen Betriebe und Arbeitgeberverbände, dass sie zu wenig Auszubildende fänden. Andererseits bekamen 2017 bundesweit rund 80.000 Suchende keinen Ausbildungsplatz. Besonders schlechte Karten haben Bewerber_innen mit so genanntem Migrationshintergrund, selbst wenn sie über die gleichen Schulabschlüsse verfügen wie Menschen ohne Migrationshintergrund.
Wie finden Ausbildungssuchende und Betriebe besser zusammen? Wie erhalten Geflüchtete einen Ausbildungsplatz? Welche Rolle spielen Betriebe, Politik und die jungen Menschen selbst, wenn es um den Zugang zu Berufsbildung geht?
Dienstag, 19.06.18
17:00 bis 21:00 Uhr
Hiroshimastr. 28, 10785 Berlin
Anmeldungen werden über die Seite der Friedrich Ebert Stiftung entgegen genommen.
Bei der Veranstaltungsreihe “Polis kocht! Außen- und Europapolitik geht durch den Magen“ können Sie in entspannter Atmosphäre mit EntscheidungsträgerInnen ins Gespräch kommen. Zuerst wird heiß gekocht – und danach bei Tisch hitzig diskutiert!
Bei der ersten Veranstaltung dieser Reihe möchten die Veranstalterzum Thema Arbeitsmarktintegration geflüchteter Frauen diskutieren. Nach einem kurzen Input von Margrit Zauner, Abteilungsleiterin Arbeit und Berufliche Bildung der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales möchten sie der Frage nachgehen, welche Hürden es für Chancengleichheit für geflüchtete Frauen auf dem deutschen Arbeitsmarkt gibt und welche Handlungsoptionen zur Verfügung stehen.
25/05/2018
19:00 - 22:00 Uhr
Bi’bak
Prinzenallee 59 - Berlin-Wedding
Die letzten Jahre haben deutlich gemacht, dass die Themen Migration, Integration, Flucht und Asyl geradezu omnipräsent sind. Täglich und über alle Ressortgrenzen hinweg befassen sich Journalist*innen mit diesem vielschichtigen Gebiet. Ob Lokalberichterstattung, Innen- und Weltpolitik oder Kultur: Migrations- und Integrationsaspekte spielen immer wieder eine zentrale Rolle in der Berichterstattung. Für Medienschaffende ist das eine große Herausforderung. Unser Seminar rückt das journalistische Handwerkszeug in den Mittelpunkt, das nötig ist, um professionell über diese aktuellen Fragen zu berichten.
Die Themen:
- Wie berichten Medien über Migration & Integration?
- Good-Practice, Bad-Practice: Wie und warum unterlaufen Fehler und werden Stereotype oder Vorurteile kommuniziert?
- Welche Instrumente und Arbeitsweisen können helfen, um mehr Perspektiven einzubringen und differenziert zu berichten?
- Sensibilisierung: Wie entstehen Stereotype? Wie können wir in der journalistischen Praxis einseitiger Berichterstattung vorbeugen?
- Professionelle Berichterstattung über Migration & Integration mit Hilfe der Wissenschaft: Zahlen, Fakten, Übungen.
- Tools, Checklisten, Tipps für die journalistische Arbeit.
- Analyse, Feedback und Diskussion der eingesandten journalistischen Beiträge aller Teilnehmer*innen.
Im Seminar wechseln sich Vorträge, Übungen und gemeinsame Diskussionen über die journalistische Praxis ab. Reflektion und kollegialer Austausch stehen im Mittelpunkt.
Termin: Montag, 25. Juni, 11.30 Uhr, bis Dienstag, 26. Juni 2018, 17 Uhr
Die Weiterbildung richtet sich an freie und fest angestellte Journalist*innen aller Medienarten, die regelmäßig migrations- und integrationspolitische Themen bearbeiten oder künftig bearbeiten werden.
Bewerbungen für das Seminar, welches auf 12 Plätze begrenzt ist können, bis zum 03.06.2018 an bewerbung@neuemedienmacher.de versendet werden.
-
23.05.2018
-
17.05.2018
„Zusammenhalt stärken – Vielfalt gestalten“
Wie können wir den Zusammenhalt stärken? Wie kann Vielfalt gelebt werden? Und wie ist dies in Deutschland und Europa möglich? Der 81. Deutsche Fürsorgetag beschäftigt sich mit diesen Fragen nach modernen und zukunftsfesten sozialen Sicherungssystemen, nach notwendigen gesetzlichen Rahmenbedingungen z.B. für veränderte Familienformen und künftige soziale Netze. Er hat seinen Fokus auf den Themen Integration, Inklusion und Identitäten als Triebfedern des gesellschaftlichen Zusammenhalts und einer aktiven Zivilgesellschaft. Die Veranstaltung bringt Menschen aus allen Bereichen der sozialen Arbeit zusammen und ermöglicht einen fruchtbaren Austausch.
-
16.05.2018
-
05.05.2018
-
06.05.2018
Viele Menschen, die aus Kriegsgebieten fliehen, haben wiederholt schwere seelische und körperliche Belastungen erlebt. Als Folge der schrecklichen Erlebnisse können Ängste, Panikattacken, Stimmungsschwankungen, Vermeidungs- und Suchtverhalten auftreten.
In dieser IBIS-Fortbildung werden Lehrer_innen dafür sensibilisiert, Anzeichen für Traumata bei Geflüchteten früh zu erkennen. Sie erhalten kompakte Informationen und Gestaltungstipps für den Unterricht mit Menschen, die schwere Belastungen erlebt haben.
Die Fortbildung ist geeignet für alle Menschen, die gern mehr Hintergrundwissen zum Thema „Traumasensibler Unterricht“ hätten - Lehrkräfte, die Integrationskurse leiten, aber auch andere Unterrichtende.
Die Fortbildung umfasst 20 UE und kostet 200 Euro. Aktive Integrationskurs-Lehrkräfte haben einen besonderen Vorteil: sie erhalten nach der Teilnahme die Kursgebühr in voller Höhe vom BAMF erstattet. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs angenommen. Anmeldeschluss ist 10 Tage vor Kursbeginn.
-
06.05.2018
-
06.05.2018
-
06.05.2018
Das Projekt "Menschen verbinden Menschen" des Freiwilligenzentrums Hannover sucht freiwillige Patinnen und Paten, die Neuzugewanderte in ihrem Alltag unterstützen.
Das Ziel des Bürgerbündnisses "Menschen verbinden Menschen" ist es, dass den Zugewanderten, für die alles neu ist, das Einleben möglichst leicht fällt. Dabei können alle helfen: in der Nachbarschaft, auf Augenhöhe, als Patinnen und Paten. Das Bürgerbündnis will durch konkrete Angebote geflüchtete Menschen mit Hannoveranerinnen und Hannoveranern in Kontakt bringen und lädt zu einer Veranstaltung ein.
Die Veranstaltung zeigt, dass Hilfe in vielen Bereichen gesucht wird, wie z. B. beim Erlernen und Anwenden der deutschen Sprache oder beim Verstehen von Behördenpost, bei den ersten Schritten in die Arbeitswelt, der Suche nach einer Kita oder Schule. Auch die gemeinsame Freizeitgestaltung ist oft ein wichtiger Teil der Patenschaft. Diese Fragen werden auf der Informationsveranstaltung geklärt. Spannend zum Beispiel wird es, wenn Angelika H. und Khaklil D. aus ihrem Begleitungsalltag erzählen: Angelika stellt dar, was sie als Patin dazu bewegt, sich zu engagieren und was sich seither in ihrem Leben verändert hat. Khalil erzählt, was ihm die Begleitung bedeutet und was sich in seinem Leben verändert hat
Datum: Donnerstag, 03.05.2018
Zeit: 18:00 Uhr
Ort: Freiwilligenzentrum Hannover im üstra Kundenzentrum, Karmarschstr. 30/32,30159 Hannover
April 2018
- Ist der Islam vereinbar mit demokratischen Grundwerten?
- Zeitgenössische Auslegung des Koran
In ihrem Vortrag wird Dina El Omari mit der historisch kritischen Lesart des Koran einen Zugang aufzeigen, der dem Anspruch des Koran gerecht wird, eine Orientierung für alle Zeiten zu sein. Durch eine Neuinterpretation religiöser Quellen argumentiert sie für Geschlechtergerechtigkeit im Islam.
-
26.04.2018
In vielen Köpfen existiert die Vorstellung von einerseits "bunten" Großstädten und andererseits "monochromen" Kleinstädten, in denen die Uhren anders ticken. In der Realität sind die über 1.300 kleineren Städte in Deutschland überaus heterogen, wie auch deren Stadtgesellschaft vielfältig ist. Die Zuwanderung bietet Chancen für die Entwicklung der Klein- und Mittelstädte und stellt diese gleichermaßen vor die Herausforderung, die zunehmende Vielfalt als Prozess zu gestalten. Der Zuzug von Geflüchteten entfaltete vielerorts eine Katalysatorwirkung: Nach Erstaufnahme und Unterbringung stellte sich nämlich rasch die Frage, wie sich das zukünftige Zusammenleben und der gesellschaftliche Zusammenhalt in einer durch Mobilität geprägten Gesellschaft gestalten lassen.
Auf der Fachtagung werden Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem dreijährigen Forschungs-Praxis-Projekt vorgestellt und in übergreifende Fachdiskurse eingebettet. In Vorträgen, Gesprächsrunden und Panels sollen ausgewählte Themen erörtert und Fragestellungen vertieft werden:
Wie verändert Vielfalt die Innenstädte?
Wie lassen sich gesellschaftliche Teilhabe und sozialer Zusammenhalt in der Migrationsgesellschaft fördern?
Welche Beiträge leisten integrierte Konzepte zur Stärkung der Innenstädte?
Welche neuen Raumangebote sind erforderlich? Wie beeinflusst die zunehmende Vielfalt die städtische Identität?
-
27.04.2018
-
24.04.2018
-
21.04.2018
Vor diesem Hintergrund sollen rechtliche und praktische Verfahren des Familiennachzugs und Resettlements sowie der Ausbildungsduldung und der Situation in Afghanistan nach Rückkehr oder Abschiebung diskutiert werden.
Zielgruppe der Tagung sind Interessierten aus Behörden, Gerichten, Anwaltschaft, Verbänden, Unterstützergruppen und privat Interessierten ein.
Anmeldung per Mail an miriam.kamber@evlka.de oder mithilfe des Anmeldeformulars in der Programmanlage.
Wir freuen uns, wenn Sie die Einladung an Interessierte weitergeben und auch in Ihren sozialen Netzwerken teilen und verbreiten.
-
20.04.2018
Vorstellung des SVR-Jahresgutachtens 2018:
„Steuern, was zu steuern ist: Was können Einwanderungs- und Integrationsgesetze leisten?“
Die neue Regierung hat sich das Ziel gesetzt, Einwanderung und Integration stärker zu steuern. Deutschland ist zwar seit langem ein Einwanderungsland, aber Bildungs- und Arbeitsmarktdaten zeigen, dass Menschen mit Migrationshintergrund auf dem Weg zu gesellschaftlicher Teilhabe immer noch auf Hürden treffen. Nachdem v. a. in den Jahren 2015 und 2016 zudem eine große Zahl Flüchtlinge nach Deutschland gekommen ist, diskutiert die Politik vermehrt über den Nutzen von Einwanderungs- und Integrationsgesetzen. Das SVR-Jahresgutachten 2018 analysiert die Chancen und Grenzen solcher Gesetze auf Bundes- sowie bei Integrationsgesetzen und -konzepten auch auf Länder- und kommunaler Ebene und liefert politische Empfehlungen zu einer verbesserten Steuerung von Migration und Integration.
Der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR) lädt zu einer Pressekonferenz ein.
am Dienstag, 24. April 2018, um 10.30 Uhr
im Tagungszentrum im Haus der Bundespressekonferenz, Raum III/IV,
Schiffbauerdamm 40, 10 117 Berlin.
Nach einer Vorstellung des Gutachtens durch den Vorsitzenden werden die Sachverständigen für Rückfragen zur Verfügung stehen.
-
20.04.2018
Das Kompetenzzentrum zur Koordinierung des Präventionsnetzwerks gegen Extremismus Baden-Württemberg (KPEBW) richtet am 19./20. April 2018 mit der DeGEval - Gesellschaft für Evaluation e.V. eine Tagung zum Thema „Evaluation deradikalisierender Maßnahmen: Wirkungen der Prävention gewaltbereiten Extremismus bestimmen“ in Stuttgart aus.
Die Tagung richtet sich vor allem an Programmverantwortliche sowie in entsprechenden Programmen und Initiativen Tätige, die ein Interesse an verschiedenen Ansätzen der Wirkungsmessung und Bewertung ihrer Arbeit haben bzw. eine Evaluation ihrer Tätigkeiten planen.
Die Tagung beginnt am 19. April 2018 um 12:30 Uhr mit drei Einführungsreferaten (zugesagt: Nationales Zentrum Kriminalprävention, Deutsches Jugendinstitut, Hochschule Esslingen) und beleuchtet die Beiträge in einer Podiumsdiskussion. Am Vormittag des 20. April 2018 werden drei Workshops mit Expertinnen und Experten des Handlungsfelds durchgeführt (Thematische Ansätze: Präventionsprojekte, Intervention, Beratungsnetze). Die Erträge werden in einer Fishbowl-Diskussion vertieft, bevor die Tagung gegen 13:00 Uhr endet.
-
20.04.2018
-
25.04.2018
-
14.04.2018
Wie gehe ich professionell mit Medienanfragen um? Wie verhindere ich, dass mein Thema in der Presse falsch dargestellt wird? Wie kann sich unsere Organisation vor Falschdarstellungen schützen? Muslimische Organisationen stehen neben den alltäglichen Fragen einer guten Pressearbeit zusätzlich vor der Herausforderung, diese Arbeit in einer dem Islam gegenüber skeptisch eingestellten Öffentlichkeit zu betreiben. Das Medientraining will Vertreter*innen muslimischer Organisationen Argumentationshilfen, Handwerkszeug und Strategien für einen professionellen Umgang mit der Presse an die Hand geben.
Anmeldung: kontakt@house-of-resources.berlin
-
13.04.2018
Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) lädt zum Abschluss der Laufzeit des Projekts “ABCami – Alphabetisierung und Grundbildung an Moscheen” zu einer Konferenz mit dem Titel “Am Mut hängt der Erfolg – Erfolgreiche Alphabetisierung von Zugewanderten” ein. Das Projekt ABCami wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert, Vertreter*innen werden auch bei der Konferenz anwesend sein – neben der Bevollmächtigten des Landes Berlin beim Bund, Sawsa Chebli, und Projektleitenden von ABCami sowie weiteren Gästen.
Datum: 13.04.2018 // Zeit: 10 bis 16.30 Uhr // Ort: //
Anmeldung bis 02.04. an abcami.buero@giz.berlin.
-
11.04.2018
-
07.04.2018
-
08.04.2018
März 2018
-
25.03.2018
-
21.03.2018
-
21.03.2018
Ziel des Mathematik-Intensivkurses für Geflüchtete ist die Vorbereitung auf ein Studium an einer deutschen Universität. Während des sieben wöchigen Kurses soll neben der Kenntnis von fachspezifischen Vokablen das Abiturniveau erreicht werden. Es ist NICHT möglich eine Hochschulzugangsberechtigung in diesem Kurs zu erwerben. Der Kurs startet am 26.03.2018.
In einer Informationsveranstaltung am 21.03.2018, 17:00 Uhr, informiert die Universität über diesen Kurs.
Raum A410, Welfengarten 1, Leibniz Universität Hannover
-
19.03.2018
Nicht erst seit der Diskussion um eine Zentrale Ausländerbehörde (ZAB) in Münster ist das so genannte „Integrierte Rückkehrmanagement“ des Landes NRW in den Fokus gerückt. Das Land verfolgt damit das Ziel, Geflüchtete frühzeitig zur Ausreise zu drängen, Abschiebungen zu forcieren und Teilhabe zu verhindern.
Die Veranstaltung hat das Ziel, das „Integrierte Rückkehrmanagement“ als Ganzes kritisch zu beleuchten und dabei auch die Initiativen der Münsterlandkreise mit einzubinden.Vortrag und Diskussion u.a. mit: Dietrich Eckeberg (Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe), Hermann Stubbe (Grüne Kreis ST) und weiteren Gästen.
-
18.03.2018
-
18.03.2018
-
16.03.2018
-
15.03.2018
-
14.03.2018
Um Geflüchtete mit Studienambitionen besser und gezielter auf ein Hochschulstudium an einer deutschen Universität vorzubereiten, werden ab dem Sommersemester Vorkurse in verschiedenen Fächern angeboten. Hierzu findet am Mittwoch, den 14.03., um 17.30 Uhr in der VHS REGION Lüneburg eine Info-Veranstaltung statt. (Haagestraße 4, 21335 Lüneburg)
-
14.03.2018
-
16.03.2018
-
15.03.2018
-
25.03.2018
-
11.03.2018
-
10.03.2018
-
09.03.2018
-
09.03.2018
-
07.03.2018
Februar 2018
-
25.02.2018
-
23.02.2018
-
23.02.2018
-
21.02.2018
-
23.02.2018
-
22.02.2018
-
18.02.2018
-
17.02.2018
-
16.02.2018
-
16.02.2018
-
07.02.2018
-
09.02.2018
Januar 2018
-
31.01.2018
-
24.01.2018
-
02.02.2018
-
21.01.2018
-
26.01.2018
Dezember 2017
-
20.12.2017
-
15.12.2017
-
13.12.2017
-
13.12.2017
-
10.12.2017
-
18.12.2017
-
05.12.2017
November 2017
-
01.12.2017
-
26.11.2017
-
25.11.2017
-
26.11.2017
-
26.11.2017
-
26.11.2017
-
22.11.2017
-
21.11.2017
-
17.11.2017
-
16.11.2017
-
10.11.2017
-
10.11.2017
-
08.11.2017
-
08.11.2017
-
05.11.2017
-
03.11.2017
-
03.11.2017
Oktober 2017
-
27.10.2017
-
24.10.2017
-
17.10.2017
-
15.10.2017
-
13.10.2017
-
23.06.2017
-
06.10.2017
September 2017
-
29.09.2017
-
30.09.2017
-
24.09.2017
-
24.09.2017
-
23.09.2017
-
20.09.2017
-
20.09.2017
-
15.09.2017
-
17.09.2017
-
08.09.2017
-
06.09.2017
-
03.09.2017
-
03.09.2017
-
02.09.2017
August 2017
-
20.08.2017
-
13.08.2017
-
11.08.2017
-
11.08.2017
Juli 2017
-
01.10.2017
-
21.07.2017
Juni 2017
-
21.06.2017
-
20.06.2017
-
20.06.2017
-
08.06.2017
Mai 2017
-
02.06.2017
-
01.06.2017
-
30.05.2017
-
24.05.2017
-
20.05.2017
-
20.05.2017
-
19.05.2017
-
05.05.2017
-
05.05.2017
-
06.05.2017
April 2017
-
29.04.2017
-
28.04.2017
-
27.04.2017
-
22.04.2017
-
22.04.2017
-
21.04.2017
-
05.04.2017
-
05.04.2017
März 2017
-
31.03.2017
-
01.04.2017
-
21.01.2018
-
25.03.2017
-
24.03.2017
-
21.03.2017
-
23.03.2017
-
18.03.2017
-
18.03.2017
-
19.03.2017
-
15.03.2017
-
26.03.2017
-
24.09.2017
-
12.03.2017
-
11.03.2017
-
10.03.2017
-
08.03.2017
-
07.03.2017
-
13.04.2017
-
10.09.2017
-
04.03.2017
-
26.03.2017
-
02.03.2017
-
31.05.2017
Februar 2017
-
24.02.2017
-
21.02.2017
-
18.02.2017
-
19.02.2017
-
17.02.2017
-
16.02.2017
-
15.06.2017
-
02.02.2017
Januar 2017
-
24.02.2017
Dezember 2016
-
27.01.2017
-
17.12.2016
-
16.12.2016
-
13.12.2016
-
09.12.2016
-
07.12.2016
-
04.12.2016
-
02.12.2016
November 2016
-
05.12.2016
-
30.11.2016
-
23.12.2016
-
25.11.2016
-
25.11.2016
-
25.11.2016
-
19.11.2016
-
08.01.2017
-
19.11.2016
-
16.11.2016
-
13.11.2016
-
12.11.2016
-
11.11.2016
-
05.11.2016
-
04.11.2016
-
04.11.2016
-
04.11.2016
Oktober 2016
-
28.10.2016
-
28.10.2016
-
22.10.2016
-
05.11.2016
-
18.10.2016
-
18.10.2016
-
18.10.2016
-
16.10.2016
-
14.10.2016
-
08.10.2016
-
08.07.2016
-
21.10.2016
September 2016
-
30.09.2016
-
01.10.2016
-
25.09.2016
-
24.09.2016
-
23.09.2016
-
23.09.2016
-
17.09.2016
-
13.09.2016
-
12.09.2016
-
11.09.2016
August 2016
-
21.08.2016
-
12.08.2016
Juli 2016
-
17.07.2016
-
10.07.2016
Juni 2016
-
01.07.2016
-
26.06.2016
-
22.06.2016
-
16.06.2016
-
07.06.2016
-
03.06.2016
Mai 2016
-
20.06.2016
-
29.05.2016
-
16.05.2016
-
10.05.2016
April 2016
-
21.04.2016
-
20.04.2015
-
10.04.2016
-
07.04.2016
März 2016
-
19.03.2016
-
15.03.2016
-
06.03.2016
-
05.03.2016