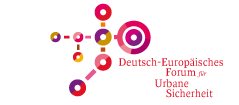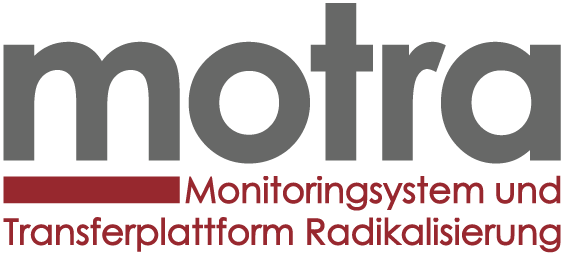| |
„Prävention und gesellschaftlicher Frieden“ lautet das Schwerpunktthema des Deutschen Präventionstags in seinem Jubiläumsjahr.
In einer Zeit wachsender gesellschaftlicher Spannungen und globaler Unsicherheiten ist die Förderung von Prävention und gesellschaftlichem Frieden eine grundlegende Verpflichtung aller verantwortungsvollen Institutionen, Organisationen und Einzelpersonen. Für ein friedliches gesellschaftliches Zusammenleben ist mehr nötig als die Abwesenheit von Krieg. Es braucht soziale Gerechtigkeit, Rechtsstaatlichkeit, Partizipationsmöglichkeiten, Minderheitenrechte und Wege, Konflikte konstruktiv auszutragen. Ohne dieses Fundament bleibt Frieden fragil.
Der Begriff gesellschaftlicher Frieden verweist jedoch nicht nur auf diese Bedingungsfaktoren, sondern gibt einen Hinweis für Verantwortlichkeiten. Neben dem Staat und seinen Institutionen tragen auch vielfältige gesellschaftliche Akteur:innen hierzu bei. Prävention, die gesellschaftlichen Frieden stützt und fördert, findet in der Antidiskriminierungsarbeit, im Entgegenwirken von struktureller, physischer und psychischer Gewalt und sozialen Ungleichheitslagen, in der Auseinandersetzung mit Medienberichterstattung und im Entgegenwirken gegen Desinformation, Verschwörungstheorien und Hassrede statt. Prävention im Rahmen von gesellschaftlichem Frieden stellt sich gegen Tendenzen der Polarisierung. Sie wirkt auf konstruktive Konfliktaustragungen hin, schafft Prozesse der vielfältigen Mitbestimmung, insbesondere auf kommunaler Ebene, und initiiert Orte des Zusammenhalts und der Integration. Gelingende Prävention greift Sorgen und Ängste unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppierungen auf, nimmt diese ernst und bearbeitet deren Ursachen faktenbasiert, kooperativ und lösungsorientiert. So kann Vertrauen in die rechtsstaatliche Demokratie gefördert werden.
Der Deutsche Präventionstag versteht sich als Plattform für den Austausch von Erfahrungen, Strategien und Innovationen zur Stärkung von Prävention und gesellschaftlichem Frieden. Gemeinsam wollen wir Verantwortung übernehmen – für eine friedlichere, gerechtere und widerstandsfähigere Gesellschaft. Denn: Frieden ist kein Zustand, sondern eine gemeinsame Daueraufgabe. Angesichts der gegenwärtigen Kriege und vielfältigen globalen Krisenlagen formulieren der Deutsche Präventionstag und seine ständigen Veranstaltungspartner zentrale Erkenntnisse sowie dringliche politische Forderungen. Diese basieren auf den wissenschaftlichen Expertisen der Begleitschrift zum Kongressschwerpunktthema und den Diskursen im Rahmen des 30. Deutschen Präventionstages in Augsburg. Die vielfältigen Unterthemen zu diesem elementaren Schwerpunktthema knüpfen an Erkenntnisse unterschiedlicher Wissenschaftsdisziplinen an, wie insbesondere der Politikwissenschaft, Soziologie, Psychologie und Kriminologie. Eine multidisziplinäre Sicht auf das Themenfeld verschafft die Chance, aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen zu fassen und Lösungs- und Handlungsansätze für die Prävention zu generieren.
- Konstruktive Konfliktbearbeitung
Seitens der Friedensforschung wird Frieden nicht als Utopie, sondern als gesellschaftlicher Prozess verstanden. Der Umgang mit Konflikten ist in diesem Prozess das zentrale Element. Dabei geht es um die Anerkennung der in einer freiheitlichen Gesellschaft zwangsläufig vorhandenen Konflikte, den Austausch dazu und deren Lösung. Bei einer konstruktiven Konfliktbearbeitung wird darauf geachtet, dass beim Aufeinandertreffen von Gegensätzen, bei Widerspruch und Differenzen Konflikte nicht eskalieren. Es geht darum, trotz Verschiedenheit in Kommunikation zu treten und Anstrengungen zu einem gegenseitigen Verstehen zu unternehmen. Ziel von Präventionsmaßnahmen sollte daher nicht primär die Vermeidung von Konflikten sein, sondern die Schaffung grundlegender Voraussetzungen zu einer gelingenden Konfliktaustragung. Hierbei können auch die Methodik der Mediation und deren Grundlagen eine entscheidende Rolle spielen und sollten auf allen Ebenen, auch im Bereich der öffentlichen Verwaltung, gestärkt werden. Ein Verständnis, dass Konflikte stets auf wichtige Umstände hinweisen können und damit auch die kraftvolle Chance zur konstruktiven Bearbeitung und Veränderung in sich bergen, sollte gefördert werden.
- Partizipationsmöglichkeiten
Schlüsselbegriffe friedvoller Konfliktaustragung sind Integration und Partizipation, denn nur hierüber können verschiedene Interessen artikuliert und ausgetauscht sowie Lösungsmöglichkeiten gefunden werden. Gesellschaftlicher Frieden wird durch die Einhaltung geteilter gesellschaftlicher Normen und Regeln getragen. Partizipationsangebote sind ein wesentlicher Bestandteil und Anreiz, sich als Teil der Gesellschaft zu verstehen und mitzuwirken. Den Kommunen kommt hierbei besondere Bedeutung zu, denn sie gestalten maßgeblich die alltägliche Lebenswirklichkeit der Menschen. Der öffentliche Raum stellt dabei häufig ein Konfliktfeld dar, in dem unterschiedliche Nutzungsinteressen aufeinandertreffen. Umso wichtiger ist es, dass insbesondere jungen Menschen überzeugende und ernst gemeinte Angebote zur Mitgestaltung eröffnet werden, um ihr Potenzial zur aktiven gesellschaftlichen Teilhabe zu nutzen. Gerade die aktive Mitwirkung an gesellschaftlichen Entscheidungen stärkt die Akzeptanz gemeinsamer Normen. Partizipation wird so zum Schlüssel für sozialen Zusammenhalt.
- Zivilgesellschaftliche Bündnisse
Zivilgesellschaftliche Bündnisse sind wichtige Akteur:innen, wenn es darum geht, gemeinsam gesellschaftliche Anliegen voranzubringen, die über die Möglichkeiten einzelner Personen hinausgehen. Diese Bündnisse sind Zusammenschlüsse von Organisationen, Gruppen und oft auch Einzelpersonen aus der Zivilgesellschaft – etwa aus Vereinen, Initiativen, Kirchen, Gewerkschaften, Verbänden oder der Wissenschaft. Durch die Bündelung von Kräften und Stimmen, um auf politische Entscheidungen Einfluss zu nehmen, Missstände öffentlich zu machen oder gesellschaftliche Veränderungen anzustoßen, fördern sie Teilhabe, Meinungsvielfalt und demokratische Debatten. Sie bieten Menschen die Möglichkeit, sich jenseits staatlicher Institutionen aktiv für gesellschaftliche Belange zu engagieren und können so das Gefühl von Solidarität und gegenseitiger Unterstützung stärken. Kurz gesagt sind zivilgesellschaftliche Bündnisse der Motor für die Förderung von sozialer Gerechtigkeit und Frieden oder Nachhaltigkeit. Soziale Integration und gesellschaftlicher Zusammenhalt müssen insbesondere im Rahmen lokaler Kooperation von Politik und engagierten Bürger:innen gestärkt werden. Dies zeigt sich zum Beispiel im Kontext von Flucht und Migration, wo zivilgesellschaftliche Bündnisse in einigen Kommunen entscheidend zu gesellschaftlichem Frieden beigetragen haben. Der Effekt wird besonders deutlich, wenn Kommunen ohne entsprechende Bündnisse im Vergleich betrachtet werden. Der Umgang mit Migration ist demnach nicht nur durch breite gesellschaftspolitische Debatten geprägt, sondern entscheidet sich auch vor Ort – abhängig davon, welche Räume der Begegnung geschaffen werden.
- Faktenbasierter öffentlicher Diskurs
Die Verbreitung von Desinformation und Verschwörungsmythen sowie Hassreden – insbesondere durch die Instrumentalisierung von Ängsten im Zusammenhang mit Krisen und Kriegen – befördert gesellschaftliche Spaltungsprozesse. Die sehr spezifische Art und Weise, wie ein verfestigter Verschwörungsglaube den Blick auf die Welt wandelt, kann schließlich dazu führen, dass Menschen nicht nur im Hinblick auf sich selbst, sondern auch in Bezug auf die Gesellschaft zunehmend zum Risikofaktor werden. Derartige Überzeugungen wirken nicht nur als äußerst effektive Radikalisierungsbeschleuniger, sondern werden teilweise von einzelnen politischen Akteur:innen sogar gezielt zu diesem Zweck ausgenutzt. Menschen, die schon tief in verschwörungsideologisch geprägte Denkmuster eingetaucht sind, sind kaum durch Faktenchecks in den demokratischen Diskurs zurückzuholen. Gerade bei dieser Thematik gilt: Prävention ist nachhaltiger und wirkungsvoller als spätere Intervention.
- Ausgewogene Kriminalitätsberichterstattung
Die mediale Berichterstattung ist nicht nur beim Entgegenwirken von Desinformation und Verschwörungsglauben bedeutend, sondern auch in ihrer Thematisierung von kriminalitätsbezogenen Inhalten wirkmächtig. Kriminalität und das Sicherheitsgefühl wirken teilweise auch als Gradmesser, wie gut die Funktionsfähigkeit von Staat und Gesellschaft bewertet wird. Wie Menschen über Kriminalität denken, ist maßgeblich durch ihren Medienkonsum beeinflusst. Insofern ist es gravierend, wenn Kriminalität massiv verzerrt dargestellt wird. Eine unausgewogene Berichterstattung schürt Angst, Misstrauen und Vorurteile. Neben einer Überbewertung des Ausmaßes von schweren Gewaltstraftaten, kommen vor allem junge (Kinder, Jugendliche und Heranwachsende) sowie migrantisierte tatverdächtige Personen übermäßig in das Blickfeld journalistischer Berichterstattung. Dies hat einerseits Auswirkungen auf die genannten Personengruppen, andererseits werden andere Kriminalitätsphänomene gleichzeitig ausgeblendet. Medien tragen zum gesellschaftlichen Frieden bei, wenn sie sich ihrer Verantwortung bewusst sind und differenziert, sachlich sowie im Einklang mit den ethischen Standards für den Journalismus berichten. Sie schützen Persönlichkeitsrechte und vermeiden Stereotype.
- Abwehr von Vorurteilskriminalität
Seit Jahren nehmen vorurteilsmotivierte Straftaten, auch Hasskriminalität genannt, in Deutschland zu. Diese Straftaten richten sich gegen Opfer aufgrund von identitätsstiftenden Merkmalen wie Hautfarbe, Glaube, Herkunft oder sexuelle Identität. Sie wirken sich nicht nur auf die direkten Betroffenen aus, sondern senden eine „Botschaft“ an alle, die zu der entsprechenden sozialen Gruppe gehören. Insbesondere Jugendliche sind mit zunehmender Bedeutung sozialer Medien erheblichen Gefahren durch Hatespeech ausgesetzt, wobei es sich – anders als die deutsche Übersetzung „Hassrede“ vermuten lässt – nicht nur um verbale Ausdrucksformen handelt. Vorurteilskriminalität schürt aber nicht nur Angst und Verunsicherung, sondern begünstigt auch weitere Übergriffe und fordert andere Täter:innen zu ähnlichen Taten auf. So wird sie zu einer ernstzunehmenden Bedrohung für den gesellschaftlichen Frieden.
- Diskriminierungssensible Strafverfolgung
Eine diskriminierungssensible Strafverfolgung bedeutet, dass Polizei, Staatsanwaltschaft und Justiz aktiv auf die Gleichbehandlung aller Menschen achten und eventuell vorhandener, struktureller Diskriminierung – sei sie beabsichtigt oder unbeabsichtigt – entgegenwirken. Sie erfordert ein Bewusstsein für gesellschaftliche Machtverhältnisse, interkulturelle Kompetenz, faire Verfahren und den besonderen Schutz marginalisierter Gruppen. Das Vertrauen in den Rechtsstaat hängt u. a. maßgeblich davon ab, dass alle Menschen das Gefühl haben, gerecht behandelt zu werden. Eine Strafverfolgung, die Diskriminierung nicht ernst nimmt oder selbst reproduziert, verliert an Legitimität. Gesellschaftliche Ungleichheit zeigt sich jedoch auch im Prozess der Strafverfolgung. Von Armut oder anderen Benachteiligungen betroffene Personen werden häufiger mit staatlicher Strafverfolgung konfrontiert. Soziale Ungleichheitsstrukturen können sich sowohl im Bereich der Kriminalisierung spezifischer Handlungen, in der Kontrolltätigkeit der Polizei oder bei justiziellen Verfahren wiederfinden, weshalb bestimmte Menschen hiervon stärker betroffen sind. Die Verurteilungen von Menschen, die in Armut leben, ist unter anderem auch deshalb erhöht, da sie über weniger Beschwerdemacht verfügen und seltener einen anwaltlichen Beistand hinzuziehen (können). Dies ist nur ein Aspekt struktureller Ungleichheit, der den gesellschaftlichen Frieden negativ beeinflusst. Im Kontext gesellschaftlichen Friedens zeigt sich die Präventionslandschaft als vielschichtiges Gefüge, das weit über einzelne Maßnahmen hinausreicht. Sie umfasst die bewusste Sensibilisierung und aktive Einbindung der Zivilgesellschaft, staatlicher Institutionen sowie Medienschaffender. Gleichzeitig erfordert wirksame Prävention eine nachhaltige finanzielle Förderung vielfältiger Programme und Initiativen – bis hin zu über bloße Symbolpolitik hinausgehenden, strukturellen Anpassungen, auch durch gesetzgeberische Veränderungen.
Augsburg, am 23. Juni 2025
Zur Augsburger Erklärung
|
|