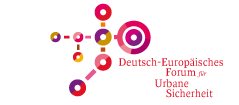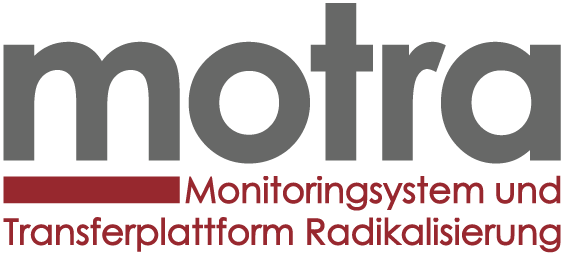ZARA informiert im #GegenHassimNetz-Bericht alljährlich über die Meldungen von Online Hass und Hetze sowie Cyber-Mobbing und Cyber-Stalking. Der Bericht gibt anhand von Datenanalysen Einblicke in die aktuellen Entwicklungen des Phänomens Hass im Netz sowie Empfehlungen für die Gesellschaft, politische Verantwortungsträger*innen und Plattformen.
Gemeinnützige Stiftung zur Stärkung der demokratischen Zivilgesellschaft gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus
Vor dem Hintergrund dieser angespannten Lage in Deutschland und weltweit veröffentlicht der Bundesverband RIAS den vorliegenden Monitoringbericht.
Der Sammelband beleuchtet die Rolle und Wirkungsmacht des Antisemitismus in der Jugendsozialisation und nimmt dabei verschiedene jugendkulturelle Kontexte in den Blick. Zudem werden Potenziale von Bildungsprogrammen gegen Antisemitismus diskutiert.
Der Sammelband beleuchtet die Rolle und Wirkungsmacht des Antisemitismus in der Jugendsozialisation und nimmt dabei verschiedene jugendkulturelle Kontexte in den Blick. Zudem werden Potenziale von Bildungsprogrammen gegen Antisemitismus diskutiert.
In dem "Baustein" des Projekts "Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage" zum Thema "Antisemitismus und Migration" befasst sich Dr. Michael Kiefer in seinen Ausführungen neben den Begriffsbestimmungen mit dem Verhältnis von Antisemitismus zum Islam sowie mit der Einstellung junger Muslime. Die Publikation bietet zudem Unterstützung für die pädagogische Diskussion.
Die Handreichung basiert auf den gekürzten und redaktionell bearbeiteten Beiträgen und Diskussionen des gleichnamigen Fachtags. Die Handreichung bietet einen kompakten sowie fachlich fundierten Einstieg in das komplexe Phänomen des Antisemitismus. Nach einem Vortrag von Prof. Dr. Samuel Salzborn über Antisemitismus in der Schule schließen sich drei aufeinanderfolgende Gesprächsrunden an.
Der Nahostkonflikt ist auch in Schulen ein wiederkehrendes Thema. Dabei geht es nicht nur um den Konflikt an sich und die Ereignisse vor Ort, sondern auch um Geschichte und Gegenwart in Deutschland. Die Arbeitshilfe soll Lehrkräfte unterstützen, den Nahostkonflikt im Unterricht und Schulalltag zu behandeln.
Das Demokratiezentrum Hessen an der Philipps-Universität Marburg berät hessenweit kostenlos, vertraulich sowie präventiv in Fällen von Rechtsextremismus, Antisemitismus, Rassismus oder Salafismus.
Im neuen Videopodcast Blindcast tauschen sich zwei Menschen aus, die sich vorher noch nie gesehen haben. In der ersten Folge treffen sich der deutsch-palästinensische Comedian und Aktivist Abdul Kader Chahin und die Aktivistin, Publizistin und Präsidentin der jüdischen Studierendenunion Deutschland Hanna Veiler . Sie sprechen über den Nahostkonflikt.
Verschwörungstheorien sind in aller Munde. Deshalb gibt diese Broschüre einen kompakten und einführenden Überblick, beleuchtet das Thema von unterschiedlichen Seiten und bereitet es für eine Auseinandersetzung von Jugendlichen damit auf.
Russland führt einen hybriden Krieg. Eine Propagandamaschine bringt auch in Deutschland Falschmeldungen und Verschwörungserzählungen in Umlauf. Die Amadeo Antonio Stiftung analysiert die demokratiefeindlichen Narrative sowohl aus dem russischsprachigen als auch aus dem deutschsprachigen Kontext und untersucht ihre Verbreitung in ihrer neuen Publikation “Eine Waffe im Informationskrieg”.
Seit dem Angriff der Hamas am 7. Oktober gehen Menschen weltweit auf die Straße gegen Israel. Ein Jahr später ist die Bilanz alarmierend: Die Proteste haben sich immer weiter radikalisiert, auch in Deutschland. Inzwischen gehören für viele Demonstrant:innen Terrorverherrlichung und Pressefeindlichkeit zum politischen Konsens.
Der Report „Holocaust als Meme“ der Bildungsstätte Anne Frank untersucht geschichtsrevisionistische Inhalte in sozialen Medien und Gaming. Er zeigt, wie KI-generierte Bilder und alternative historische Erzählungen subtil normalisiert werden, und macht wiederkehrende Muster sichtbar, um sie kritisch einordnen und erkennen zu können.
Seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 spielen soziale Netzwerke eine bedeutende und vielfach unterschätzte Rolle bei der Verbreitung von Terrorpropaganda, Falschinformationen, Israelhass, Antisemitismus und Verschwörungsnarrativen. Die Autorinnen haben die Entwicklungen auf Social Media in den ersten drei Monaten nach dem Angriff beobachtet.
Publikation der Arbeits- und Forschungsstelle Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit des Deutschen Jugendinstituts (DJI)
Angesichts der besorgniserregenden Zunahme von Antisemitismus in Europa und auch außerhalb Europas ist in der Strategie eine Reihe von Maßnahmen vorgesehen, die sich auf drei Schwerpunkte konzentrieren: Verhütung aller Formen von Antisemitismus, Schutz und Förderung jüdischen Lebens sowie Förderung von Forschung, Aufklärung und Gedenken an den Holocaust.
Gefördert werden Initiativen und Projekte, die sich aktiv mit den Themen Rechtsextremismus, Rechtspopulismus, Rassismus und Antisemitismus beschäftigen.
Antisemitismus, Rassismus und andere Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit sind nicht nur ein Problem für die Betroffenen, für deren Sicherheitsempfinden oder Zugehörigkeitsgefühl, sie gefährden den gesellschaftlichen Zusammenhalt insgesamt.
Die Bildungsinitiative der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland e.V. setzt sich unter anderem für die Vermittlung von Informationen über die jüdische Geschichte, die Präventionsarbeit antisemitischer und fremdenfeindlicher Tendenzen sowie die Ermutigung zur Zivilcourage ein.
Die EU-Kommission und die Internationale Allianz zum Holocaustgedenken unterstützen die Mitgliedstaaten mit einer praktischen Handreichung beim Kampf gegen Antisemitismus. Das Handbuch zur Arbeitsdefinition für Antisemitismus gibt einen Überblick über bewährte Praktiken von internationalen Organisationen, nationalen Verwaltungen, der Zivilgesellschaft und jüdischen Gemeinden aus ganz Europa.
Negative wie positive Vorurteile führen meist zu Diskriminierung, zu Ausgrenzung, zu Gewalt. Die Handreichung bietet daher interessierten Multiplikator:innen inhaltliche Hintergrundinformationen und konkrete Anleitungen zur Durchführung einer themenbezogenen Lernwerkstatt.
Antisemitismus ist Teil des Alltags an vielen Schulen. Die Bandbreite reicht von Andeutungen, Zuschreibungen, Beleidigungen, Übergriffen bis zu strukturellen Ausschlüssen. Neue Studien geben darüber Aufschluss, wie er in institutionellen Systemen tradiert und aufrechterhalten wird.
Vorstellungen eines spezifisch "muslimischen Antisemitismus" bergen die Gefahr einer ungerechtfertigten Pauschalverdächtigung. Sowohl Antisemitismus als auch antimuslimischer Rassismus müssen ernst genommen werden, egal von wem sie ausgehen. Dieser Beitrag versucht, dem "importierten Antisemitismus" auf den Grund zu gehen und Rassismen zu kontextualisieren und zu verstehen.
Wie hat sich die extreme Rechte 2024 entwickelt? Welche Verbindungen hat die AfD zu anderen extrem rechten Gruppen? Vor welchen Herausforderungen stand die demokratische Zivilgesellschaft? Und was hat sie unternommen, um Rechtsextremismus die Stirn zu bieten?
Im neuen Video von kiez:story sprechen die jugendlichen Expertinnen wie sich der 7. Oktober auf ihr Leben ausgewirkt hat. Was haben sie als jüdische, palästinensische oder einfach interessierte Menschen in der Schule erlebt? Wo finden sich Gemeinsamkeiten, auch wenn die Positionierungen unterschiedlich sind? Und was wünschen sie sich von Gesellschaft und Politik?
Der essayistische Kurzdokumentarfilm "Zwischenräume" zeigt in kurzen Episoden, wie in Deutschland heute mit der NS-Vergangenheit umgegangen wird.Ein Jahr lang beobachteten die Filmemacher das Geschehen am Holocaustmahnmal in Berlin. Sie haben dort mit vielen Menschen gesprochen und sind auf einen Mikrokosmos gestoßen, der viele Themen und Konflikte der gegenwärtigen Erinnerungskultur in sich trägt
Die Ligante#7 zeigt, dass die Anschläge der Hamas vom 7. Oktober 2023 sowie der aktuelle Krieg in Gaza und Israel nicht nur geopolitische, sondern auch tiefgreifende gesellschaftliche Auswirkungen in Deutschland haben. Die Autor*innen untersuchen Antisemitismus und (antimuslimischen) Rassismus sowie die Instrumentalisierungen der Geschehnisse durch extremistische Gruppen.
Handreichung zu Konzepten, Instrumenten und Ansätzen der antisemitismus- und rassismuskritischen Jugendarbeit. Auch wenn es Erfolge
gibt in Sachen Bewusstsein für eine diskriminierungskritische Perspektive in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, zeigen viele Vorfälle in den letzten Monaten, dass antisemitische Äußerungen und Verhaltensweisen unter Jugendlichen leider sehr verbreitet
sind.
Seit dem Beginn der Corona-Pandemie ist der Glaube an Verschwörungserzählungen in Deutschland sichtbarer und radikaler geworden. Cultures interactive in den letzten drei Jahren vielfältige Workshops, Fortbildungen und Fachberatungen zum Umgang mit Verschwörungserzählungen angeboten.Nun stellt diese Broschüre 15 erprobte Methoden für die politische Bildungsarbeit vor und erklärt.
Die Publikation gibt einen Überblick über die Ursprünge und aktuelle Erscheinungsformen rechter Esoterik sowie über Wege der Prävention und des Umgangs.
Hast Du das Zeug zum zivilen Helden? Erlebe die interaktiven Videos rund um Antisemitismus, Gewalt, Hass im Netz, Radikalisierung und Verschwörungsmythen bestimme selbst den Ausgang der Geschichten!
In der Podcastreihe „Zeitdiagnosen zu Antisemitismus und Rechtsextremismus“ wird gemeinsam mit verschiedenen Expert_innen aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft aktuelle Entwicklungen im Feld von Rechtsextremismus und Antisemitismus auch in Sachsen-Anhalt analysiert. Dabei wird sowohl auf die einzelnen Akteur_innen, Gruppen und ihre Verbindungen sowie die zugrunde liegenden Ideologien eingegangen.
Der Podcast analysiert gemeinsam mit verschiedenen Expert_innen aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft aktuelle Entwicklungen im Feld von Rechtsextremismus und Antisemitismus. Er geht dabei sowohl auf die einzelnen Akteur_innen, Gruppen und ihre Verbindungen sowie die zugrunde liegenden Ideologien ein. Außerdem bespricht er zukünftige Perspektiven und Handlungsoptionen.
Schulen sind in Deutschland ebenso mehrheitlich nicht-jüdisch geprägt wie Kitas und Universitäten. Für jüdische Kinder, Schüler*innen und Student*innen bedeutet dies ebenso wie für jüdische Lehrkräfte, dass sie sich in Strukturen bewegen (müssen), in denen sie oftmals nicht mitgedacht werden, in denen Bedarfe nicht berücksichtigt werden oder ihre Berücksichtigung mühsam erstritten werden muss.
politischbilden.de hat das Modul „Antisemitismus – Erkennen und Bekämpfen“ veröffentlicht. Dieses Modul bietet Methoden und Ansätze zur antisemitismuskritischen politischen Bildung und unterstützt Bildner*innen und Lernende dabei, Antisemitismus in all seinen Formen zu verstehen, zu demaskieren und zu bekämpfen.
Der Verein Bürger Europas e.V. bietet ein interaktives kostenfreies Bildungsformat für Schulen ab der 8. Klasse. Die Schülerinnen und Schüler sind dabei eingeladen, in einem Online-Quizduell gemeinsam mit anderen Klassen bundesweit ihr Wissen über Migration, Integration, Antirassismus, Rechtsradikalismus, jüdisches Leben in Deutschland und Antisemitismus zu testen und zu erweitern.
Die Opferberatungsstellen im VBRG haben ihre Bilanzen zum Ausmaß rechter, rassistischer und antisemitisch motivierter Gewalt im Jahr 2021 veröffentlicht. In neun von 16 Bundesländern wurden insgesamt 1391 rechte, rassistisch und antisemitisch motivierte Angriffe registriert. Fünf Menschen starben durch rechte Tötungsdelikte von Anhängern der Coronaleugnerbewegung.
Die Opferberatungsstellen im VBRG haben ihre Bilanzen zum Ausmaß rechter, rassistischer und antisemitisch motivierter Gewalt im Jahr 2023 veröffentlicht. In elf von 16 Bundesländern wurden insgesamt 2.589 rechte, rassistisch und antisemitisch motivierte Angriffe registriert. Mehr als die Hälfte aller Angriffe ist rassistisch motiviert.
Sport ist für die extreme Rechte hoch relevant. Dieser Beitrag bietet einen Überblick über ihre sportlichen Aktivitäten und leitet daraus eine Gefahrenprognose ab.
Seit zehn Jahren geben Social-Media-Unternehmen an, Hassrede regulieren zu wollen und entsprechende Moderationsvorgaben umzusetzen. Beim Thema Antisemitismus führt das leider zu keiner Besserung der Situation: Jede erdenkliche Form von Antisemitismus findet sich ohne große Mühe auf allen Sozialen Netzwerken. Das zeigt eindrücklich ein neuer, europäischer Report.
Mit dem neuen E-Book stellt die Bildungsstätte Anne Frank ein erstes Zwischenergebnis ihrer Arbeit vor. Sie informieren über das Problemfeld Antisemitismus und Hassrede auf TikTok, liefern Hintergrundwissen, analysieren die unterschiedlichen Erscheinungsformen und diskutieren verschiedene Möglichkeiten, aktiv zu werden.
Gemeinsames Podcast Projekt des Kompetenzzentrum für antisemitismuskritische Bildung und Forschung und Each One Teach One e.V. (EOTO e.V.). Mit dem Podcast wollen die Aotor*innen die Debatte um Antisemitismus und Anti-Schwarzen-Rassismus voranbringen und zu einer tragfähigen Sprech- und Diskurskultur zwischen jüdischen und afro-diasporischen Communities beitragen.
Die aktuelle Ausgabe dokumentiert besorgniserregende Entwicklungen im Freistaat: Rechte Gewalt erreicht ein Rekordhoch, Antisemitismus und Queerfeindlichkeit nehmen spürbar zu. Vermehrt treten gewaltbereite junge Neonazis in Erscheinung. Die flächendeckenden Wahlerfolge der AfD im Superwahljahr 2024 verdeutlichen die akute Bedrohung der demokratischen Kultur in Thüringen.
Antisemitismus verbreitet sich auf der Videoplattform TikTok wie ein Lauffeuer. Um ein Gegengewicht zu schaffen, hat die Bildungsstätte Anne Frank aus Frankfurt mit reichweitenstarken Creator*innen im November 2022 die Aufklärungskampagne #GemeinsamgegenAntisemitismus auf TikTok gestartet.
Die interaktive Handreichung soll Lehrkräfte, Pädagog*innen und Fachkräfte im Bildungsbereich unterstützen, Antisemitismus und antimuslimischen Rassismus im Schulalltag einzudämmen.
Warum bekommen Verschwörungserzählungen gerade jetzt so viel Zulauf? Was hat das mit Antisemitismus zu tun? Und was kann ich dagegen tun? Um diese und weitere Fragen geht es in dem von jungen Erwachsenen während ihres Freiwilligendienstes in Schleswig-Holstein produzierten Video »Vom Kuchenrezept zur Verschwörungserzählung«.
Die Studie untersucht die Bedeutung der Polizei für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und für den Schutz von jüdischem Leben. Angesichts einer zunehmenden Normalisierung und Radikalisierung des Antisemitismus ist eine Sensibilisierung und Professionalisierung der Polizeikräfte von hoher Bedeutung.
Die deutsche Erinnerungspolitik muss sich aktuell fragen lassen: Was bedeutet „Nie wieder!“ im 21. Jahrhundert? Die rassistischen Attentate von Halle und Hanau lassen eine ideologische Nähe von antisemitischen und islamfeindlichen Tätern erkennen. Dr. Sonja Hegasy fragt in ihrem Beitrag: Sind wir Deutschen heute in der Lage, die Entmenschlichung unserer Nachbarn rechtzeitig zu erkennen?
Eine Einordnung der Mythen und Streitpunkte des Israel-Palästina-Konflikts:
Seit dem Massaker der Hamas in Israel am 7. Oktober 2023 und dem Beginn des israelischen Krieges in Gaza ist das komplexe Geschehen des Israel-Palästina-Konflikts, das zusammenfassend meist als „Nahostkonflikt“ bezeichnet wird, erneut Gegenstand vieler privater und öffentlicher Gespräche in aller Welt.
Vier von fünf jungen Jüdinnen und Juden in Europa sagen, dass der Antisemitismus in den vergangenen fünf Jahren zugenommen habe. 45 Prozent von ihnen tragen in der Öffentlichkeit keine erkennbaren jüdischen Symbole, da sie um ihre Sicherheit besorgt sind. Das ist das Ergebnis einer Studie der EU-Agentur für Grundrechte.
Die Beiträge des vorliegenden Sammelbandes geben auf Basis neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse einen Überblick über die derzeit drängendsten Fragen im Umgang mit Antisemitismus: Führende Expert*innen der Antisemitismusforschung zeigen in theoretischen und historischen Beiträgen die zentralen Verbreitungsfelder antisemitischer Denkmuster auf.
Wie kann man über den 7. Oktober und seine Folgen mit Schülerinnen und Schülern ins Gespräch kommen? Wie kann man im schulischen Kontext den Emotionen und den Fragen junger Menschen gerecht werden? Jouanna Hassoun und Shai Hoffmann sind nach dem 7. Oktober mit ihrem Konzept der „Trialoge“ an Schulen unterwegs.