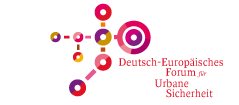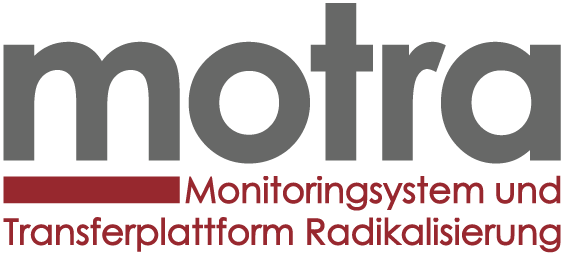Aktuelles
Hier finden Sie aktuelle Information, neue Publikationen und Hinweise zu Integrations- und Migrationsthemen sowie zur Prävention von Vorurteilen, Diskriminierung und Rassismus.
Atlas Wahrheit und Wissen im digitalen Wandel | Schwerpunkt "Desinformation und KI"
Das Atlas-Format: Wahrheit und Wissen im digitalen Wandel bündelt aktuelles Wissen rund um zentrale Fragestellungen zu Desinformation und Künstlicher Intelligenz. In der ersten Ausgabe, die vom Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft (IDZ) gemeinsam mit der Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur (GMK) im Rahmen des toneshift-Netzwerks entwickelt wurde, werden Forschungsergebnisse aus interdisziplinärer Perspektive verständlich aufbereitet.
Völkische Landnahme – Theorie und Empirie: Ein Annäherungsversuch an ein unterbeforschtes Phänomen
er Beitrag untersucht das zunehmende Auftreten völkischer Siedler:innen im ländlichen Raum. Fernab urbaner Zentren bauen sie Gemeinschaften auf, die ihrem rassistischen Weltbild entsprechen, und inszenieren sich zunächst als ökologische Landwirt:innen, Kunsthandwerker:innen oder engagierte Mitglieder der Dorfgemeinschaft. Auf dieser Basis beginnen sie, ihre politischen Überzeugungen schrittweise zu verbreiten.
Besonders der Naturschutz fungiert dabei als ideologischer Brückenbauer. Während Umwelt- und Klimaschutz gesellschaftlich breit verankert sind, dienen sie in der extrem rechten Ideologie der Sicherung einer vermeintlich homogenen „Volksgemeinschaft“ und ihres „Lebensraums“. Vielfalt, Gleichberechtigung und Offenheit werden dabei systematisch ausgeblendet. Der Text erscheint als Working Paper im Forum Demokratieforschung und ordnet die beschriebenen Entwicklungen kritisch in aktuelle demokratietheoretische Debatten ein.
Völkische Landnahme – Theorie und Empirie: Ein Annäherungsversuch an ein unterbeforschtes Phänomen
er Beitrag untersucht das zunehmende Auftreten völkischer Siedler:innen im ländlichen Raum. Fernab urbaner Zentren bauen sie Gemeinschaften auf, die ihrem rassistischen Weltbild entsprechen, und inszenieren sich zunächst als ökologische Landwirt:innen, Kunsthandwerker:innen oder engagierte Mitglieder der Dorfgemeinschaft. Auf dieser Basis beginnen sie, ihre politischen Überzeugungen schrittweise zu verbreiten.
Besonders der Naturschutz fungiert dabei als ideologischer Brückenbauer. Während Umwelt- und Klimaschutz gesellschaftlich breit verankert sind, dienen sie in der extrem rechten Ideologie der Sicherung einer vermeintlich homogenen „Volksgemeinschaft“ und ihres „Lebensraums“. Vielfalt, Gleichberechtigung und Offenheit werden dabei systematisch ausgeblendet. Der Text erscheint als Working Paper im Forum Demokratieforschung und ordnet die beschriebenen Entwicklungen kritisch in aktuelle demokratietheoretische Debatten ein.
Rechtspopulistische Erosionsstrategien und ihre medienpädagogischen Implikationen
Die Rezension von Christian Filk setzt sich mit Peter R. Neumanns und Richard C. Schneiders Das Sterben der Demokratie (2025) auseinander und beleuchtet insbesondere die medienpädagogischen Implikationen des Buches. Die Autoren analysieren die schleichende Erosion liberaler Demokratien durch rechtspopulistische Akteure in sechs Ländern und beschreiben einen dreistufigen Prozess aus Polarisierung, Schwächung demokratischer Kontrollinstanzen und politischem Rechtsruck.
International Psychosocial Organisation (IPSO)
Die International Psychosocial Organisation (IPSO) ist eine humanitäre Organisation mit Sitz in Berlin, die psychosoziale, muttersprachliche Beratung für Geflüchtete und Menschen mit Migrationsgeschichte anbietet und dafür auch digitale Angebote wie die saba-App entwickelt.
saba app - Your Digital Support in the Area of Mental Health
Die saba app bietet kostenfreie, vertrauliche psychosoziale Unterstützung für Menschen mit Flucht- oder Migrationsgeschichte. Über die App können Nutzer in ihrer Muttersprache mit geschulten Berater schreiben und Unterstützung bei belastenden Lebenssituationen, Stress oder traumatischen Erfahrungen erhalten. Der Zugang erfolgt über Partnerinstitutionen oder eine einfache Registrierung.
Vielfalt in Kinderbüchern. Workshop zu Kinderbüchern als Vielfaltsmedium und disrkiminierungssensiblen Strategien im Alltag
Kinderbücher prägen früh, wie Kinder Vielfalt, Zugehörigkeit und Unterschiede wahrnehmen. Der dreitägige Workshop „Vielfalt in Kinderbüchern“ setzt sich mit Kinderbüchern als Medium vorurteilsbewusster Bildung auseinander. Im Mittelpunkt stehen diskriminierungssensible Perspektiven, die Reflexion der eigenen Haltung sowie praxisnahe Strategien für den pädagogischen Alltag – mit Fokus auf Kinderbücher für die Altersgruppe 0–7 Jahre.
Qualifizierung: KONFLIKTE IM KOMMUNALEN KONTEXT – Dynamiken verstehen, Ressourcen nutzen, Handlungssicherheit gewinnen
Kommunen stehen vor vielfältigen sozialen und politischen Konflikten. Die Online-Qualifizierung „Konflikte im kommunalen Kontext“ vermittelt von Februar bis Juni 2026 Grundlagen und Methoden der demokratischen Konfliktbearbeitung. Die kostenfreie Qualifizierungsreihe richtet sich an Mitarbeitende aus Verwaltung, Zivilgesellschaft und Demokratieförderung und stärkt Analysefähigkeit, Handlungssicherheit und strategisches Vorgehen im Umgang mit kommunalen Konflikten.
Diskriminierungskritische Öffentlichkeitsarbeit
Wie kann Öffentlichkeitsarbeit inklusiv gestaltet werden, ohne stereotype oder ausgrenzende Bilder und Texte zu reproduzieren? Das Webseminar „Diskriminierungskritische Öffentlichkeitsarbeit“ vermittelt Grundlagen und praxisnahe Ansätze zu Sprache, Bildern sowie barrierefreien Websites und Dokumenten.
Demokratie braucht …
Am 19. Februar 2026 lädt das Bündnis NIEDERSACHSEN PACKT AN zur 10. Netzwerkkonferenz unter dem Motto „Demokratie braucht …“ nach Hannover ein. Die Konferenz bringt Engagierte aus Zivilgesellschaft, Politik, Verwaltung, Wissenschaft und Praxis zusammen, um über die Zukunft von Demokratie, Integration und gesellschaftlichem Zusammenhalt zu diskutieren. Im Rahmen von Foren, Workshops und einem Marktplatz der Ideen stehen Austausch, Vernetzung und praxisnahe Impulse im Mittelpunkt. Anmeldung bis 08.02.2026 (kostenfrei)