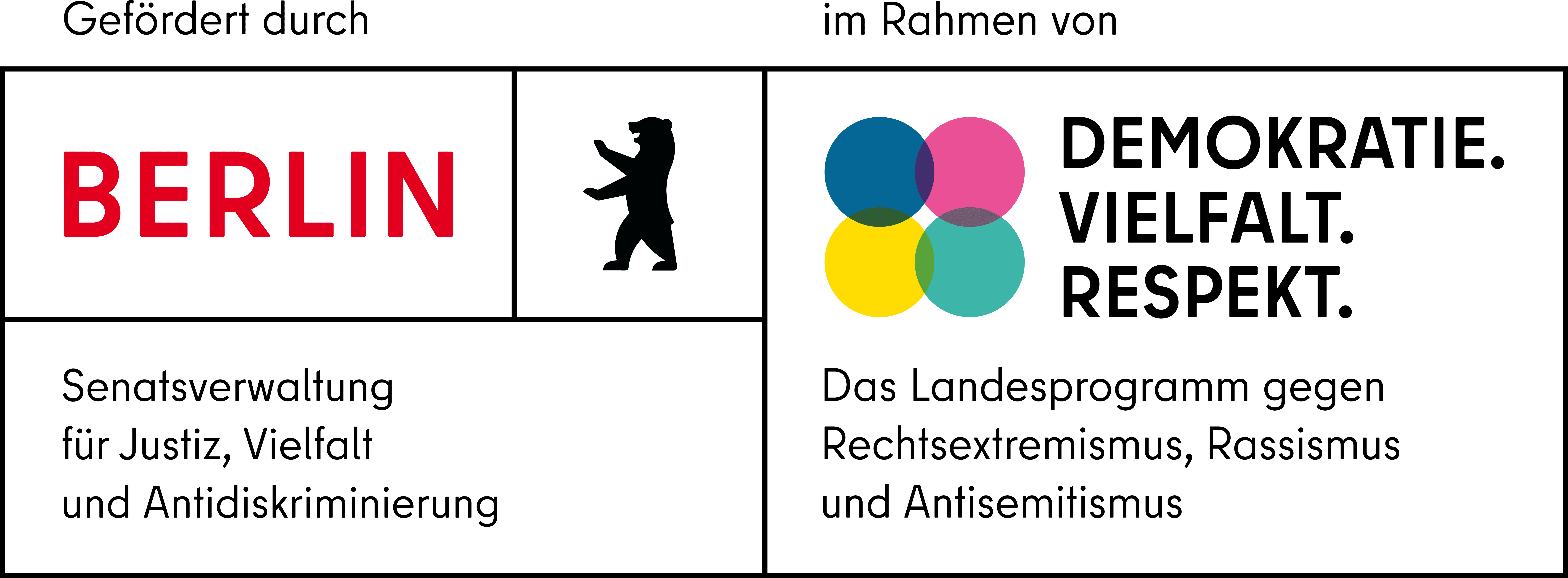Queer und muslimisch: Wie passt das zusammen? Medien zeichnen in der Regel das Bild eines patriarchalen, homophoben Islam, in dem Queer-Sein für Muslim*innen unmöglich erscheint. Der queer-muslimische Aktivist und Coach Ahmed beweist das Gegenteil und gibt uns einen anderen Blickwinkel auf das Thema. Er erzählt uns von den größten Herausforderungen auf seinem Weg, Glauben und Queer-Sein miteinander zu vereinbaren, vom jahrelangen Gefühl der Heimatlosigkeit und davon, was er sich von Lehrkräften gewünscht hätte.
Die Folgen erscheinen einmal im Monat und sind über den Audioplayer und auf Spotify hörbar.
Link zum Spotify-Kanal „Wovon träumst du eigentlich nachts?“
ufuq.de auf Instagram: @ufuq.de
Transkription der Folge
Maryam:
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge „Wovon träumst du eigentlich nachts?“. Mein Name ist Maryam (Jenny: Mein Name ist Jenny.) und heute sprechen wir über ein Thema, das für viele Menschen unvereinbar scheint: queer und muslimisch sein. Jenny und ich sind wirklich überhaupt keine Expertinnen bei diesem Thema und deswegen haben wir uns heute Verstärkung geholt und freuen uns, Ahmed, thehealingkhan, oder welche Alias du auch immer noch verwendest, bei uns begrüßen zu dürfen. Hast du Lust, unseren Zuhörer*innen mehr von dir zu erzählen?
Ahmed:
Deswegen bin ich ja hier, sehr gerne! Meine Identität ist immer ein bisschen schwierig… Ihr habt ja vorhin schon gesehen, dass ich ziemlich mit dieser Frage überfordert war. Ich bin Berliner, habe arabische Wurzeln; libanesische Mama, irakischer Papa. Ich kann jetzt die ganzen Labels wie „queer“ oder „Muslim“ auf den Tisch legen. Ich mache Life Coaching, fokussiere mich dabei auf Limiting Beliefs und Innere-Kind-Arbeit und bin unter anderem auch für ufuq.de tätig und mache dort diese wundervollen Workshops zu Antidiskriminierung, Antirassismus etc.
Jenny:
Jetzt hast du schon einige Facetten genannt, die du vereinst. Wie Maryam gerade schon gesagt hat, erscheint das vielleicht für manche als unvereinbar oder ungewöhnlich. Wir würden gerne mit dir darüber sprechen, welche verschiedenen Facetten du vereinst? Und vielleicht können wir auch damit starten: Was bedeutet denn für dich eigentlich muslimisch sein?
Ahmed:
Ja, es sind ganz viele dieser Identitäten und Labels, die alle mit ihren Challenges und Stories kommen und ihren eigenen Bubbles (Filterblasen, Anm. d. Red.) und Communities, in denen man sich dann bewegt und in denen es verschiedene Standards und Normen gibt. Wenn man ein junger Mensch ist und eine „Puzzle-Identität“ hat, wo man nirgends komplett reinpasst, ist das super anstrengend, weil es kein richtig und falsch gibt und keine Gussform, in die man passt. Aber später dann umso besser. Ich sehe das mittlerweile als Privileg, weil ich diese Strukturen, diese Normen, diese Communities, Bubbles und ihre Konditionierung so bewusst wahrnehme und gar nicht komplett in eine Gussform reinpassen kann, in die mich die Gesellschaft drücken möchte und mich selbst komplett definieren kann. Muslimisch sein heißt ganz klassisch: Wenn ich das Glaubensbekenntnis „es gibt einen Gott und Mohammed ist sein Prophet“ ausspreche und daran glaube, dann bin ich der Definition nach Muslim und das war’s dann. Für die Community reicht das aber natürlich nicht immer. Dann sind es vielleicht noch die Fünf Säulen, die ich befolge: Ich bete, faste etc.
Ich war jetzt einen Monat in Libanon und da bin ich allein wegen meines Namens schon Moslem. Man hat dort diese ganzen verschiedenen Strömungen, man hat die Communities. Menschen heiraten auch nur unter sich. Das heißt, es wird ein bestimmter Phänotyp, ein bestimmtes Aussehen, dieser Religionszugehörigkeit zugeordnet. Menschen lesen mich als Moslem oder sogar als Schiiten nur basierend darauf, wie ich aussehe. Ich habe dieses Auge nicht. Ich bin da nicht so trainiert, diese kleinen Merkmale zu deuten, weil ich hier in Berlin aufgewachsen bin. Aber ich war super verwundert und oft schockiert, wie tief und alltäglich diese Unterscheidungen in Libanon Realität waren. Je nach Kontext sieht Muslimisch-Sein anders aus und bedeutet etwas anderes. Ich selbst definiere mich als Muslim. Ich hatte ganz lange, auch im eigenen queeren Self-Empowerment auf meinem Weg, Probleme mit der Religion oder der Institution, den muslimischen Communities, aber ich habe einfach für mich definiert: Ich bin ein sehr spiritueller Mensch und meine Basis ist der Islam. Kulturell bin ich auf vielen verschiedenen Ebenen muslimisch konditioniert und geprägt worden und bewege mich in diesem Raum, also fühle ich mich mit der Selbstbezeichnung „Muslim“ total wohl. Aber ich glaube, das muss jede*r Muslim*in und jeder spirituelle Mensch für sich selbst definieren und schauen, ob er*sie sich so bezeichnen möchte.
Maryam:
Ja, ich glaube, dass das natürlich immer so die schöne Vorstellung ist, dass das jeder Mensch für sich selbst entscheidet. Da gibt es auch viele Meinungen, die da gerne ein Wörtchen mitsprechen würden, wer sich wie bezeichnen darf. Das ist nicht nur beim Muslimisch-Sein so, sondern auch im Bereich Queer-Sein, und damit kommen wir direkt zur nächsten Frage: Was bedeutet denn Queer-Sein für dich?
Jenny:
Bevor du das beantwortest, sollten wir vielleicht nochmal klären, was Queer-Sein überhaupt ist. Vielleicht kannst du darauf noch mal kurz eingehen?
Ahmed:
Ursprünglich wurde der Begriff „queer“ als Beleidigung für Menschen benutzt , die eine andere Sexualität oder Genderzugehörigkeit hatten und dementsprechend nicht in diese Heteronorm gepasst haben. Der Begriff wurde dann irgendwann von den Communities wieder aufgegriffen und reclaimed (zurückgefordert und sich angeeignet, Anm. d. Red.) und als Self-Empowerment benutzt. Heutzutage ist es ein Überbegriff für ganz viele andere Identitäten, die sich darin finden können. Ich fühle mich mit dem Begriff total wohl, weil er mir eine Identität gibt, die ich der Gesellschaft vorlegen kann wie: „Ich passe nicht in diese Gussschale von Heteronorm, ich bin dementsprechend anders.“ Es war früher negativ konnotiert: dieses Queer-Sein, das Anderssein. Aber wir haben es als Community gewendet und gesagt: „Wir sind positiv anders.“ Und das ist für mich manchmal genau das, was ich damit ausdrücke: Ich bin positiv anders und was es genau bedeutet, das definiere ich für mich. Ich habe oft gesagt, ich sei bisexuell, aber manchmal frage ich mich auch: Ist es überhaupt an diese zwei Geschlechterrollen der Gesellschaft, an diese Binarität, gebunden? Oder ist es für mich einfach nur so, dass es an dem Mensch liegt und ich mich von dem Menschen angezogen fühle? Dann würde man es ja pansexuell nennen. Ich habe diese zwei Probleme: Ich möchte der Gesellschaft nicht immer eine feste Zuschreibung geben und Queer-Sein erlaubt mir, mich hinter einem Begriff zu finden. Also ich habe eine Antwort, die sind damit zufrieden und dahinter kann ich mich immer noch bewegen und finden. Gleichzeitig habe ich oft ein Problem mit diesem „sexuell“ in diesen Begriffen, weil dann Hauptbestandteil meiner Identität meine Sexualität ist. Das ist irgendwie komisch. Vielleicht liegt es auch an meinem Upbringing (Erziehung, Anm. d. Red.) oder an der muslimischen Seite. Nicht, dass der Islam – das ist jetzt eine andere Diskussion – ein Problem mit Sexualität hätte. Er ist eigentlich eine sehr sexpositive Religion, aber halt historisch und kulturell vom Kolonialismus geprägt, aber das sind andere Themen. Man hört ganz oft diese Tabus, wenn es um Sexualität in muslimischen Communities geht. Vielleicht fällt es mir wegen meinem Upbringing schwer zu sagen, dass ich irgendwas-„sexuell“ bin, das in der Mehrheitsgesellschaft so rauszuschreien. Was ich romantisch finde oder im Bett mache, das ist irgendwie mein Ding! Ich will nicht jedem*r sagen, wer die Personengruppe ist, mit der ich schlafe. Das sage ich jetzt auch in jedem Meeting. Deswegen ist für mich das Queer-Sein als Grundeinstellung der Gesellschaft und dem Leben gegenüber viel wichtiger und passender.
Jenny:
Ich finde es interessant, wie du sagst, dass es einfach kein Identitätsmerkmal ist, mit dem man sich so hauptsächlich identifizieren will. Heterosexuelle Menschen müssen sich z.B., wie du sagst, in einem Meeting ja auch nicht so vorstellen. Dementsprechend wirkt es eben nicht wie eine Identität, die man so vor sich herträgt. Wir haben ja schon gesagt, dass so etwas wie Muslimisch-und Queer-Sein in den Augen vieler in der Gesellschaft, auch medial vermittelt, oft als unvereinbar scheint. Was sind denn deine Erfahrungen? Wie reagieren Menschen, wenn sie erfahren, dass du dich als gläubigen Muslim, aber auch als queer bezeichnest?
Ahmed:
Was ich total interessant finde, ist, dass ich, seitdem ich öffentlich damit lebe und auch sehr schnell in den verschiedenen Communities darüber spreche, sehr wenig Contra-Stimmen dazu bekomme oder Diskriminierung erfahre. Ich habe das Gefühl, Menschen haben ihre Gedanken und ihre Judgements (Urteile, Anm. d. Red.), aber sie sagen sie mir dann nicht mehr und hören mir zu. Sie interagieren ja dann mit einem realen Menschen und nicht mehr mit der Idee, mit der sie ein Problem haben, deshalb müssen sie sich ihre Gedanken machen. Das lockert viele dann zumindest so weit auf, dass sie sagen: „Okay, verstehe ich nicht, aber ich gehe trotzdem respektvoll mit dem Menschen um, denn ich habe ja einen Menschen getroffen, mit dem ich diese Verbindung hatte.“ Irgendwie schön.
Andererseits habe ich auch eine Phase in meinem Leben gehabt, in der ich entweder nur die muslimische Identität oder nur die queere Identität hatte und die beiden Communities ein Problem mit der jeweils anderen hatten. Ich will sie jetzt nicht als sich gegenüberstehende Seiten darstellen, aber trotzdem hat man oft eine Abneigung gespürt und gehört, die ich jetzt nicht mehr wahrnehme, weil ich ja dieser Repräsentant bin, dem man das nicht ins Gesicht sagen möchte.
Maryam:
Ich kann mir vorstellen, dass diese beiden Gruppen ein bestimmtes Bild voneinander haben und es ja auch, wie Jenny eben schon gesagt hat, medial selten so vermittelt wird, als wäre es miteinander vereinbar. Abgesehen davon, ist in der Mehrheitsgesellschaft Queer-Sein immer noch nicht in der letzten Ecke angekommen, ist nichts, was als „normal“ gilt. Ich glaube, es sind nochmal ganz andere Diskussionen, die da geführt werden müssten… Du hast gerade gesagt, du warst in der Schule und hast ein Leben hinter dir, in der du in der einen oder der anderen Identität Zeit verbracht hast. Gibt es etwas, was du dir von Lehrkräften gewünscht hättest?
Ahmed:
Ich bin kein Pädagoge, also müsste ich da jetzt länger drüber nachdenken, um zu schauen, wie man mit so einem Kind umgeht…
Ich weiß aber selbst, dass ein paar Lehrkräfte richtig mit mir umgegangen sind und ich da nicht so positiv drauf reagiert habe, weil ich mich vor allem in der queeren Identität so erwischt gefühlt habe. Ich glaube, als queerer Mensch in einer Gesellschaft oder in einem Umfeld, in dem das nicht in Ordnung ist, in dem das sogar gefährlich sein könnte, ist es total schwierig, weil du schnell lernen musst, andere Menschen zu sehen, bevor sie dich sehen und dich ständig verstecken musst. Du willst, dass es in deiner Kontrolle ist, wie weit und wo du gesehen wirst. Wenn dann eine Lehrkraft kommt, die meistens lebenserfahrener ist und das im Blick hat oder es mit der Zeit wahrnimmt und du so gar nicht darauf gefasst bist und dir mit anderen Worten sagt: „Ich erkenne dich, ich sehe dich mit deinen ganzen bunten Farben, die du da versteckst“, hat das oft Panik in mir ausgelöst. Ich habe nicht so positiv reagiert auf Lehrkräfte, die eigentlich mit sehr viel Verständnis und sehr liebevoll auf mich zugegangen sind. Trotzdem war das eine positive Erfahrung. Vielleicht sollte man eher die Perspektive haben: Queere Kinder sind häufig Kinder, die, wenn es in ihrem Umfeld schwierig ist, eher versuchen, nicht gesehen zu werden und bei denen das halt vielleicht auch Angst und eine Defensive auslösen kann, wenn man sie damit konfrontiert. Das im Blick zu haben, ist, finde ich wichtig.
Maryam:
Würdest du dann sagen, dass es besser ist, es nur wahrzunehmen und nicht anzusprechen? Oder würdest du im Nachhinein sagen, es hat trotzdem irgendwie was gebracht, obwohl es in dem Moment Panik in dir ausgelöst hat und es dir unangenehm war? Es gibt ja immer die aktuelle Betrachtung und die rückwirkende Betrachtung.
Ahmed:
Wenn ich persönlich da agieren würde, würde ich dem Kind signalisieren, dass seine Identität bei mir sicher ist, sich das Kind bei mir ausdrücken kann und parallel dazu diese Themen vor der Klasse ansprechen – also meine Position zu dem Thema nicht direkt vor dem Kind äußern, genauso bei muslimischen Kindern. Eine weltoffene und eine respektvolle Position dem Thema gegenüber vor der Klasse aufzeigen, besprechen, Hass und Diskriminierung keinen Raum geben und dann auch in der Klasse ansprechen, dass es dafür keinen Raum gibt und dem Kind eher signalisieren: „Bei mir bist du sicher.“ Das Kind wird, wenn es möchte und das braucht, dann automatisch zu dieser Lehrkraft gehen oder bereits durch diese zwei Komponenten genug gewonnen haben, um stabiler aus diesem Raum zu gehen.
Jenny:
Lehrkräfte müssen am Ende auch nicht unbedingt immer die Ansprechpersonen sein. Es gibt ja auch noch andere. Auf der anderen Seite verbringt man ganz schön viel Zeit mit Lehrkräften und wenn sie positive Signale senden, kann das ja auch helfen, selbst wenn sie nicht die Personen sind, zu denen man am Ende geht, sondern vielleicht außerhalb noch andere Personen sind.
Ahmed:
Sie sind häufig irgendwo Repräsentant*innen der Gesellschaft. Wenn nicht gerade über soziale Medien, bekommt man über sie etwas von der Gesellschaft mit. Wenn man sich fragt: „Was für ein Meinungsbild herrscht in den Köpfen um mich herum?“, dann schaut man häufig zur Lehrkraft.
Jenny:
Du hast vorhin schon erzählt, dass du häufig schlechte Erfahrungen oder vielleicht auch diskriminierende Erfahrungen gemacht hast, als du noch nicht so mit deiner Identität in die Öffentlichkeit gegangen bist und sie so offen vor dir hergetragen hast. Was ist denn dein Weg, um mit diskriminierenden Erfahrungen umzugehen? Oder was könntest du auch anderen raten, wie sie damit umgehen können?
Ahmed:
Ganz wichtig an erster Stelle: Sicherheit. Ich muss mich nicht in jedem Kontext äußern, in dem ich irgendetwas mitbekomme und mich dann selbst in Gefahr bringen. Wenn es sicher ist und ich mich sicher fühle, dann ist es immer gut, zu sagen: „Das geht nicht. Diese Aussagen sind gefährlich für gewisse Menschen und haben weitreichende Effekte, wenn sie so in der Gesellschaft einfach weiter ausgetragen werden.“ Dann sollte man Grenzen setzen und das definitiv ansprechen. Aber man sollte vor allem für sich auch Sicherheit kreieren. Es geht ja darum, dass man sich selbst oder andere Menschen empowert, ohne sich selbst oder andere Menschen dadurch zu sehr zu belasten.
Ich glaube, das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Man muss in dem Moment ganz kurz im Kopf eine Analyse für sich machen: „Ist das jetzt gefährlich, wenn ich was sage? Welche Auswirkungen hat diese Aussage oder diese Tat?“ Dann muss man für sich abwägen, ob man jetzt einschreitet oder ob man sich in einen sichereren Space (figurativer Raum, Anm. d. Red.) zurückzieht und Komfort braucht, für sich selbst oder für andere da sein muss. Ich glaube, da gibt es nicht so die eine richtige Sache.
Maryam:
Hast du denn einen Ort, an dem du dich besonders wohlfühlst: einen Safe Space, also einen sicheren Ort?
Ahmed:
Safe Spaces können ja auch Menschen sein. Es gibt ein, zwei Personen, zu denen ich hingehe, wenn ich das brauche, und da fühle ich mich dann sicher und supported.
Bei mir ist es auch das Meer. Ich bin total wasserverbunden und wenn ich im Meer bin, dann habe ich die Welt vergessen. In meiner Wohnung oder einem Space, den ich für mich habe, wo ich die Tür abschließen kann, fühle ich mich sicher.
Aber ich hatte lange kein einfaches Leben, hatte ein ziemlich hartes Upbringing und hatte ganz lange keinen Ort. Wenn man „zuhause“ gesagt hat, konnte ich damit nichts verbinden, weil ich kein festes Zuhause hatte. Ich erinnere mich an einen Moment, in dem ich nach einer richtig schlimmen Café-Schicht und hatte gerade meine erste eigene Wohnung – super müde und emotional aufgebracht nach Hause bin, die Tür abgeschlossen habe und vor mich hingeflüstert habe: „Endlich zuhause.“ Als ich das gesagt habe, ist mir aufgefallen, dass es der erste Ort ist, den ich als Zuhause bezeichne und in dem ich mich sicher fühle. Ich bin dann total in Tränen ausgebrochen und war super dankbar. Es ist auch nicht selbstverständlich, dass man diesen Safe Space hat, wenn man eine komplexe Identität hat, ein hartes Upbringing hatte oder als queerer Mensch vielleicht auch keinen Kontakt mehr zur Familie hat. Aber bei mir wurde es mein Zuhause und die „Chosen Family“, die ich mir selbst angelegt habe.
Maryam:
Für unsere Zuhörer*innen: „Chosen Family“ sind sozusagen die Personen, die man sich im Leben sucht, die anstelle der biologischen Familie stehen können: Freunde, Menschen, die man trifft, vielleicht auch Verwandte.
Ahmed:
Ganz wichtiger Begriff in queeren Communities, weil viele von ihrer Familie verstoßen werden. Ich glaube, der Begriff kommt aus New York, aus den Siebzigern. Da gab es die sogenannte „Ballroom Culture“ und da haben sich die Menschen zu „Families“ und „Houses“ zusammengeschlossen und hatten dort ihre „Chosen Family“, meistens auch mit einer „Mutter des Hauses“. Schönes Konzept! Ich gehöre nicht zu irgendeinem House oder so, aber ich habe schon meine Chosen Family.
Jenny:
Freund*innen, mit denen man Zeit verbringt, die Wahlfamilie, die können einem sehr viel Sicherheit und Heilung geben. Auf Instagram heißt du „thehealingkhan“ und dort beschäftigst du dich mit Heilungsprozessen und mit Coaching. Vielleicht kannst du sagen, was du da eigentlich genau machst und was da deine Ziele sind?
Ahmed:
Es ist eine super interessante Geschichte mit dem Namen, denn als ich damit begonnen habe, hieß ich auf Instagram einfach nur „The Sadkhan“, weil das mein Nachname ist, und dann haben mich Leute gefragt: „‚Sadkhan‘, warum traurig?“ Also musste ich das „Sad“ durch etwas ersetzen. Ich mache sehr viele Dinge. Ich gehe auch gerade wieder zur Uni, hole etwas nach und beende mein Studium in Biotechnologie und die Leute fragen sich immer: „Du machst Antirassismus-Arbeit, Coaching, bist Speaker und Aktivist, queer und muslimisch. Was hat das alles miteinander zu tun?“ Ich musste mir irgendwann auch ernsthaft die Frage stellen: Was ist die Verbindung? Für mich ist es tatsächlich „Heilung“. Dazu gibt es jetzt verschiedene Definitionen. Ich finde die Frage „was ist Heilung?“ super interessant. Eine Definition von Heilung ist die Überwindung oder Genesung von einer Verletztheit. Ich würde nicht sagen, dass Heilung nur im Krankenhaus oder im Therapiezimmer stattfindet – v.a. Therapie und Psychologie sind noch gar nicht so lange gesellschaftlich akzeptiert. Ich habe das Gefühl, dass es inzwischen normal geworden ist bzw. normal wird. Aber ganz lange haben wir nur von Heilung gesprochen, wenn du dir das Bein gebrochen hast oder so und das dann geheilt werden musste. Ich glaube, wir haben diese Verletztheit überall auf der Welt, in den Strukturen…
Unsere Welt ist in einem komplizierten, verletzten Zustand. Die Gesellschaft ist verletzt auf vielen Ebenen. Ich finde es super interessant, mir diese Strukturen und Prozesse anzugucken und zu schauen: Welche Prozesse gibt es? Welche Strukturen haben wir? Wo wird etwas verletzt und wie können wir das aufheben? Wo tut es weh und wo kann ich helfen? Beim Coaching passiert das auf persönlicher Ebene. Wenn ich dann irgendwann doch Biotechnologie mache, dann wäre es auf globaler Ebene: Weltprobleme, Hunger usw. Antirassismusarbeit ist die gesellschaftliche Ebene, also wenn es um Queer-Empowerment und Aktivismus geht. Daher wurde für mich mein Pseudonym, mit dem ich mich verbinden kann, „thehealingkhan“, also Heilung. Das hat sich irgendwann einfach so etabliert und das haben sich die Leute eher als meinen Namen einfach gemerkt.
Maryam:
Hast du eigentlich ein Vorbild? Also eine Person, die dich inspiriert hat?
Ahmed:
In den verschiedenen Communities sind es verschiedene Menschen. Beim Coaching ist es so „der“ Life Coach Tony Robbins. Er macht ganz viel mit Sprache und Glaubenssätzen. Er füllt ganze Hallen und ändert die Glaubenssätze von Menschen in einer Konversation, weil er so stark in NLP trainiert ist. Er weiß, was er in welchem Moment sagen muss, wie er die Körpersprache einer Person in dem Moment verändern muss. Dann gibt es auch ganz viele spirituelle Lehrer, die ich in Lateinamerika und anderen Ländern getroffen habe, von denen ich ein bisschen was gelernt habe, die irgendwo auch Freunde geworden und auch Vorbilder sind. Auch andere Freund*innen, Aktivist*innen, die nicht nur Freunde, sondern auch Vorbilder sind.
Maryam:
Noch für alle, die jetzt nicht wissen, was NLP ist: NLP ist auch eine Coaching-Form, also eine Ausbildung, die man machen kann. Ich weiß gerade nicht, wofür NLP genau steht.
Ahmed:
Neuro-Linguistisches Programmieren.
Maryam:
Genau. Das klingt so, als würde man was am Computer machen, aber eigentlich geht es darum, Dinge, an die man glaubt oder auch negative Angewohnheiten zu überschreiben und positiv zu besetzen.
Jenny:
Wir kommen schon zu unserer letzten Frage, die wir allen unseren Gäst*innen stellen. Uns würde am Ende nochmal interessieren, wovon du eigentlich nachts träumst? Gerade vielleicht in Bezug auf die Themen, die wir heute besprochen haben. Was würdest du dir wünschen?
Ahmed:
Ich finde die Frage schwierig, weil ich das Gefühl habe, ich darf die Dinge, die mir als erstes einfallen, die ersten Assoziationen, gar nicht sagen. So etwas wie zum Beispiel Weltfrieden. Dann fällt mir auf, wie traurig es eigentlich ist, dass wir das immer so als etwas Sarkastisches nutzen, so, als wäre es etwas, was ganz weit weg ist. Obwohl das ja eigentlich heißt, dass wir einfach nur leben, entdecken und wachsen können, ohne ständig Überlebensangst zu haben und Traumata zu erleben. Wohingegen wir ja irgendwie auch die ganzen alten Traumata der früheren Generation, die Geschichte, aufarbeiten und heilen müssen und da kommen wir nicht zu, weil es immer etwas Neues gibt, was noch dazukommt. Ich glaube, eine Pause wäre wichtig. Ich kenne das von meinem eigenen Leben, auch wenn ich glaube, dass ich da schon lange drüber hinweg bin. Aber ich sehe immer, wie müde die Menschheit ist und wie müde ganz viele queere Menschen und Muslim*innen aufgrund verschiedener Ereignisse sind. Ich wünsche denen einfach eine Pause und bin dann aber auch irgendwo wütend, weil ich denke – vielleicht bin ich zu idealistisch oder zu utopisch – dass es keine Utopie sein sollte, dass Menschen eine Pause bekommen. Manchmal träume ich aber auch einfach nur von Pistazieneis.
Jenny:
Sehr schön! Ich mag auch sehr gerne Pistazieneis. Ich finde, man darf auf jeden Fall utopisch sein und große Ideale haben. Das brauchen wir, glaube ich.
Maryam:
Pistazieneis, Weltfrieden und eine Pause sind doch eine richtig gute Kombination! Damit können wir jetzt auf jeden Fall ganz beruhigt unseren Podcast beenden, oder?
Jenny:
Ich glaube auch… Vielen Dank, dass ihr beim ufuq.de-Podcast „Wovon träumst du eigentlich nachts?“ dabei wart!
Ahmed:
Ich hole mir jetzt noch ein Pistazieneis…
Zum Weiterhören
Hier geht es zu allen Folgen des ufuq.de-Podcasts „Wovon träumst du eigentlich nachts?“